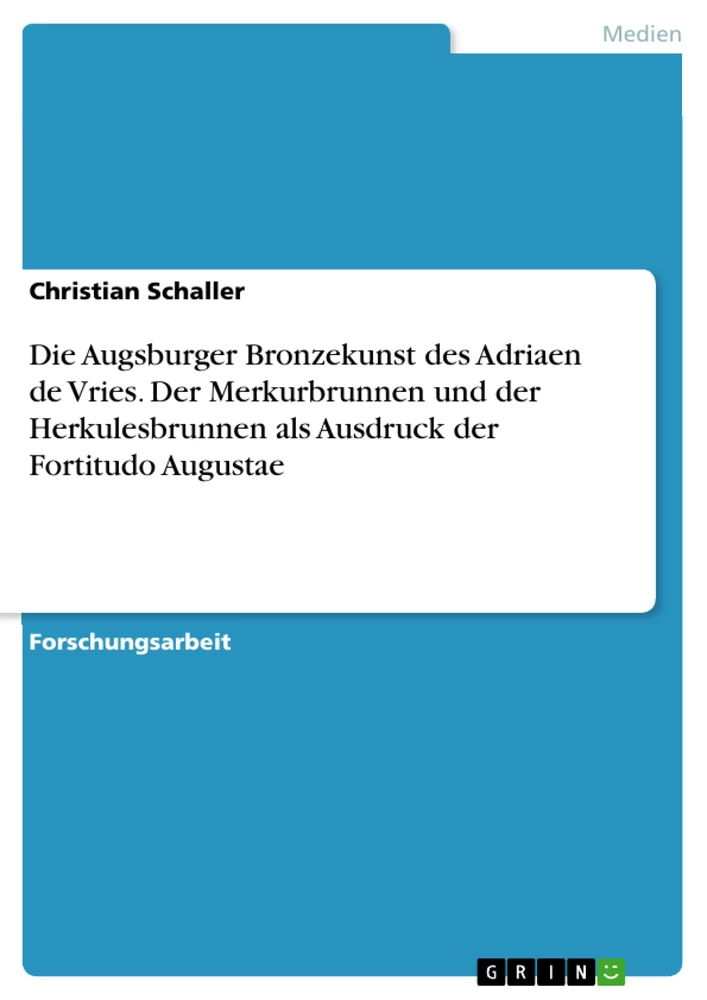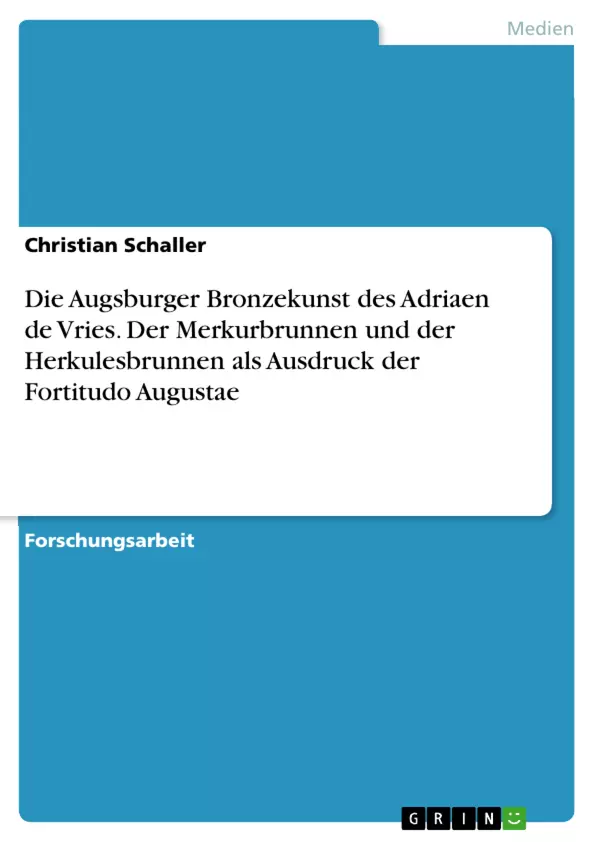Als Austragungsort zahlreicher Reichstage des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation erlebte die Stadt Augsburg im 16. Jahrhundert eine ungeahnte Prosperität. Der auf Bronzeskulpturen spezialisierte Niederländer Adriaen de Vries (1545/1556-1626), ein Schüler Giambolognas (1529-1608), machte sich für den Figurenschmuck und die Komposition von zwei der drei großen Augsburger Prachtbrunnen verantwortlich. Dem 1599 fertig gestellten Merkurbrunnen am Moritzplatz folgte im Jahre 1600 die Fertigstellung des Herkulesbrunnen in der Mitte der heutigen Maximilianstraße.
Die vorliegende Arbeit widmet sich darum der Fragestellung, inwieweit die Augsburger Bronzekunst des Adriaen de Vries als Abbild ihrer Zeit gelten darf. Hierbei oszillieren die politisch-kulturellen Instrumentalisierungen zwischen einem selbstbewussten Ausdruck der Fortitudo Augustae – der Stärke, Tapferkeit und Tüchtigkeit der Reichsstadt – und einer künstlerischen Ausformulierung der zeitgenössischen, bikonfessionellen Idee.
Im Folgenden soll zunächst das historische Vorfeld dargelegt werden. Dies umfasst die erste und zweite Brunnengeneration Augsburgs, welche am Beispiel des Wappners und des Neptuns gerafft präsentiert wird. Eine kurze Darstellung des Augustusbrunnens rundet das Kapitel ab. Dieser leitet als ältester der drei Prachtbrunnen gleichzeitig zum Merkurbrunnen und anschließend zum Herkulesbrunnen über. Diesen beiden von Adriaen de Vries geschaffenen Kunstwerken werden jeweils separierte Kapitel zugestanden. Zunächst erfolgt hierbei eine Beschreibung und eine Kompositionsanalyse des jeweiligen Werkes, anschließend werden mögliche Deutungen und Interpretationsansätze der beiden Zierbrunnen thematisiert. Der Brunnenjüngling im Kastenturm wird anschließend auch in einem separierten Absatz vorgestellt und rundet die Darlegung der konkreten Augsburger Bronzewerke des Adriaen de Vries ab. Das folgende Kapitel legt das Hauptaugenmerk schließlich auf die induktive Einordnung der drei Augsburger Prachtbrunnen in einen größeren Kontext. Hierbei stellt sich erneut die Frage nach der politischen Botschaft der kommunalen Denkmäler im städtischen Gefüge und ob die Brunnen als instrumentalisierte Abbilder ihrer Zeit gelten können – in der für Augsburg so eminent bedeutsamen Epoche zwischen Religionsfrieden und Dreißigjährigem Krieg. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historisches Vorfeld
- Augsburg und die Brunnenkunst im 16. Jahrhundert
- Der Merkurbrunnen
- Beschreibung und Komposition
- Deutungen und Interpretationsmöglichkeiten
- Der Herkulesbrunnen
- Beschreibung und Komposition
- Deutungen und Interpretationsmöglichkeiten
- Der Brunnenjüngling im Kastenturm
- Die Prachtbrunnen als Abbilder ihrer Zeit?
- Augsburg und die Fortitudo Augustae zwischen Religionsfrieden und Dreißigjährigem Krieg
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Augsburger Bronzekunst des Adriaen de Vries, insbesondere den Merkur- und Herkulesbrunnen, im Kontext der politischen und kulturellen Entwicklungen Augsburgs zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem Dreißigjährigen Krieg. Es wird analysiert, inwieweit diese Brunnen als Abbild ihrer Zeit gelten können und welche Botschaften sie vermitteln.
- Die Entwicklung der Augsburger Brunnenkunst im 16. Jahrhundert
- Ikonographische Analyse des Merkur- und Herkulesbrunnens
- Die politische und konfessionelle Bedeutung der Brunnen im städtischen Kontext
- Der Einfluss des Manierismus auf die Gestaltung der Brunnen
- Die Rolle von Adriaen de Vries und seinen künstlerischen Vorbildern
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht, inwieweit die Augsburger Bronzekunst von Adriaen de Vries, speziell der Merkur- und Herkulesbrunnen, die Epoche zwischen Augsburger Religionsfrieden und Dreißigjährigem Krieg widerspiegelt. Sie beleuchtet die Prosperität Augsburgs und die Rolle de Vries als bedeutender Bildhauer dieser Zeit. Die politische und kulturelle Instrumentalisierung der Brunnen wird im Hinblick auf die "Fortitudo Augustae" und die bikonfessionelle Idee erörtert.
Historisches Vorfeld: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung der Augsburger Brunnenkunst im 16. Jahrhundert. Es präsentiert den Wappner und den Neptun als emblematische Beispiele der zweiten Brunnengeneration und analysiert den Augustusbrunnen als Vorläufer der von de Vries geschaffenen Prachtbrunnen. Die wirtschaftlichen und konfessionellen Herausforderungen Augsburgs in dieser Zeit werden ebenfalls beleuchtet, die trotz widriger Umstände zu einer städtebaulichen und künstlerischen Blüte führten.
Der Merkurbrunnen: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Merkurbrunnen, seine Komposition und Gestaltung, und vergleicht ihn mit ähnlichen Werken anderer Künstler, besonders Giambologna. Die ikonographische Analyse des Merkur und Amors konzentriert sich auf die Symbolik des Handels, der Mäßigung und der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Die vielschichtigen Interpretationen des Brunnens als Ausdruck von Augsburgs Handelstradition und als Symbol des Friedens und des Wohlstandes werden diskutiert.
Der Herkulesbrunnen: Dieses Kapitel analysiert den Herkulesbrunnen, seine Komposition und die Symbolik der dargestellten Figuren. Es interpretiert den Kampf des Herkules gegen die Hydra und die begleitenden Figuren (Najaden, Tritonen, Gänsejungen) im Kontext der Augsburger Stadtgeschichte und der politischen Lage der Zeit. Die Bedeutung der drei bronzevergoldeten Reliefs, die die Stadtgeschichte allegorisch darstellen, wird ausführlich erläutert. Die Interpretationen des Brunnens als Herrscherallegorie und als Symbol für die Bewältigung von Krisen werden untersucht.
Der Brunnenjüngling im Kastenturm: Dieses Kapitel beschreibt den kleineren, aber dennoch bedeutenden Brunnenjüngling als ergänzendes Element der Augsburger Brunnenkunst. Seine bescheidene Größe steht im Kontrast zu den monumentalen Merkur- und Herkulesbrunnen und verdeutlicht die Bedeutung des Wassers für die Stadtwirtschaft.
Die Prachtbrunnen als Abbilder ihrer Zeit?: Dieses Kapitel erörtert die Prachtbrunnen im Gesamtkontext der Augsburger Stadtpolitik und der Konfessionalisierung. Es analysiert die Rolle der Fugger, die konfessionellen Spannungen und die politische Botschaft der Brunnen. Die künstlerischen und technischen Aspekte der Bronzekunst und ihre internationale Bedeutung werden ebenfalls diskutiert, mit einem Fokus auf die einzigartige Kombination von künstlerischem Können und städtebaulicher Planung in Augsburg.
Schlüsselwörter
Adriaen de Vries, Augsburger Brunnen, Merkurbrunnen, Herkulesbrunnen, Manierismus, Bronzekunst, Augsburg, Religionsfrieden, Dreißigjähriger Krieg, Fortitudo Augustae, Stadtpolitik, Ikonographie, Symbole, Handel, Frieden, Wohlstand, Konfessionalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Augsburger Bronzekunst von Adriaen de Vries"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Augsburger Bronzekunst des Adriaen de Vries, insbesondere den Merkur- und Herkulesbrunnen, im Kontext der politischen und kulturellen Entwicklungen Augsburgs zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem Dreißigjährigen Krieg. Es wird analysiert, inwieweit diese Brunnen als Abbild ihrer Zeit gelten können und welche Botschaften sie vermitteln.
Welche Brunnen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf den Merkur- und den Herkulesbrunnen. Zusätzlich wird der Brunnenjüngling im Kastenturm kurz erwähnt.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Die Arbeit betrachtet die Zeit zwischen dem Augsburger Religionsfrieden und dem Dreißigjährigen Krieg, wobei auch das historische Vorfeld der Augsburger Brunnenkunst im 16. Jahrhundert beleuchtet wird.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Augsburger Brunnenkunst, die ikonographische Analyse der Brunnen, die politische und konfessionelle Bedeutung der Brunnen im städtischen Kontext, den Einfluss des Manierismus, die Rolle von Adriaen de Vries und seinen künstlerischen Vorbildern sowie die Interpretation der Brunnen als Ausdruck von Augsburgs Handelstradition, Frieden und Wohlstand.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Vorfeld, Kapitel zu den einzelnen Brunnen (Merkurbrunnen, Herkulesbrunnen, Brunnenjüngling), ein Kapitel, welches die Prachtbrunnen als Abbilder ihrer Zeit interpretiert und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung, Kompositionsanalyse und Interpretation der jeweiligen Brunnen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht, inwieweit die Augsburger Bronzekunst von Adriaen de Vries die Epoche zwischen Augsburger Religionsfrieden und Dreißigjährigem Krieg widerspiegelt, beleuchtet die Prosperität Augsburgs und die Rolle de Vries als bedeutender Bildhauer dieser Zeit. Die politische und kulturelle Instrumentalisierung der Brunnen wird im Hinblick auf die "Fortitudo Augustae" und die bikonfessionelle Idee erörtert. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Fazit der Arbeit zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Adriaen de Vries, Augsburger Brunnen, Merkurbrunnen, Herkulesbrunnen, Manierismus, Bronzekunst, Augsburg, Religionsfrieden, Dreißigjähriger Krieg, Fortitudo Augustae, Stadtpolitik, Ikonographie, Symbole, Handel, Frieden, Wohlstand, Konfessionalisierung.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, welches sich für die Geschichte Augsburgs, die Kunst des Manierismus und die Bronzekunst interessiert. Sie eignet sich insbesondere für Studierende und Wissenschaftler der Kunstgeschichte, Geschichte und Kulturwissenschaften.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnte ein Link zu einer Webseite oder einer Publikation eingefügt werden, falls vorhanden)
- Quote paper
- M.A. Christian Schaller (Author), 2017, Die Augsburger Bronzekunst des Adriaen de Vries. Der Merkurbrunnen und der Herkulesbrunnen als Ausdruck der Fortitudo Augustae, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215418