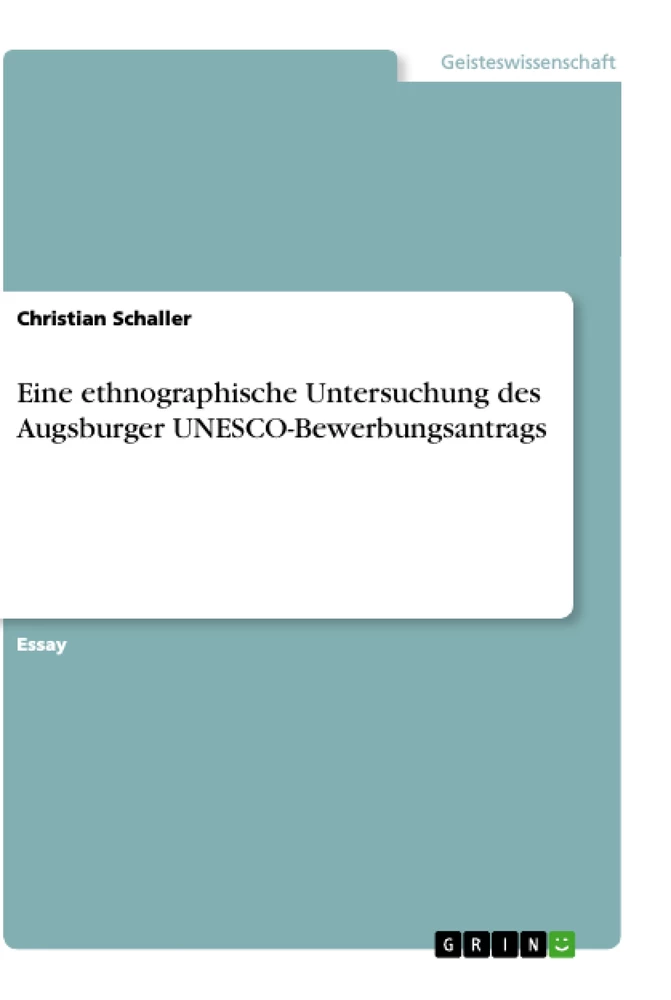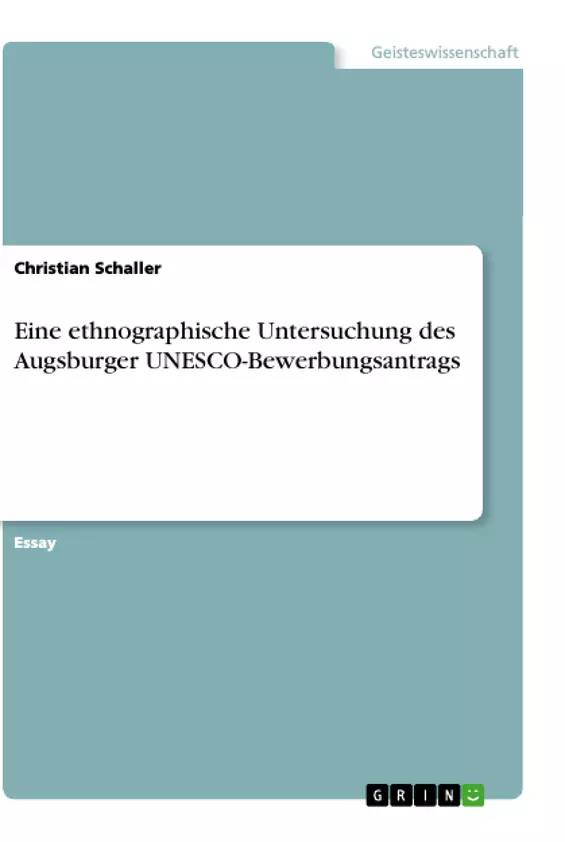Die gegenwärtige Bewerbung des Wassersystems der Stadt Augsburg als UNESCO-Welterbe bildet bereits auf den ersten Blick eine weltweit einzigartige Mischung aus inhaltlicher Komplexität und über 800 Jahre Kontinuität. Das System wird durch 22 offizielle Bewerbungsobjekte repräsentiert. Diese decken weit mehr ab als nur hydrotechnische Innovationen und Leistungen. Sie besitzen teils emblematischen Charakter und kreieren ein Bild der Wasserwirtschaft als so bezeichnete "Lebensader", welche sich durch alle Epochen und Entwicklungslinien der Stadtgeschichte zieht. Gegenwärtig versucht sich Augsburg durch eine historische wie gegenwärtige Identität als „Stadt des Wassers“ mit all ihren Aspekten von der manieristischen Brunnenkunst bis hin zur modernen Trinkwasserversorgung zu profilieren. Das Augsburger Kulturerbe fungiert hier als identitätspolitische Ressource und nicht zuletzt auch als ökonomische Ware und Politikum. Abseits der Kontinuität und Inwertsetzung mit dem Label "Wasser" stellt sich darum die allgemeine Frage nach den Chancen und Risiken der Bewerbung für die Stadt Augsburg.
Der Hauptteil gliedert sich in drei Kapitel. Das erste analysiert die Konstruktion des kulturellen Bewusstseins in Augsburg vom frühen 20. Jahrhundert bis zur jüngsten Vergangenheit. Der Fokus liegt dabei auf der "modernen" Stadtentwicklung Augsburgs, ihrer touristischen Vermarktung sowie den damit einhergehenden Strukturen der soziokulturellen Gegebenheiten. Die Stadtentwicklung im 19. und vor allem im späteren 20. Jahrhundert kann nicht zuletzt auch als Schlüssel zu Identität und Bewusstsein der heutigen Stadt Augsburg gesehen werden. Das nächste Kapitel wird sich der gegenwärtigen UNESCO-Bewerbung sowie der historischen und gegenwärtigen Verortung der UNESCO-Bewerbungsattribute in der Öffentlichkeit annehmen.
Das letzte Kapitel widmet sich dann der konkreten Chancen und Risiken, welche die Bewerbung für die Stadt mit sich bringt. Im knapp bemessenen Rahmen des Essays wird keineswegs der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, Ziel ist lediglich die knappe und grundlegende Hervorhebung der Potentiale und Gefahren im Stil einer rudimentären, ethnographischen Untersuchung des Augsburger UNESCO-Bewerbungsantrags. Die Kriterien für die vorgenommenen Werturteile werden auf der Basis der Inhalte des Bewerbungsdossiers der Stadt Augsburg sowie themenverwandter, wissenschaftlicher Publikationen gefällt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „Konstruktion“ des kulturellen Bewusstseins
- Die Vermarktung Augsburgs vom 19. bis zum 21. Jahrhundert
- Das Selbstbild Augsburgs in der UNESCO-Bewerbung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert den Bewerbungsantrag der Stadt Augsburg für die Aufnahme des Wassersystems in die UNESCO-Welterbeliste. Dabei liegt der Fokus auf der Konstruktion des kulturellen Selbstbildes der Stadt in den letzten Jahrhunderten und der Rolle der Wasserwirtschaft als identitätspolitische Ressource.
- Die Entwicklung des städtischen Selbstbildes von der Reichsstadt zur Industriestadt
- Die Vermarktung Augsburgs im 19. und 20. Jahrhundert und die Rolle der Wasserwirtschaft
- Die Verwendung des Wasserthemas in der UNESCO-Bewerbung
- Chancen und Risiken der UNESCO-Bewerbung für die Stadt Augsburg
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die UNESCO-Bewerbung der Stadt Augsburg für ihr Wassersystem als ein Beispiel für die Verschmelzung von inhaltlicher Komplexität und langer Kontinuität vor. Es wird die Bedeutung der Wasserwirtschaft für die Stadtgeschichte und die aktuelle Identität Augsburgs als „Stadt des Wassers" hervorgehoben. Zudem werden die Chancen und Risiken der Bewerbung für die Stadt beleuchtet.
„Konstruktion“ des kulturellen Bewusstseins - die Vermarktung Augsburgs vom 19. bis zum 21. Jahrhundert
Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des kulturellen Selbstbildes Augsburgs vom Ende der Reichsstadtzeit bis zur jüngsten Vergangenheit. Es wird der Wandel von einer traditionellen Handelsstadt zu einer Industriestadt, die sich mit der Industrialisierung auseinandersetzen musste, beschrieben. Dabei werden die Vermarktungsstrategien und das städtische Selbstverständnis in den verschiedenen Epochen beleuchtet. Die Bedeutung der Wasserwirtschaft im Kontext der Stadtentwicklung wird aufgezeigt, und es wird erläutert, wie die Stadt sich in verschiedenen Epochen mit dem Thema "Wasser" auseinandersetzte.
Das Selbstbild Augsburgs in der UNESCO-Bewerbung
In diesem Kapitel wird die offizielle Interessenbekundung der Stadt Augsburg für die UNESCO-Welterbebewerbung unter dem Titel „Wasserbau und Wasserkraft, Trinkwasser und Brunnenkunst“ betrachtet. Es wird der "außergewöhnliche universelle Wert" der historischen Wasserwirtschaft Augsburgs hervorgehoben, der als Grundlage für die Bewerbung dient. Die Fülle an authentischen Objekten und die lange Tradition der Wasserwirtschaft werden als entscheidende Argumente für den UNESCO-Status dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Essays sind: Stadtentwicklung, kulturelles Selbstbild, Wasserwirtschaft, UNESCO-Welterbebewerbung, Vermarktung, Identität, „Stadt des Wassers“, Chancen und Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Warum bewirbt sich Augsburg mit seinem Wassersystem als UNESCO-Welterbe?
Das System bietet eine weltweit einzigartige Mischung aus inhaltlicher Komplexität und über 800 Jahren Kontinuität in der Wasserwirtschaft und hydrotechnischen Innovation.
Welche Objekte gehören zur Augsburger Welterbe-Bewerbung?
Insgesamt 22 offizielle Objekte repräsentieren das System, von manieristischer Brunnenkunst bis hin zur modernen Trinkwasserversorgung.
Was bedeutet die „Konstruktion des kulturellen Bewusstseins“ für Augsburg?
Die Arbeit analysiert, wie sich Augsburg von einer Handels- zur Industriestadt entwickelte und dabei das Wasserthema als identitätspolitische Ressource und touristische Marke nutzte.
Welche Chancen bietet der UNESCO-Status für die Stadt?
Der Status dient als Qualitätssiegel, das den Tourismus fördert, die Stadtidentität stärkt und den Erhalt historischer Denkmäler sichert.
Gibt es Risiken bei der UNESCO-Welterbe-Bewerbung?
Risiken liegen in der ökonomischen Vereinnahmung des Kulturerbes, möglichen Einschränkungen bei der Stadtentwicklung und dem Druck durch steigende Besucherzahlen.
- Quote paper
- Christian Schaller (Author), 2017, Eine ethnographische Untersuchung des Augsburger UNESCO-Bewerbungsantrags, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215485