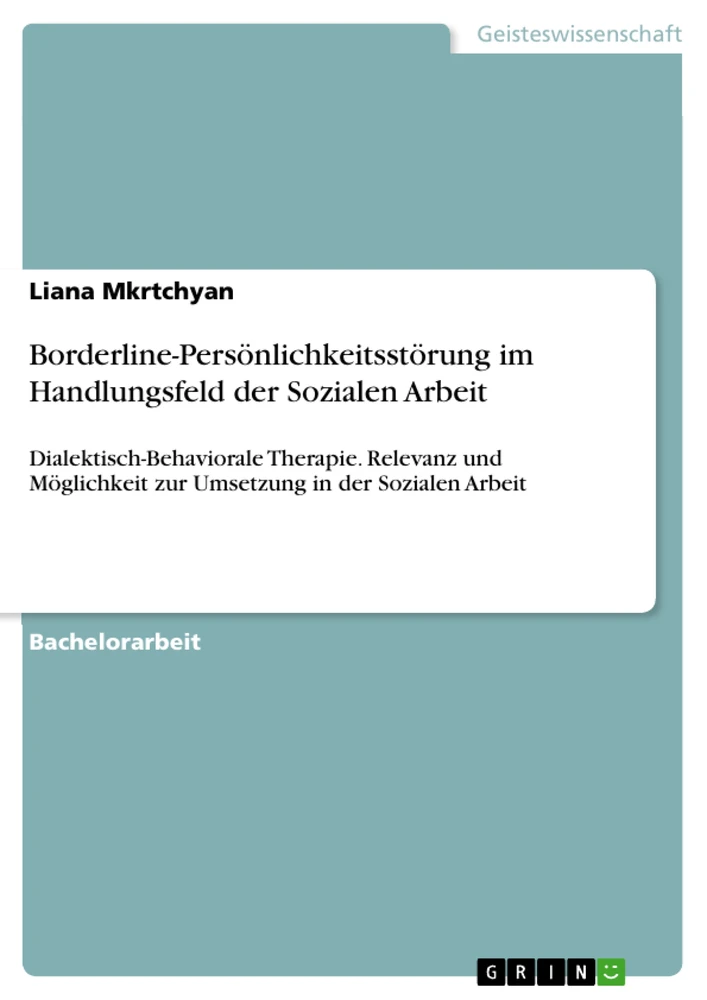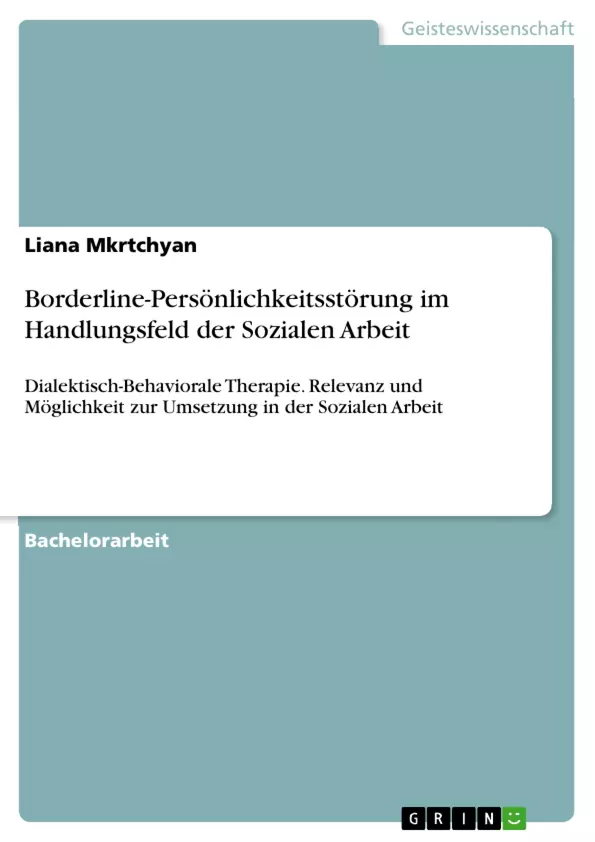Die Arbeit legt den Fokus auf die herausfordernden Eigenschaften und Verhaltensweisen der Menschen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden und auf die therapeutischen und unterstützenden Maßnahmen seitens der Psychotherapeuten und der Sozialarbeiter.
Durch ein besseres Verständnis der Auswirkungen der Symptome und Ursachen der Erkrankung wird es Sozialarbeitern ermöglicht, spezifische Kompetenzen und Interventionen herauszuarbeiten. Dadurch können sie Personen, die von einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen sind, psychosozial begleiten und betreuen.
Ziel dieser Arbeit ist es, durch die Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Handlungsrahmen der Sozialarbeiter in der Sozialpsychiatrie und psychotherapeutischen Behandlungsstrategien, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Bereichen der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit und psychotherapeutischen Arbeit aufzuzeigen und es wird der Versuch unternommen, psychotherapeutisch basierte Handlungsprinzipien und -strategien mit dem Umgang mit Borderline-Klienten zur Erweiterung des Methodenwissens der Sozialarbeiter einzuleiten.
Inhaltsverzeichnis
- I. Inhaltsverzeichnis
- II. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung - Einführung in das Thema
- 1.1. Problem- und Zielsetzung
- 1.2. Forschungsfragen
- 1.3. Aufbau der Arbeit
- 1.4. Methodisches Vorgehen
- 2. Borderline-Persönlichkeitsstörung
- 2.1. Persönlichkeitsstörungen, Geschichte und Entwicklungslinien des Störungsbegriffs
- 2.2. Kategoriale Diagnostik nach ICD-10 und DSM-5
- 2.2.1. Diagnostische Kriterien nach ICD-10
- 2.2.2. Diagnostische Kriterien nach DSM-5
- 2.3. Entstehung der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- 2.4. Klinische Symptomatik
- 2.4.1. Emotionsregulation
- 2.4.2. Identität
- 2.4.3. Soziale Interaktion
- 2.5. Komorbidität
- 2.6. Epidemiologie und Verlauf
- 3. Dialektisch-Behaviorale Therapie bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung
- 3.1. Verständnis und grundlegende Prinzipien der Dialektisch-Behavioralen Therapie
- 3.2. Therapeutische Grundannahmen
- 3.3. Die therapeutische Beziehungsgestaltung
- 3.4. Therapiestruktur und Behandlungsphasen
- 3.4.1. Vorbereitungsphase
- 3.4.2. Erste Therapiephase
- 3.4.3. Zweite Therapiephase
- 3.4.4. Dritte Therapiephase
- 3.5. Skillstraining
- 3.5.1. Fertigkeiten zur Steigerung der inneren Achtsamkeit
- 3.5.2. Fertigkeiten zur Stresstoleranz
- 3.5.3. Fertigkeiten zum bewussten Umgang mit Gefühlen
- 3.5.4. Zwischenmenschliche Fertigkeiten
- 3.5.5. Fertigkeiten zur Steigerung des Selbstwerts
- 4. Soziale Arbeit in der Sozialpsychiatrie
- 4.1. Theoretische Fundierung und sozialpsychiatrische Grundlagen der Sozialen Arbeit
- 4.2. Zentrale Aufgaben und Kompetenzen in der Berufspraxis
- 4.3. Gestaltung des Hilfeprozesses
- 4.4. Soziale Arbeit mit Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung
- 4.4.1. Ziele und Methoden
- 4.4.2. Die Rolle der Sozialarbeiter
- 5. Möglichkeiten zur Integration der Techniken der Dialektisch-Behavioralen Therapie in die Praxis der Sozialen Arbeit
- 5.1. Achtsamkeitsübungen
- 5.2. Übungen zur Stresstoleranz
- 5.3. Übungen zum Umgang mit Gefühlen
- 5.4. Übungen zum Erwerb zwischenmenschlicher Fertigkeiten
- 5.5. Übungen zur Steigerung des Selbstwerts
- 6. Schlussfolgerung
- III. Literaturverzeichnis
- IV. Anhang
- Anhang A: Übungen zum Spüren
- Anhang B: Übungen zum Ablenken
- Anhang C: Zwischenmenschliche Fertigkeiten
- Anhang D: Liste angenehmer Aktivitäten
- Anhang E: Liste der Glaubenssätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) im Kontext der Sozialen Arbeit. Sie analysiert die Symptomatik, Komorbidität, Ursachen und den Verlauf der BPS, wobei die aktuell gültigen Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-5 als Grundlage dienen. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen, die die BPS für die Teilhabe der Betroffenen am gemeinschaftlichen Leben und die Zusammenarbeit zwischen Klienten und Sozialarbeitern darstellt.
- Die Darstellung der BPS und ihrer Symptome in Bezug auf Emotionsregulation, Selbstkonzept und soziale Interaktion.
- Die Bedeutung der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT) als spezifische Behandlungsmethode für Menschen mit BPS.
- Die Analyse der zentralen Aufgaben und Kompetenzen von Sozialarbeitern in der Sozialpsychiatrie.
- Die Untersuchung von Möglichkeiten, wie Elemente der DBT in die Praxis der Sozialen Arbeit integriert werden können.
- Die Herausforderungen und Chancen der Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeitern und Menschen mit BPS.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert eine Einführung in das Thema und erläutert die Problem- und Zielsetzung der Arbeit sowie die Forschungsfragen. Das zweite Kapitel befasst sich mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Es beschreibt die historische Entwicklung des Störungsbegriffs, die diagnostischen Kriterien nach ICD-10 und DSM-5, die Entstehung der Störung, die klinische Symptomatik, die Komorbidität sowie die Epidemiologie und den Verlauf der BPS.
Im dritten Kapitel wird die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) als spezifische Behandlungsmethode für Menschen mit BPS vorgestellt. Das Kapitel erläutert das Verständnis und die grundlegenden Prinzipien der DBT, die therapeutischen Grundannahmen, die therapeutische Beziehungsgestaltung, die Therapiestruktur und Behandlungsphasen sowie die verschiedenen Skilltrainings der DBT.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Sozialen Arbeit in der Sozialpsychiatrie. Es beleuchtet die theoretischen Grundlagen und die sozialpsychiatrischen Aufgaben der Sozialen Arbeit, die zentralen Aufgaben und Kompetenzen von Sozialarbeitern in der Berufspraxis sowie die Gestaltung des Hilfeprozesses. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Sozialen Arbeit mit Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung und den spezifischen Herausforderungen und Chancen in diesem Handlungsfeld.
Das fünfte Kapitel erörtert Möglichkeiten, wie die Techniken der Dialektisch-Behavioralen Therapie in die Praxis der Sozialen Arbeit integriert werden können. Es werden verschiedene Achtsamkeitsübungen, Übungen zur Stresstoleranz, Übungen zum Umgang mit Gefühlen, Übungen zum Erwerb zwischenmenschlicher Fertigkeiten sowie Übungen zur Steigerung des Selbstwerts vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind Borderline-Persönlichkeitsstörung, Dialektisch-Behaviorale Therapie, Soziale Arbeit, Sozialpsychiatrie, Emotionsregulation, Selbstkonzept, soziale Interaktion, Komorbidität, Skillstraining, Achtsamkeit, Stresstoleranz, zwischenmenschliche Fertigkeiten und Selbstwert.
- Citation du texte
- Liana Mkrtchyan (Auteur), 2021, Borderline-Persönlichkeitsstörung im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215861