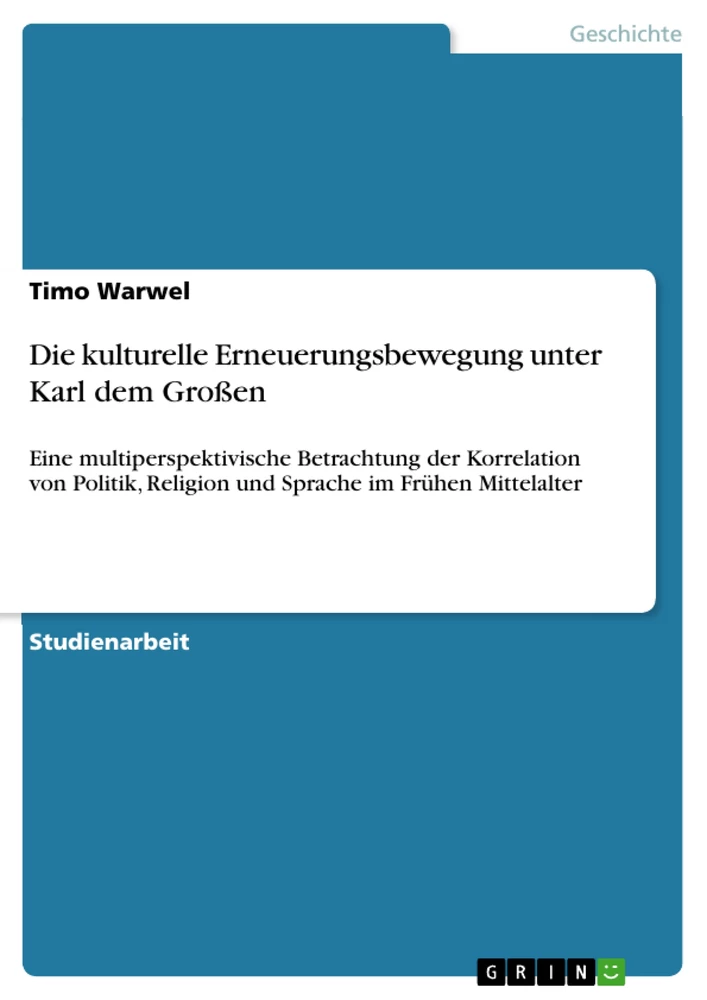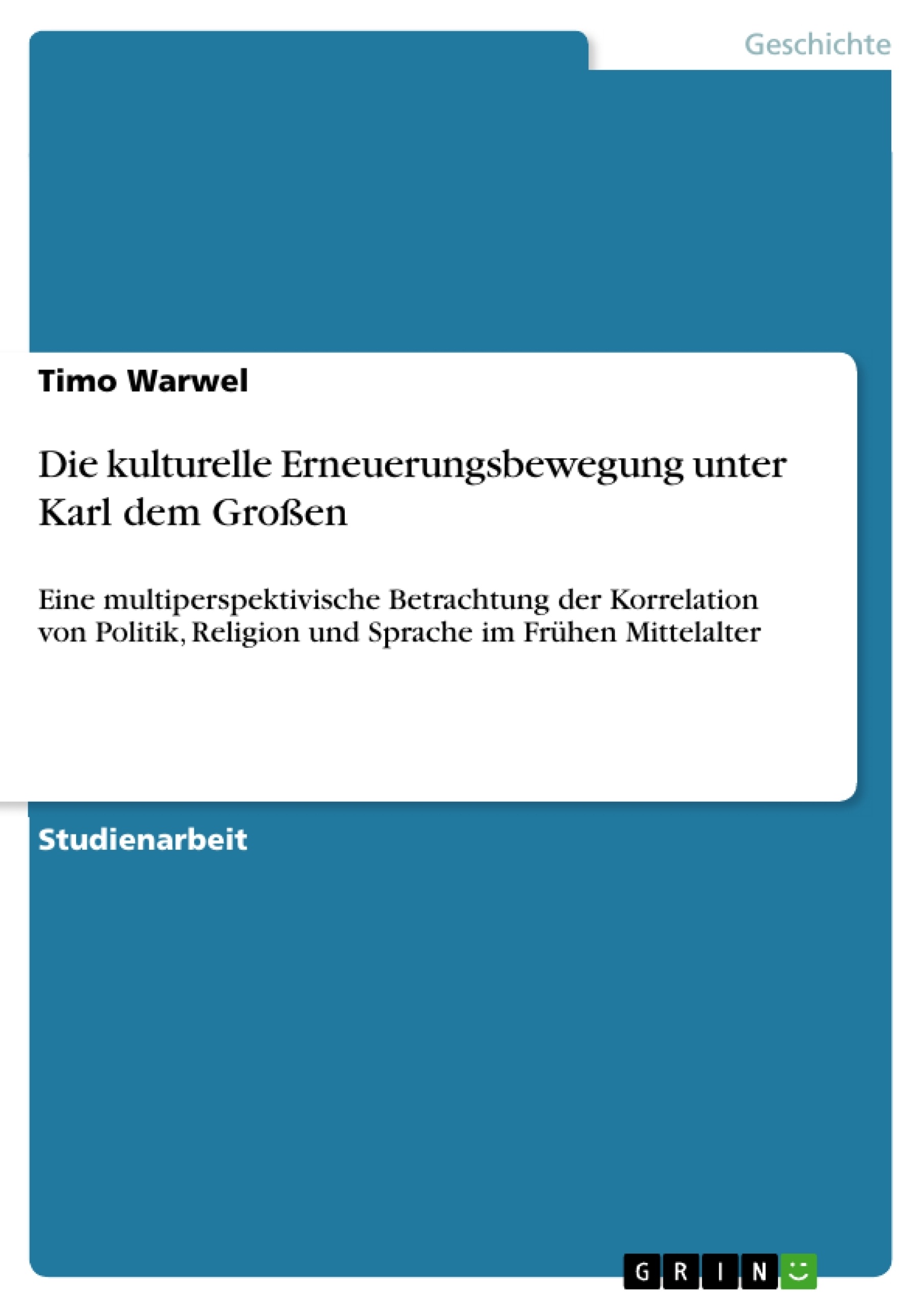Von wem genau, ab wann, wie und aus welchen Gründen wurden die karolingischen Reformen und die daraus hervorgehenden kulturellen Neuerungen angeregt und angetrieben? Inspiriert vom neuen Zeitgeist der Politikgeschichte liegen im spezifischen Fokus der Fragestellung auch die von den Akteuren persönlich präferierten Ziele der Erneuerung von Sprache sowie im Zusammenhang damit die Sammlung von Wissen, der Stellenwert, die Erhaltung und Ausbreitung von Bildung überhaupt. Als spezifische Erweiterung der Fragestellung soll hierfür insbesondere die signifikante Korrelation von orthodoxer Rechtgläubigkeit und richtigem Sprachgebrauch, als fundamentale Voraussetzung zur effektiven Glaubensführung, näher analysiert werden. Damit einhergehend ist die von Karl und seiner Hofschule initiierte und beförderte Auseinandersetzung mit antikem Bildungsgut und deren Transformation in den eigenen christlichen Kontext ebenfalls zu untersuchen.
Bei der praktischen Quellenanalyse sollen hierfür konkrete Bezüge zwischen den ausgewählten Quellen und den von der Forschung bestimmten bildungspolitischen Hauptanliegen der karolingischen Erneuerungsbewegung im historischen Kontext des Frühmittelalters hergestellt werden, unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Frage nach korrektem Sprachgebrauch. Die Diskussion diverser geschichtswissenschaftlicher Standpunkte, insbesondere die Reflexion neuerer Forschungsannahmen in Abgrenzung älterer, werden diesen Erkenntnisprozess im Sinne der Fragestellung potenzieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtsphilosophischer Zugang zum Untersuchungsgegenstand
- Hauptteil
- Historischer Entstehungskontext der Bildungsreformen
- Außenpolitische Situierung
- Innenpolitische Situierung
- Rundschreiben als politische Instrumente
- Die politische Landschaft des Frankenreichs
- Die Idee eines Herrschaftssitzes
- Die Entstehung der Hofschule in der, Hauptstadt Aachen
- Alkuins Einladung an den Hof
- Das soziale Gebilde als Urheber der kulturellen Erneuerungsbewegung
- Das Hofleben
- Alkuins Berufung - Spiritus Rector der Admonitio generalis
- Die Autorschaft der Admonitio generalis
- Die kulturellen Reformen weiterführend kontextualisiert
- Die Korrelation von Bildung und Glaubensführung
- Die bildungspolitische Erneuerungsbewegung
- Der Bildungsstand im Frankenreich
- Mangelhafter lateinischer Sprachgebrauch
- Die Admonitio generalis
- Die sprachlichen Beweggründe
- Die bildungspolitischen Aspekte zur Grundsteinlegung des Schulwesens
- Der Stellenwert von Bildung für die Akteure der Reformbewegung
- Die zentralen Hauptmotive der kulturellen Reformen
- Zwischenfazit - Die gens Francorum transformiert, die Antike'
- Der Bildungsaufschwung im Frankenreich geschichtsphilosophisch interpretiert
- Die kulturellen Reformen politisch-religiös kontextualisiert
- Die gesellschaftspolitischen Interessen der Reformbewegung
- Die hintergründig machtpolitischen Motive der Reformbewegung
- Die sprachlich-religiöse Korrelation resümiert
- Die politischen und gesellschaftlichen Faktoren, die zur Entstehung der Bildungsreformen führten
- Die Rolle der Sprache im Kontext der kulturellen Erneuerung
- Der Einfluss von Religion auf die Bildungspolitik Karls des Großen
- Die Entwicklung des Bildungswesens im Frankenreich
- Die Bedeutung der Admonitio generalis als Schlüsselfaktor der Reformbewegung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die kulturelle Erneuerungsbewegung unter Karl dem Großen aus einer multiperspektivischen Perspektive zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf der Korrelation von Politik, Religion und Sprache im Frühmittelalter.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den geschichtsphilosophischen Zugang zum Untersuchungsgegenstand und stellt die Bedeutung des Frühmittelalters als eigenständige Epoche heraus. Sie skizziert die Herausforderungen der Rekonstruktion historischer Ereignisse im Kontext der Zeit und beleuchtet die Bedeutung von Politikgeschichte als sozial konstruierte Wirklichkeit.
Im Hauptteil wird der historische Entstehungskontext der Bildungsreformen im Frankenreich genauer beleuchtet. Es werden die außen- und innenpolitischen Gegebenheiten, die Rundschreiben als politische Instrumente, die politische Landschaft des Frankenreichs und die Entstehung der Hofschule in Aachen analysiert.
Der Einfluss des sozialen Gefüges auf die kulturelle Erneuerungsbewegung wird in einem weiteren Abschnitt behandelt. Dabei werden das Hofleben, die Berufung von Alkuin als Spiritus Rector der Admonitio generalis und die Autorschaft des Erlasses beleuchtet.
Die bildungspolitische Erneuerungsbewegung wird umfassend betrachtet. Der Bildungsstand im Frankenreich, der mangelhafte lateinische Sprachgebrauch, die Admonitio generalis, die sprachlichen Beweggründe und die bildungspolitischen Aspekte zur Grundsteinlegung des Schulwesens werden eingehend analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der kulturellen Erneuerungsbewegung unter Karl dem Großen, der Korrelation von Politik, Religion und Sprache im Frühmittelalter, der Admonitio generalis, der Entwicklung des Bildungswesens im Frankenreich und der Bedeutung des lateinischen Sprachgebrauchs.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Auslöser für die Bildungsreformen unter Karl dem Großen?
Die Reformen wurden durch den Wunsch nach einer effektiven Glaubensführung und der Korrelation von Rechtgläubigkeit und korrektem Sprachgebrauch (Latein) angetrieben.
Welche Rolle spielte Alkuin am Hof Karls des Großen?
Alkuin galt als der „Spiritus Rector“ der Bildungsreformen und war maßgeblich an der Autorschaft der Admonitio generalis beteiligt.
Was ist die „Admonitio generalis“?
Es handelt sich um ein zentrales Rundschreiben (Kapitular) von 789, das die Grundlagen für die kirchliche und bildungspolitische Erneuerung im Frankenreich legte.
Warum war der korrekte lateinische Sprachgebrauch so wichtig?
Nur durch korrektes Latein konnte sichergestellt werden, dass Gebete und religiöse Texte richtig verstanden und vorgetragen wurden, was als essenziell für das Seelenheil galt.
Wie veränderte sich das Schulwesen unter Karl dem Großen?
Die Reformen legten den Grundstein für ein strukturiertes Schulwesen an Klöstern und Kathedralen, um den Bildungsstand im Reich zu heben.
Welchen Einfluss hatte die Antike auf diese Bewegung?
Die Bewegung strebte eine Transformation und Wiederbelebung antiken Bildungsgutes innerhalb des christlichen Kontextes an.
- Arbeit zitieren
- Timo Warwel (Autor:in), 2020, Die kulturelle Erneuerungsbewegung unter Karl dem Großen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1216452