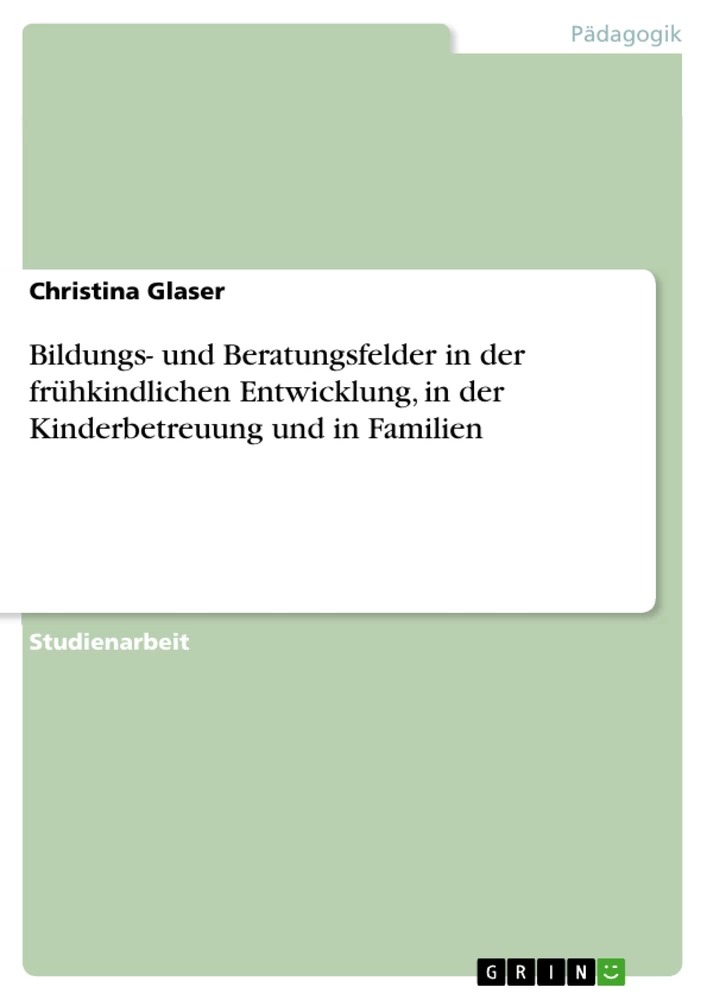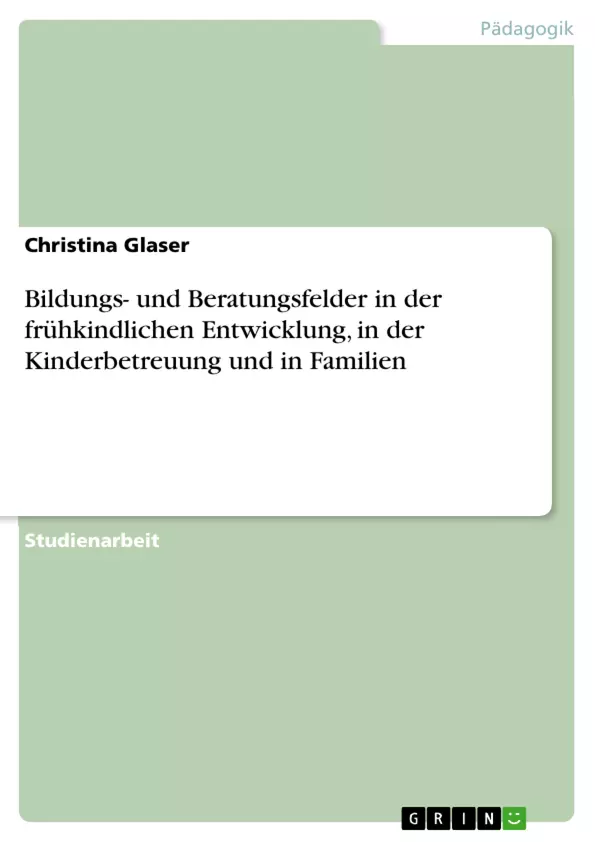In dieser Arbeit werden Bildungs- und Beratungsfelder in der frühkindlichen Entwicklung, in der Kinderbetreuung und in Familien aufgezeigt. Dabei wird der Schwerpunkt auf diese Bildungs- und Beratungsfelder in der Corona Pandemie in Deutschland gesetzt.
Die Familie stellt eine Beziehung verschiedener Einzelsysteme dar wie zwischen Vater und Kind, die ständig im Wandel ist. Die Einzelsysteme wiederum können in Subsysteme unterschieden werden, die Teile der Kernfamilie darstellen. Zu den Teilsystemen gehört die Partnerschaft, in der gegenseitige Bedürfnisse befriedigt und der Partner unterstützt wird. Das Teilsystem der Eltern übernimmt die Aufgabe die Kinder zu ernähren und zu sozialisieren. Geschwister bilden Beziehungen im sogenannten Geschwisterteilsystem aus. Das Teilsystem zwischen den Geschlechtern z.B. Vater zum Sohn, hilft bei der Ausbildung der geschlechtlichen Identität. Die Teilsysteme ordnen ihre Beziehungen und Interaktionen untereinander, wobei die unterschiedlichen Beziehungen durch eine Grenze festgelegt werden, die das System von seiner Umgebung trennt. Die Teilsysteme bilden untereinander eine Hierarchie, wobei das elterliche Teilsystem über dem kindlichen Teilsystem steht.
Die familiären Interaktionen entwickeln eine Dynamik, bei der gemeinsame Sinndeutungen und eine gemeinsame Geschichte den Zeitverlauf über mehrere Generationen hinweg umfasst. Die Verhaltensweisen eines Mitglieds der Familie sind systemrelevant. Einzelne Veränderungen können sehr schnell wahrgenommen werden und Irritationen auslösen. Die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern befinden sich üblicherweise in einem Zustand des Gleichgewichts, wobei in jeder Familie unterschiedliche Entwicklungsstadien durchlaufen werden, in denen sich die Beziehungen verändern, so dass ein neuer Gleichgewichtszustand eintritt.
Durch die am 11. März 2020 ausgerufene Corona Pandemie (Schlack, 2020) hat sich das Familiensystem und die damit einhergehenden Einschränkungen des Sozialraums verändert, da alle Beteiligten enger miteinander verbunden und aufeinander angewiesen sind. Für die Kinder brach mit der Schließung der Kindertagesstätten der gewohnte Alltag mit den sozialen Kontakten zusammen. Solch ein gewaltiger Umbruch erfordert professionelle Unterstützung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung des Themas
- Forschungsfrage
- Ziel der Arbeit
- Aufbau und Methode der Arbeit
- Hauptteil
- Wahrnehmung des Kindes
- Bildungs- und Beratungsfelder
- Handlungsfeld Beobachtung und Nähe zum Kind
- Handlungsfeld Kommunikation
- Handlungsfeld Umgang zwischen Kind und Erwachsenen
- Handlungsfeld zwischen verschiedenen Sozial- und Zeiträumen
- Beratung der Bezugspersonen und Handlungsempfehlungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Bildungs- und Beratungsangeboten für Familien während der Corona-Pandemie. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Herausforderungen, die sich für Familien mit kleinen Kindern durch die Pandemie ergeben haben.
- Wahrnehmung von Veränderungen in Familien durch Kinder
- Bildungs- und Beratungsfelder in der frühkindlichen Entwicklung
- Handlungsempfehlungen für Bezugspersonen von Kindern
- Die Bedeutung von Beobachtung und Nähe zum Kind
- Die Rolle von Kommunikation und Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung erläutert die Bedeutung des Themas der frühkindlichen Entwicklung im Kontext der Corona-Pandemie und stellt die Forschungsfrage sowie das Ziel der Arbeit dar. Es wird die Bedeutung des Familien- und Bildungssystems, sowie die daraus resultierenden Herausforderungen der Pandemie für Familien und Kinder beschrieben.
Hauptteil
Wahrnehmung des Kindes
Dieses Kapitel beleuchtet die individuelle Wahrnehmung von Kindern in verschiedenen Entwicklungsstufen und ihre Reaktion auf die Veränderungen im Familienalltag während der Corona-Pandemie. Es wird auf die Bedeutung von Bindungsforschung und die Auswirkungen von Stress und Veränderungen auf das kindliche Verhalten eingegangen.
Bildungs- und Beratungsfelder
Dieses Kapitel fokussiert auf verschiedene Handlungsfelder in der frühkindlichen Entwicklung, die durch die Pandemie besonders relevant geworden sind. Es werden wichtige Themen wie Beobachtung und Nähe zum Kind, Kommunikation, Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen sowie die Einbettung des Kindes in verschiedene Sozial- und Zeiträume behandelt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt Themen wie frühkindliche Entwicklung, Corona-Pandemie, Bildungs- und Beratungsfelder, Familienberatung, Familieninteraktion, Wahrnehmung, Bindungsforschung, Kommunikation, soziale Interaktion und Handlungsempfehlungen.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste die Corona-Pandemie das Familiensystem?
Durch Kita-Schließungen und Kontaktbeschränkungen veränderte sich der Sozialraum massiv; Familienmitglieder waren enger miteinander verbunden und aufeinander angewiesen.
Welche Bildungs- und Beratungsfelder sind für Familien wichtig?
Wichtige Felder sind die Beobachtung und Nähe zum Kind, die Kommunikation innerhalb der Familie sowie der Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen in Krisenzeiten.
Was ist die systemische Sicht auf die Familie?
Die Familie wird als System aus Subsystemen (Eltern, Geschwister, Partner) betrachtet, in dem Veränderungen eines Mitglieds Auswirkungen auf das gesamte Gleichgewicht haben.
Warum ist Bindungsforschung in der Pandemie relevant?
Die Bindungsforschung hilft zu verstehen, wie Kinder auf Stress und den Wegfall gewohnter Strukturen reagieren und welche Unterstützung sie von Bezugspersonen benötigen.
Welche Handlungsempfehlungen gibt die Arbeit für Bezugspersonen?
Die Arbeit empfiehlt professionelle Unterstützung sowie eine bewusste Gestaltung der Interaktion und Kommunikation, um den Umbruch für Kinder abzufedern.
- Citation du texte
- Christina Glaser (Auteur), 2022, Bildungs- und Beratungsfelder in der frühkindlichen Entwicklung, in der Kinderbetreuung und in Familien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1217194