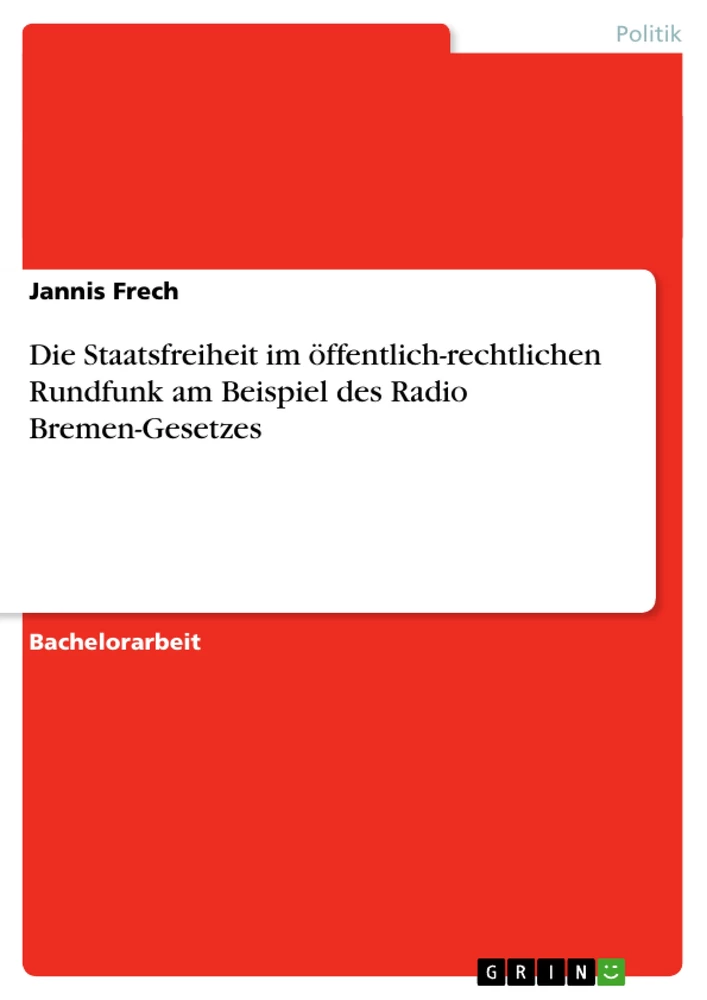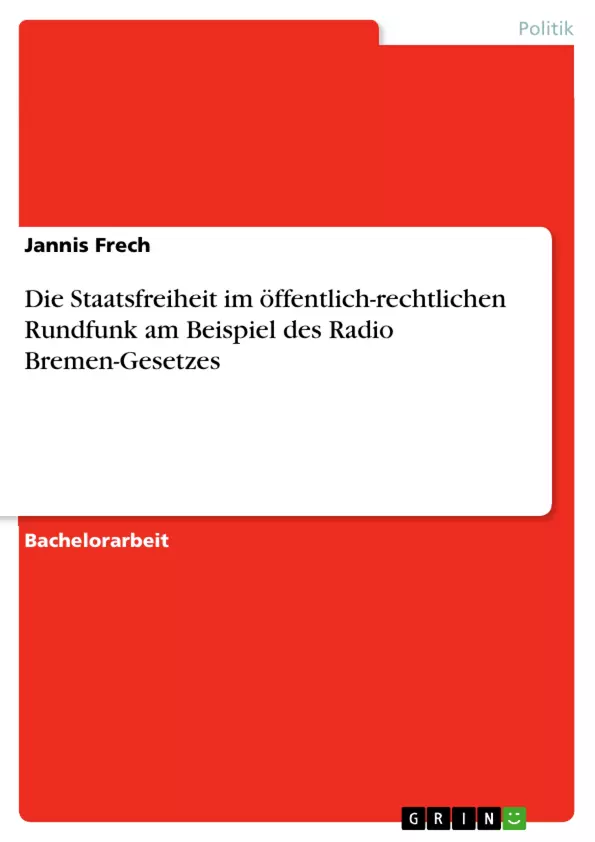Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein wesentlicher Bestandteil des politischen und gesellschaftlichen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Seine Einrichtung nach Ende des zweiten Weltkrieges stand tief unter den Eindrücken des totalitären NS-Regimes. Die oberste Devise lautete deshalb Staatfreiheit. Denn „erst die Unabhängigkeit des Mediensystems vom staatlichen Bereich verschafft jene Glaubwürdigkeit, die für legitimatorische Vorgänge im politischen Bereich notwendig erscheint.“ Der Rundfunk in Deutschland sollte fortan als Medium der Gesellschaft dienen und nicht dem Staat. Dies stellte den Gesetzgeber vor große organisatorische Herausforderungen.
Das Rundfunkssystem hat sich seitdem stark gewandelt, vor allem durch das Hinzukommen eines privaten Rundfunks. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist heute mehr denn je einem hohen Legitimationsdruck ausgesetzt und Gegenstand von regionalen, nationalen und kontinentalen Debatten. Die Diskussion um seine Staatsferne und den Einfluss von Parteien auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist dabei aber nicht neu: „Die Frage nach Freiheit oder Abhängigkeit des Rundfunks vom Staat durchzieht wie ein roter Faden die gesamte Rundfunkgeschichte.“ Eine wesentliche Rolle in der Frage nach Staatsfreiheit und Unabhängigkeit des Rundfunks spielen die Aufsichtsgremien. In diesen sitzen Vertreter der Gesellschaft und der Politik und beaufsichtigen den Rundfunk nach gesetzlich festgeschriebenen Kriterien. Die Rolle der Politik in den Rundfunkgremien erscheint dabei als besonders interessanter Untersuchungsgegenstand, denn „durch die institutionelle und personelle Verschränkung beeinflussen sich Politik und Medien gegenseitig. Am sichtbarsten ist diese Verschränkung in den Rundfunkgremien […].“ Das Bild der Rundfunkgremien ist in der Öffentlichkeit dabei nicht das Beste. Norbert Schneider, Leiter der Landesmedienanstalt NRW erkennt sogar einen schleichenden Prozess der politischen Einflussnahme: „Die faktischen Besitzer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wurden nach und nach die politischen Parteien. Sie nahmen sich, was die Gesellschaft liegen ließ und füllten insofern nur ein Machtvakuum aus. Doch sie nutzten diesen Einfluss immer entschlossener zur Stützung ihrer eigenen politischen Macht. Längst geht nichts mehr ohne sie oder gegen sie.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Gebot der Staatsfreiheit
- Theoretische Überlegungen und Entstehung
- Gesetzliche Regelungen
- Bundesebene
- Länderebene
- EU-Recht
- Rechtsprechung durch das Bundesverfassungsgericht
- Die Aufsicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
- Interne Aufsicht
- Rundfunkrat
- Verwaltungsrat
- Intendant
- Externe Aufsicht
- Rechtsaufsicht durch die Staatskanzleien der Landesregierungen
- Kommission zur Ermittelung des Finanzbedarfs (KEF)
- Landesrechnungshöfe
- Die aktuelle Zusammensetzung der Rundfunkräte, des Deutschlandradio-Hörfunkrats und des ZDF-Fernsehrats
- Interne Aufsicht
- Transparenz und Professionalisierung: Die ARD-Gremiendebatte(n)
- Die Forderung nach mehr Transparenz
- Die Forderung nach Professionalisierung der Gremien
- Analyse der Problemstellung am Beispiel des neuen Radio Bremen-Gesetzes
- Radio Bremen und die Ausgangssituation
- Der Weg des Gesetzes
- Die wesentlichen Änderungen des neuen Radio Bremen-Gesetzes
- Grundsätzliches
- Die interne Kontrolle
- Aufgaben und Arbeitsweise des Rundfunkrats
- Zusammensetzung des Rundfunkrats
- Transparenz und Professionalisierung des Rundfunkrats
- Verwaltungsrat und Intendant
- Die externe Kontrolle
- Die Besetzung des neuen Rundfunkrats
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Staatsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk anhand des Radio Bremen-Gesetzes. Ziel ist es, zu analysieren, inwieweit die Aufsichtsgremien des Rundfunks das grundgesetzliche Gebot der Staatsfreiheit erfüllen.
- Das grundgesetzliche Gebot der Staatsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk
- Die Aufsichtsstrukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (interne und externe Aufsicht)
- Die Rolle der Politik in den Rundfunkgremien
- Transparenz und Professionalisierung der Rundfunkgremien
- Analyse des neuen Radio Bremen-Gesetzes im Hinblick auf die Staatsfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Staatsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein und erläutert die Bedeutung der Unabhängigkeit von staatlichen Einflüssen. Kapitel 2 behandelt das Gebot der Staatsfreiheit auf theoretischer, gesetzlicher und juristischer Ebene. Kapitel 3 beschreibt die internen und externen Aufsichtsstrukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Kapitel 4 diskutiert die Debatten um Transparenz und Professionalisierung der ARD-Gremien. Kapitel 5 analysiert die Ausgangssituation von Radio Bremen, den Gesetzgebungsprozess und die wesentlichen Änderungen des neuen Radio Bremen-Gesetzes, insbesondere im Hinblick auf die Zusammensetzung und die Aufgaben des Rundfunkrats.
Schlüsselwörter
Staatsfreiheit, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Radio Bremen-Gesetz, Aufsichtsgremien, Rundfunkrat, Transparenz, Professionalisierung, politische Einflussnahme, Medienrecht, Bundesverfassungsgericht.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Staatsfreiheit im Rundfunk?
Es ist das Gebot, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unabhängig von staatlicher Einflussnahme agieren muss, um Glaubwürdigkeit und demokratische Legitimation zu wahren.
Welche Gremien beaufsichtigen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Die interne Aufsicht erfolgt durch den Rundfunkrat und den Verwaltungsrat; die externe Aufsicht u.a. durch die KEF und Landesrechnungshöfe.
Was wird am Radio Bremen-Gesetz beispielhaft untersucht?
Die Arbeit analysiert die Zusammensetzung des Rundfunkrats und inwieweit das neue Gesetz die Staatsferne und Transparenz verbessert.
Gibt es Kritik an der politischen Besetzung der Rundfunkräte?
Ja, es wird diskutiert, ob Parteien über die Gremien zu viel Einfluss auf den Rundfunk ausüben und damit die Staatsfreiheit gefährden.
Welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht?
Das Gericht hat durch wegweisende Urteile die Standards für die Staatsferne und die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien maßgeblich geprägt.
- Quote paper
- Jannis Frech (Author), 2008, Die Staatsfreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Beispiel des Radio Bremen-Gesetzes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121721