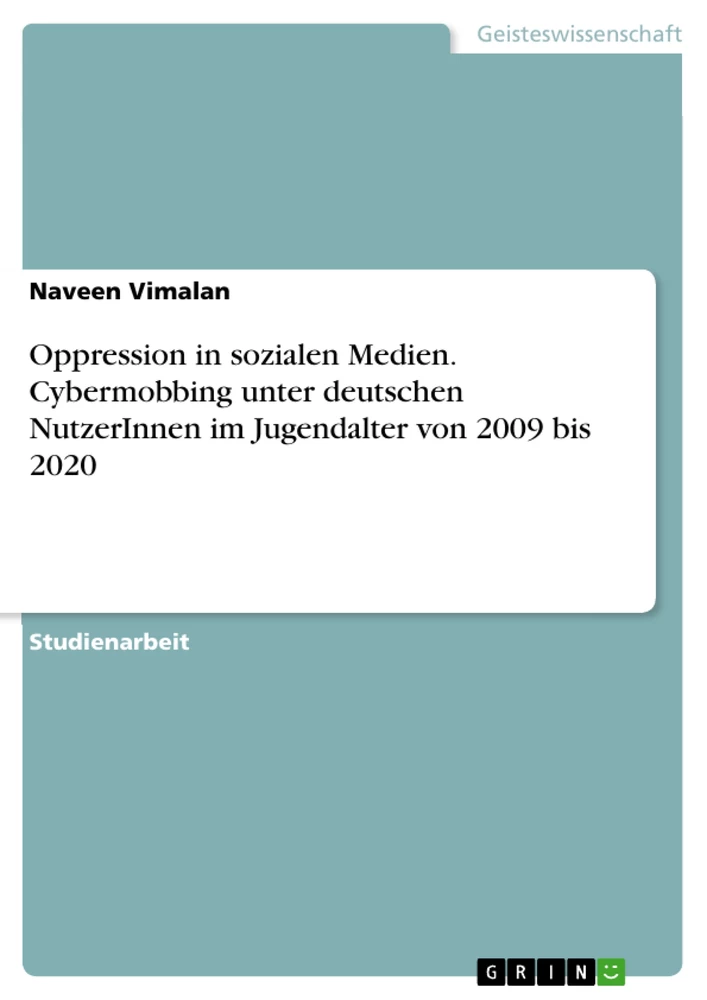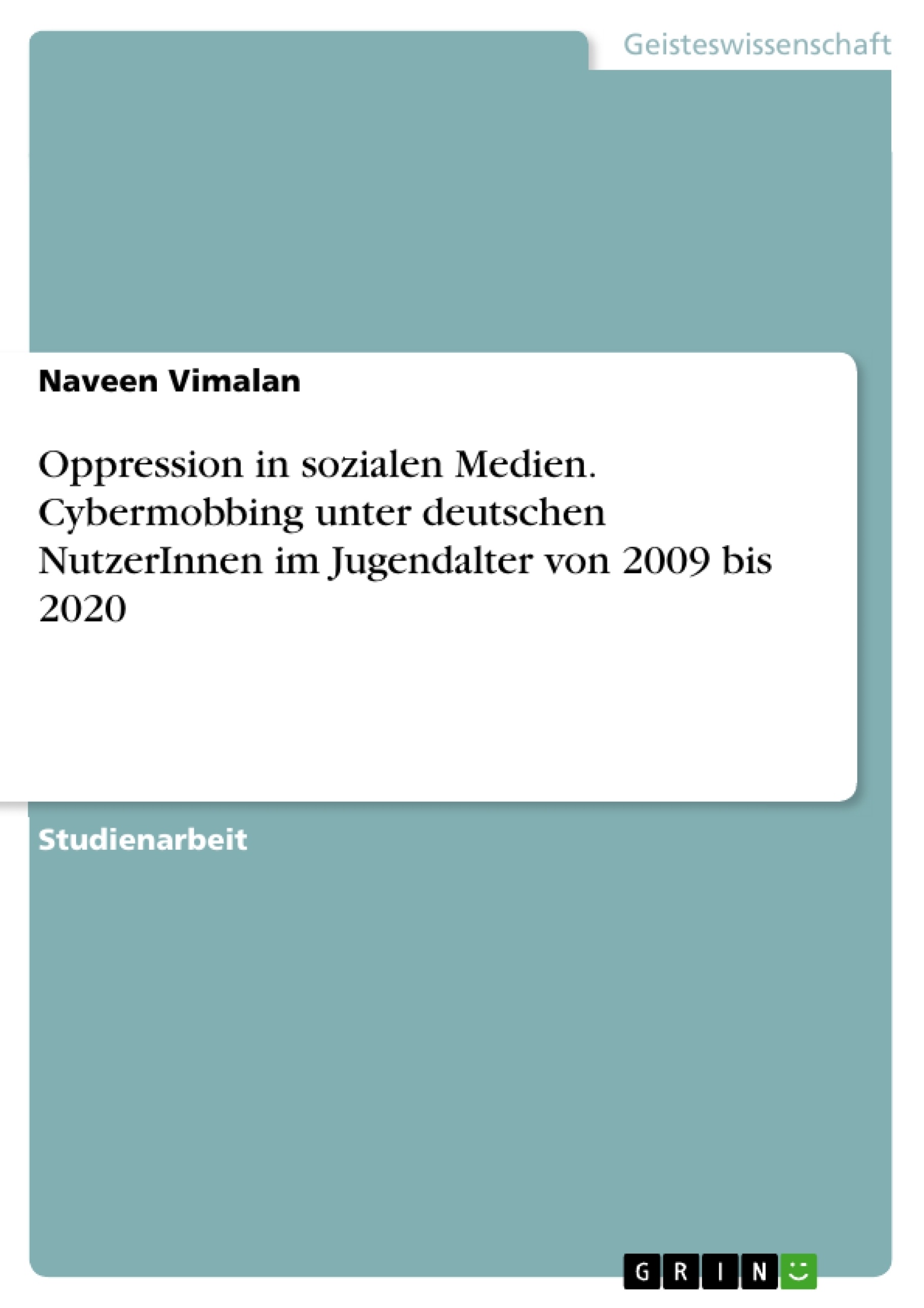Die vorliegende Hausarbeit wird sich mit sozialen Medien hinsichtlich Cybermobbing und dem sozialen Handeln auseinandersetzen. Der Fokus soll dabei auf der Plattform Facebook liegen. Geleitet wird die Hausarbeit durch die Frage welchen Einfluss Cybermobbing auf die psychische Gesundheit der deutschen Social-Media-NutzerInnen im Jugendalter von 2009 bis 2020 hatte.
Binnen der letzten zwei Jahrzehnten hat sich unsere Kommunikationsweise aufgrund der Nutzung sogenannter „sozialen Medien“ elementar verändert. Ob Facebook, WhatsApp oder Twitter – die soziale Interaktion und Kommunikation in sozialen Medien scheint für die Jugend heutzutage banal zu sein. Doch die Flucht in virtuelle Welten birgt neben ihren Chancen und Potentialen auch Gefahren. Hierzu gehört das vielschichtige Phänomen Cybermobbing. Grundlegend für die Suche nach einem Hausarbeitsthema im Rahmen des Seminars „Werkzeuge der Emanzipation oder Unterdrückung? Soziale Medien und Gesellschaft in der Gegenwart“ waren Überlegungen zum Einfluss von sozialen Medien auf die psychische Gesundheit, die reale Welt und das soziale Handeln der Jugendlichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Soziale Medien und Adoleszenz..
- 2.1 Begriffserklärung, Entstehung und Gattungen........
- 2.2 Nutzung sozialer Medien und ihre Folgen.........
- 3. Das soziale Handeln nach Max Weber
- 3.1 Definition: Soziales Handeln und soziale Beziehung.
- 3.2 Soziales Handeln in sozialen Medien
- 4. Cybermobbing in sozialen Medien..
- 4.1 Begriffserklärung, Entstehung und Merkmale..
- 4.2 Ursachen und Auswirkungen
- 5. Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss von Cybermobbing auf die psychische Gesundheit deutscher Social-Media-NutzerInnen im Jugendalter von 2009 bis 2020. Der Fokus liegt dabei auf der Plattform Facebook. Die Arbeit analysiert die Entwicklung und die Folgen der Nutzung sozialer Medien, insbesondere im Hinblick auf das soziale Handeln und die Gefahren des Cybermobbings.
- Soziale Medien im Kontext der Adoleszenz
- Das soziale Handeln nach Max Weber
- Cybermobbing in sozialen Medien
- Einfluss von Cybermobbing auf die psychische Gesundheit
- Analyse von Facebook als Plattform für Cybermobbing
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung sozialer Medien im Alltag, insbesondere für Jugendliche. Sie beschreibt die Relevanz des Themas Cybermobbing und erklärt die methodische Vorgehensweise der Hausarbeit. Der Fokus liegt auf der Analyse des Einflusses von Cybermobbing auf die psychische Gesundheit deutscher Social-Media-NutzerInnen im Jugendalter.
2. Soziale Medien und Adoleszenz
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Begriff, der Entstehung und den verschiedenen Gattungen sozialer Medien. Es wird die Bedeutung von sozialen Medien für Jugendliche und deren Rolle in der Kommunikation und Vernetzung beleuchtet.
3. Das soziale Handeln nach Max Weber
Kapitel 3 erläutert das Konzept des sozialen Handelns nach Max Weber und stellt die Bedeutung von sozialen Beziehungen in diesem Kontext dar. Es untersucht, wie sich das soziale Handeln in sozialen Medien manifestiert.
4. Cybermobbing in sozialen Medien
Kapitel 4 definiert Cybermobbing, beschreibt seine Entstehungsgeschichte und charakteristische Merkmale. Es analysiert die Ursachen und Auswirkungen von Cybermobbing, insbesondere auf die psychische Gesundheit von NutzerInnen.
Schlüsselwörter
Soziale Medien, Adoleszenz, Cybermobbing, psychische Gesundheit, Facebook, soziales Handeln, Max Weber, digitale Medien, Kommunikation, Vernetzung, Online-Mobbing, Internet, Web 2.0, virtuelle Identität, Nutzerverhalten, Empirische Forschung, statistische Auswertung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Cybermobbing?
Cybermobbing ist das absichtliche Beleidigen, Bedrohen oder Bloßstellen von Personen über digitale Kommunikationsmittel wie soziale Medien oder Messenger-Dienste.
Welche Auswirkungen hat Cybermobbing auf die psychische Gesundheit?
Betroffene leiden häufig unter Angstzuständen, Depressionen, Einsamkeit, Leistungsabfall in der Schule und im schlimmsten Fall unter Suizidgedanken.
Wie unterscheidet sich Cybermobbing von traditionellem Mobbing?
Cybermobbing ist rund um die Uhr möglich, erreicht ein riesiges Publikum und die Täter können anonym agieren, was die psychische Belastung für die Opfer erhöht.
Was versteht Max Weber unter "sozialem Handeln" im Internet?
Soziales Handeln ist ein Verhalten, das auf das Verhalten anderer bezogen ist. In sozialen Medien findet dies durch Likes, Kommentare und Interaktionen statt, die reale soziale Beziehungen beeinflussen.
Warum ist Facebook ein Fokus für Cybermobbing-Studien?
Als eines der ersten großen sozialen Netzwerke bot Facebook durch seine Struktur (Profile, Pinnwände) vielfältige Möglichkeiten für öffentliche Bloßstellungen und soziale Ausgrenzung.
- Quote paper
- Naveen Vimalan (Author), 2021, Oppression in sozialen Medien. Cybermobbing unter deutschen NutzerInnen im Jugendalter von 2009 bis 2020, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1217474