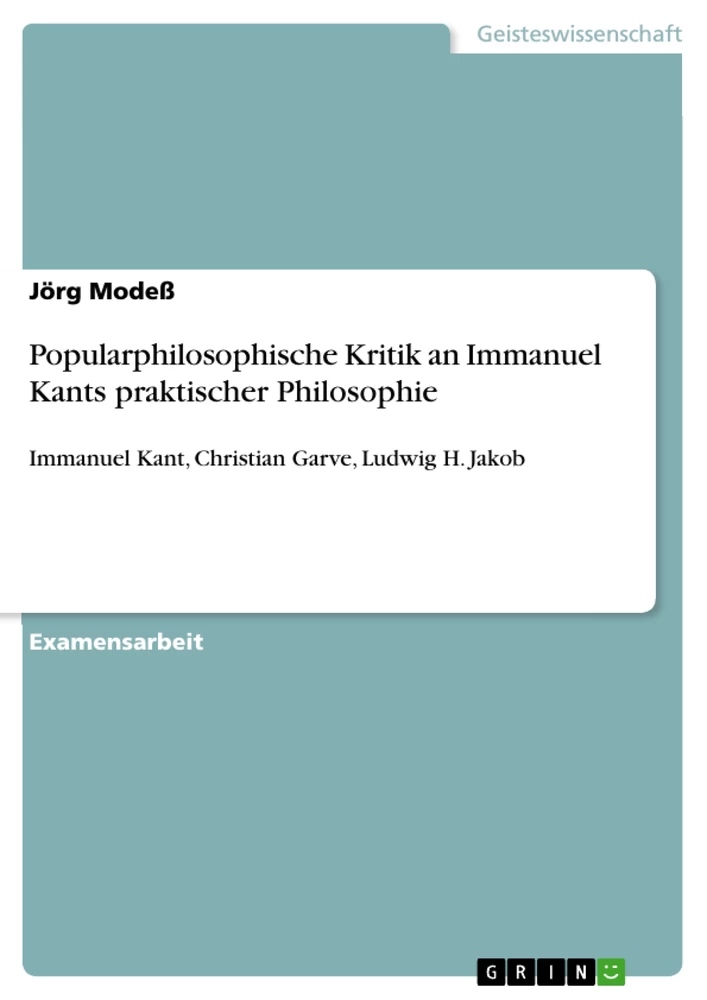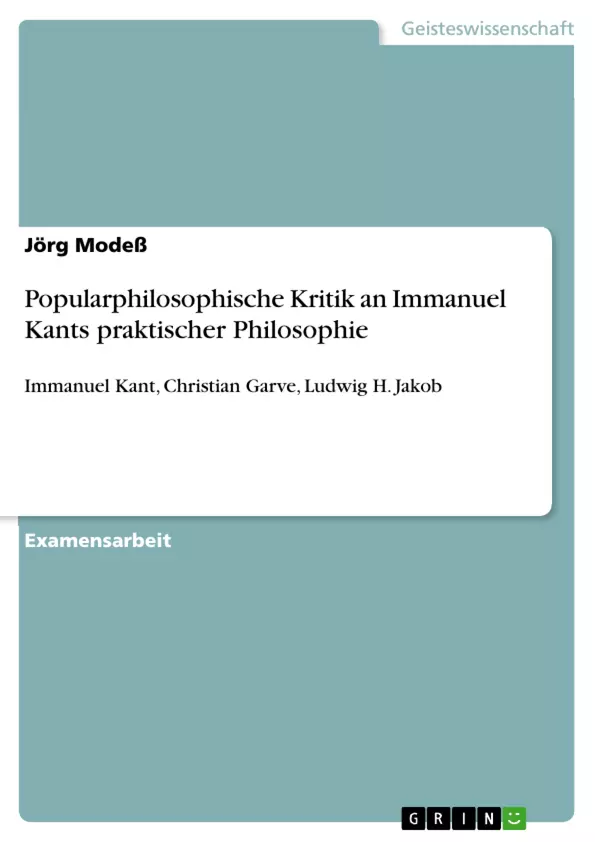„Denn in der Tat muss jede philosophische Schrift der Popularität fähig sein, sonst verbirgt sie in einem Dunst von scheinbarem Scharfsinn vermutlich Unsinn.“ (Immanuel Kant) „Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig.“ (Ludwig Wittgenstein)
„Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit“. Mit diesen Worten hat Friedrich Nietzsche 1889 am Ende seines geistigen Schaffens und kurz vor seinem Zusammenbruch in Turin sich und seine Rolle in der Philosophie versucht zu charakterisieren. Auf Kant scheint mir dieser Satz in zweierlei Weise zuzutreffen.
Zum einen hat er gezeigt, dass die Denker, die vorgaben, uns Gold von ihren Reisen in eine Welt jenseits der Erfahrung mitzubringen, in Wirklichkeit Katzengold in ihren Händen hielten. Die Theologica rationalis ist mit Kant zu ihrem Ende gekommen; das vermeintliche Wissen über Gott wurde wieder zu einem Glauben an Gott.
Zum anderen jedoch fiel seinem Denken auch eine Form des Philosophierens zum Opfer, die Kant selbst nicht nur außerordentlich schätzte, sondern für notwendig hielt, wenn die Philosophie nicht zu einem Glasperlenspiel verkommen soll. Jeder Gedanke müsse der Popularität fähig sein, ist er es nicht, so könnte sich hinter einem schönen Wortgeklingel Unsinn verbergen. Kant war der Ansicht, dass es eine Arbeitsteilung zwischen einer universitären Philosophie geben könne und einer Publizistik, die dieses Denken in eine Sprache kleidet, die von interessierten Laien verstanden werden kann. Es könnte sein, dass es gerade diese Arbeitsteilung war, die das Ende der Popularphilosophie des 18. Jahrhunderts besiegelte. Denn beide Seiten müssen die Verständlichkeit – und nichts anderes verbirgt sich hinter dem Terminus „populär“ – als wichtiges Ziel vor Augen haben.
Ist dies nicht der Fall, wird hingegen der Popularität nur Geringschätzung entgegengebracht, dann führt diese Haltung genauso zur Unmöglichkeit einer sinnvollen Popularphilosophie wie die Unfähigkeit, das Denken Kants - oder allgemeiner - das der universitären Philosophie zu verstehen. Ideal wäre daher ein Denken, das sich bei all seiner Komplexität die Verständlichkeit stets zur Verpflichtung macht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Ethik Christian Garves
- Der Begriff der Tugend
- Der Begriff der Pflicht
- Garves Kritik an Kants praktischer Philosophie
- Kants Urteil über Garve
- Ein unglücklicher Beginn in Göttingen
- Die Übersicht der vornehmsten Prinzipien der Sittenlehre
- Die Autonomie des Willens
- Der Kategorische Imperativ in Konfrontation mit der Goldenen Regel
- Garves Kritik an dem Begriff der reinen praktischen Vernunft
- Staatsphilosophie
- Nie wieder Krieg – Utopie oder politisches Programm
- Die Diskussion um ein Recht auf Widerstand gegen staatlichen Zwang
- Kants Stellungnahme zum Widerstandsrecht
- Garves Kritik an Kants Widerstandsverbot
- Ludwig Reinhold von Jakob als Kantianer gegen Kant
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit einer populärphilosophischen Strömung des 18. Jahrhunderts, die zentrale Überlegungen Immanuel Kants kritisierte. Sie untersucht die Kritik von Christian Garve, einem prominenten Vertreter der Popularphilosophie, an Kants praktischer Philosophie und beleuchtet die Frage, ob diese Kritik gerechtfertigt ist. Neben Garves Kritik werden auch andere Denker der Popularphilosophie, wie Gellert, Engel, Nicolai, Biester, Moses Mendelssohn, Feder und Manso, in den Blick genommen. Der Fokus liegt auf dem Verhältnis zwischen Popularphilosophie und Kantischem Kritizismus, sowie auf der Frage, warum dieser Ansatz philosophischer Publizistik nach dem Aufkommen des Kantischen Kritizismus an Einfluss verlor.
- Popularphilosophie des 18. Jahrhunderts
- Kritik an Kants praktischer Philosophie
- Die Rolle von Christian Garve als Vertreter der Popularphilosophie
- Das Verhältnis zwischen Popularphilosophie und Kantischem Kritizismus
- Der Niedergang der Popularphilosophie nach dem Aufkommen des Kantischen Kritizismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Leser in die Thematik der Popularphilosophie des 18. Jahrhunderts ein und skizziert die zentrale Kritik an Immanuel Kants philosophischer Position. Das zweite Kapitel widmet sich der Ethik von Christian Garve, einem wichtigen Vertreter der Popularphilosophie, und analysiert seine Definitionen von Tugend und Pflicht. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf Garves Kritik an Kants praktischer Philosophie, einschließlich der Auseinandersetzung mit dem Kategorischen Imperativ und Garves Verständnis von reiner praktischer Vernunft. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Staatsphilosophie im Kontext der Popularphilosophie, analysiert die Debatte um das Recht auf Widerstand gegen staatlichen Zwang und beleuchtet Kants und Garves Positionen in dieser Frage. Das fünfte Kapitel bietet eine Schlussbetrachtung, die die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammenfasst und die Bedeutung der Popularphilosophie für das philosophische Denken des 18. Jahrhunderts herausstellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten wie Popularphilosophie, Kantischer Kritizismus, praktische Philosophie, Ethik, Tugend, Pflicht, Kategorischer Imperativ, reine praktische Vernunft, Staatsphilosophie, Recht auf Widerstand, Glückseligkeit, Eudämonismus, und die Philosophen Immanuel Kant, Christian Garve, Karl Leonhard Reinhold, Johann August Ernesti, Johann Caspar Hirzel, Gellert, Engel, Nicolai, Biester, Moses Mendelssohn, Feder, Manso und Christian Wolff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Kritik der Popularphilosophie des 18. Jahrhunderts, insbesondere durch Christian Garve, an der praktischen Philosophie von Immanuel Kant.
Wer war Christian Garve?
Christian Garve war ein bedeutender Vertreter der Popularphilosophie, der Kants Ansätze zur Ethik und zum Kategorischen Imperativ kritisch hinterfragte.
Was versteht man unter Popularphilosophie im 18. Jahrhundert?
Es handelt sich um eine philosophische Strömung, die den Anspruch hatte, komplexe universitäre Gedanken in eine für Laien verständliche Sprache zu übersetzen.
Welche Kritikpunkte äußerte Garve an Kants Ethik?
Garve kritisierte unter anderem Kants Begriff der reinen praktischen Vernunft, die Autonomie des Willens und stellte den Kategorischen Imperativ der Goldenen Regel gegenüber.
Wird in der Arbeit auch die Staatsphilosophie behandelt?
Ja, ein Kapitel befasst sich mit der Debatte um das Recht auf Widerstand gegen staatlichen Zwang und vergleicht die Positionen von Kant und Garve.
Warum verlor die Popularphilosophie nach Kant an Bedeutung?
Die Arbeit geht der Frage nach, ob die zunehmende Komplexität des Kantischen Kritizismus und die Geringschätzung der Verständlichkeit das Ende dieser Publizistik besiegelten.
- Arbeit zitieren
- Jörg Modeß (Autor:in), 1994, Popularphilosophische Kritik an Immanuel Kants praktischer Philosophie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1217793