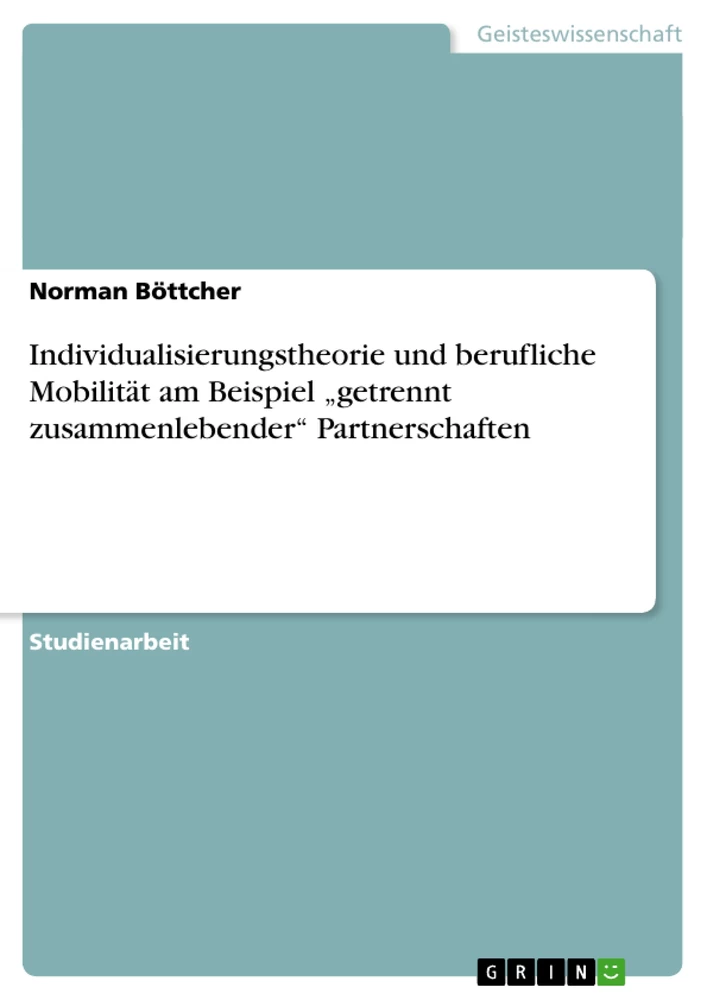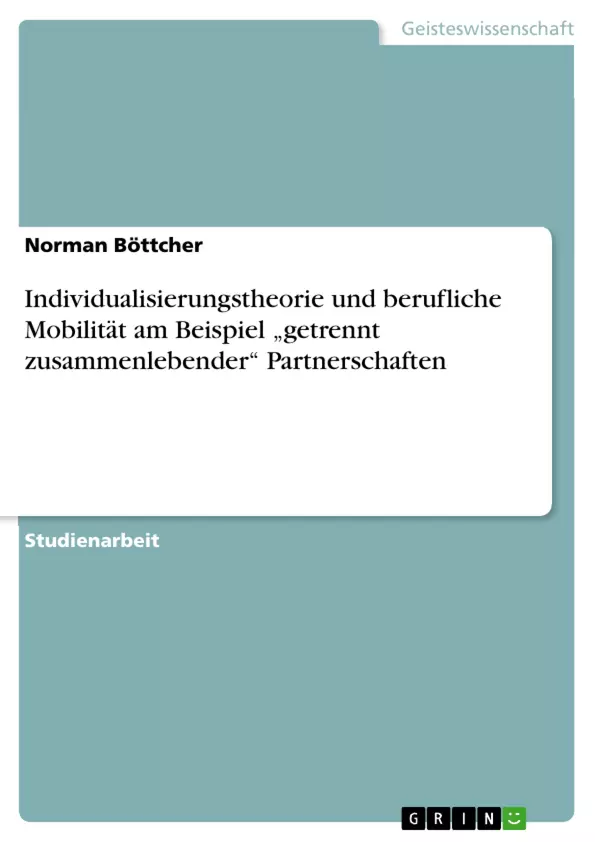Unter Berücksichtigung der veränderten beruflichen Erwerbsmöglichkeiten und der daraus resultierend ansteigenden Zahl grenzüberschreitend und nomadisch arbeitender, also berufsmobiler Menschen, sollen hier die Lebensverhältnisse dieser gesellschaftlichen Gruppe aus individualisierungstheoretischer Perspektive in Betracht genommen werden. […]
[Wie] steht es um das Relikt des monotonen Arbeitsplatzes in der Nähe des festen Wohnorts? Sehnen sich nicht sehr viele, wenn nicht der überwiegende Teil der Bevölkerung, nach einem festen Beschäftigungsverhältnis in einem möglichst großen Betrieb […] ? Aus aktuellen Geschehnissen […] lässt sich jedoch immer häufiger auf andere Veränderungen schließen. Es prophezeit sich ein ganz anderes Bild fernab von beruflicher Sicherheit. Diese Wandlungsprozesse machen sich vermehrt Personen zu Eigen, die der Sicherheit im Sinne von Sesshaftigkeit, von materiellem Reichtum und von beengenden Statussymbolen abgeschworen haben, um ihren Lebensweg anders zu definieren. […] Somit bleibt die Erkundung von stabilen Verhältnissen und partnerschaftlichen Beziehungen im Fokus dieser scheinbar völlig eigenständigen Persönlichkeiten.
Neben der Analyse des gesellschaftlichen Wandels und der daraus resultierenden beruflichen Mobilität dieser Personenkreise soll daher ebenso der Schwerpunkt auf ihre zwischenmenschlichen und partnerschaftlichen Beziehungen gelegt werden. Das Hauptaugenmerk fixiert sich auf diese in der Familiensoziologie als „getrennt Zusammenlebende“ (LAT´s - „living apart together“) bezeichneten Partnerschaften (Peuckert, 2008: 78), da bei Singles seltener ein Konflikt vorliegt, der mit dem lokalen Haftenbleiben in einer Region oder an einer Person verbunden wird. […]
Gemäß dieser Betrachtungsweise stellen sich unter anderem Fragen, wie:
„Welche Folgen hat die Individualisierungstheorie auf die Pluralisierung der Familienformen?“, „Was genau sind die Gründe und die Auswirkungen von Berufsmobilität?“ […]
Unter diesen Fragestellungen werden nach der Einleitung im Kapitel 2 die Individualisierungstheorie der Gesellschaft und die berufliche Mobilität als mögliche Rahmenbedingungen von „getrennt zusammenlebenden Partnerschaften“ beschrieben. Desweiteren wird im Kapitel 3 auf dieses Familienmodell genauer Bezug genommen. Darauf folgend wird die Lebens- und Arbeitswelt dieser mobilen und „berufsnomadisch“ lebenden Menschen im vierten Kapitel analysiert, wonach abschließend im Schlusskapitel ein kritisches Resümee erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Individualisierung und Berufsmobilität
- Definition von Individualisierung – die Individualisierungsthese
- Gesellschaft im Wandel – eine Individualisierungstendenz
- Individualisierung anhand der „Pluralisierung von Lebensformen“
- Kritik der Pluralisierungsthese am Beispiel von Rosemarie Nave-Herz
- Definition: Berufliche Mobilität
- Gründe für die zunehmende Zahl beruflich mobiler Menschen
- Persönliche Voraussetzungen für eine mobile Arbeitsweise
- Die Beziehungsform „Getrenntes Zusammenleben“ aufgrund Beruflicher Mobilität
- Fazit: Berufliche Mobilität
- Berufsmobile Partnerschaftsbeziehungen am Beispiel von „Getrennt Zusammenlebenden“
- Begriffsbestimmung
- Konstellationsmöglichkeiten
- Merkmale dieses Beziehungstypus
- Zur Feststellung dieser Zugänge
- Der Personenkreis / Sozialforschung
- Vor- und Nachteile
- Fazit: „getrennt zusammenlebende“ Partnerbeziehungen
- Lebens- und Arbeitswelt von ,,Getrennt Zusammenlebenden“
- Verständnis von Arbeitswelt
- Auswirkungen dieser beruflichen Veränderungen auf die Partnerschaft
- Konflikte in der Vereinbarkeit von Beziehung und Beruf
- Fazit: Arbeitswelt von mobilen „Getrennt Zusammenlebenden“
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Lebensverhältnisse beruflich mobiler Menschen aus individualisierungstheoretischer Perspektive, insbesondere im Kontext von „getrennt zusammenlebenden“ Partnerschaften (LATs). Die Arbeit analysiert den Wandel von traditionellen Erwerbsmodellen und die Auswirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen.
- Der Einfluss der Individualisierungstheorie auf die Pluralisierung von Lebens- und Familienformen.
- Die Ursachen und Folgen beruflicher Mobilität.
- Die Auswirkungen beruflicher Mobilität auf familiäre Beziehungen und soziale Netzwerke.
- Die Vereinbarkeit von „klassischen“ Familienstrukturen mit beruflicher Mobilität.
- Die Lebens- und Arbeitswelt von „getrennt zusammenlebenden“ Paaren.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfragen vor. Kapitel 2 definiert Individualisierung und berufliche Mobilität, beleuchtet gesellschaftliche Veränderungen und diskutiert die Gründe für zunehmende berufliche Mobilität. Kapitel 3 beschreibt das Familienmodell „getrennt zusammenlebender“ Partnerschaften, analysiert dessen Merkmale und beleuchtet Vor- und Nachteile. Kapitel 4 untersucht die Lebens- und Arbeitswelt dieser Personen und die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Beruf und Partnerschaft.
Schlüsselwörter
Individualisierungstheorie, Berufsmobilität, „Getrennt Zusammenlebende“ (LATs), Pluralisierung von Lebensformen, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, gesellschaftlicher Wandel, Familiensoziologie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Living Apart Together" (LAT)?
LAT bezeichnet Paarbeziehungen, bei denen die Partner getrennt voneinander wohnen, aber dennoch eine feste Partnerschaft führen („getrennt zusammenlebend“).
Wie beeinflusst die Individualisierungstheorie unsere Lebensformen?
Sie führt zu einer Pluralisierung von Lebensformen, weg von traditionellen Modellen hin zu individuelleren und flexibleren Beziehungs- und Familienstrukturen.
Welche Ursachen hat die zunehmende Berufsmobilität?
Gründe sind veränderte Erwerbsmöglichkeiten, der Zwang zu räumlicher Flexibilität sowie der Wunsch nach beruflicher Selbstverwirklichung fernab des Wohnorts.
Was sind die Nachteile von berufsmobilen Partnerschaften?
Herausforderungen liegen vor allem in der Vereinbarkeit von Beruf und Beziehung sowie in möglichen Konflikten durch die räumliche Distanz.
Wer ist Rosemarie Nave-Herz im Kontext dieser Arbeit?
Sie wird als Kritikerin der Pluralisierungsthese angeführt, um eine differenzierte Sicht auf den gesellschaftlichen Wandel zu ermöglichen.
- Quote paper
- Norman Böttcher (Author), 2008, Individualisierungstheorie und berufliche Mobilität am Beispiel „getrennt zusammenlebender“ Partnerschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121841