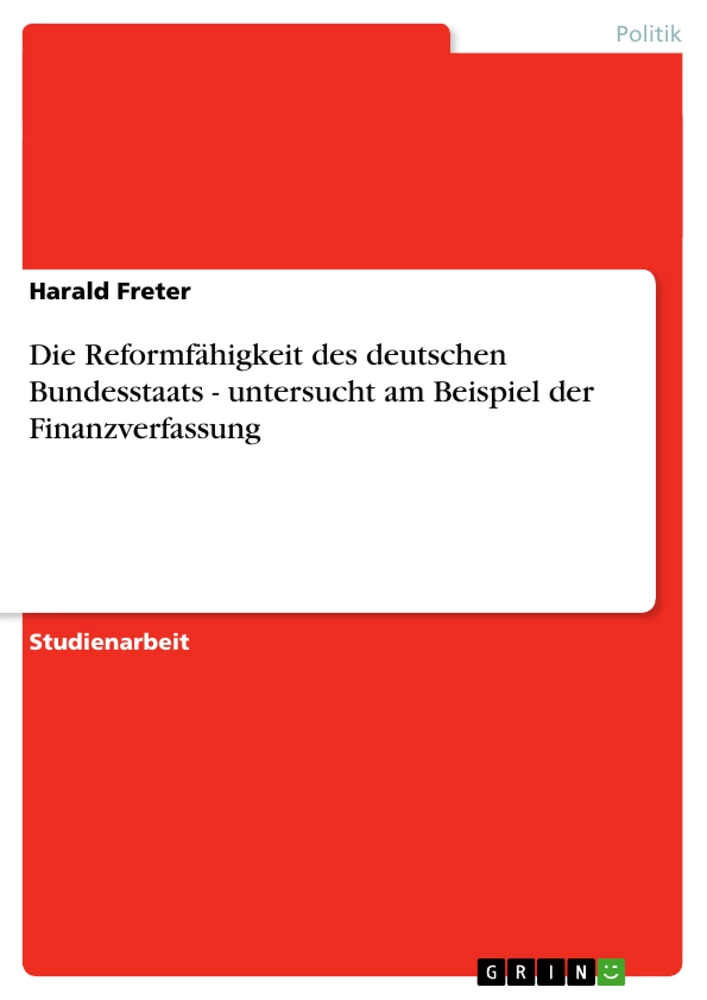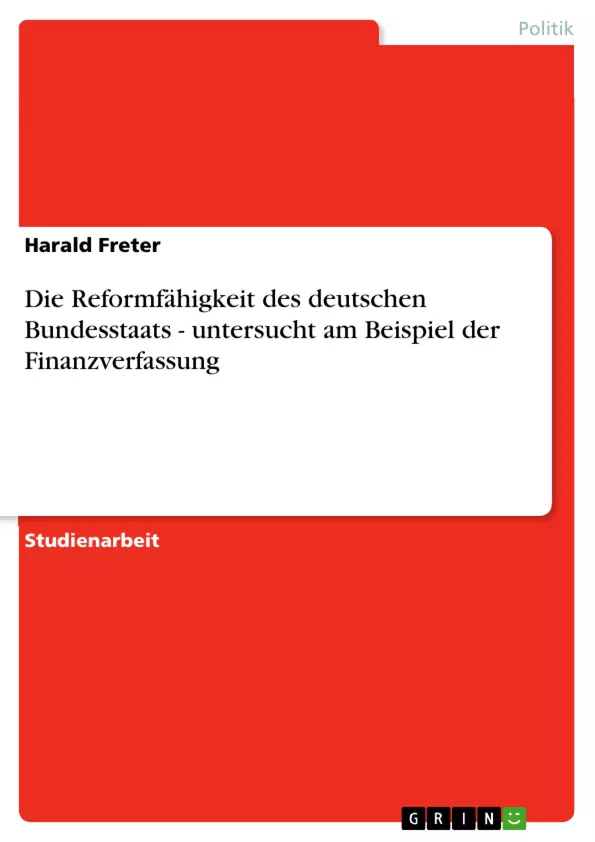In dieser Arbeit wird nach der Reformfähigkeit der Finanzverfassung als „Kernstück einer bundesstaatlichen Ordnung“ gefragt, inwieweit also der Föderalismus auf dem Gebiet des Finanzausgleichs reformierbar ist. Die maßgebliche Literatur zum bundesdeutschen Föderalismus ist sich einig darin, dass in dem auf Konsensbildung durch Aushandeln gerichteten kooperativen Föderalismus immer dann besondere Entscheidungsprobleme bestehen, wenn es um eine Umverteilung geht. Vor allem die Bewältigung der Verteilungsprobleme im Zusammenhang mit der deutschen Einheit musste daher als besonders schwieriges Problem angesehen werden.
Mit den Reformen von 1993 und 2001 hat es zwei Änderungen der Finanzverfassung gegeben, erstere zur Regelung der Integration der neuen Länder in den bundesstaatlichen Finanzausgleich, die zweite aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 1999.
Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 1999 wurde der Gesetzgeber erneut gezwungen, eine Reform des Finanzausgleichssystems vorzunehmen, die zum sogenannten Maßstäbegesetz und einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes führte. In dieser Hausarbeit soll untersucht werden, welche Möglichkeiten der Gesetzgeber bei dieser letzten Reform der Finanzverfassung hatte und welche er letztendlich nutzen konnte. Die Arbeit ist zu diesem Zweck wie folgt aufgebaut.
Zunächst wird die Bedeutung der Finanzverfassung in Bundesstaaten dargelegt und einige Grundprinzipien zusammengestellt, um anschliessend die Entwicklung der Finanzverfassung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland mit ihren Strukturprinzipien mit besonderem Blick auf die aktuell (noch bis 2004) gültige zu beschreiben.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 1999 wird hinsichtlich der Klagegründe der sogenannten „Geberländer“, der wesentlichen Elemente des Urteils selbst und der potenziellen Gestaltungsmöglichkeiten des Gesetzgebers untersucht, um dann die konkrete Reform in Gestalt eines Maßnahmengesetzes und der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes im Rahmen des Solidarpaktes II daraufhin zu untersuchen, welche tatsächlichen Ergebnisse unter den Bedingungen des bundesdeutschen Föderalismus erzielt werden konnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bedeutung und Grundprinzipien der Finanzverfassung im föderalen Staat
- 3. Entwicklung der bundesdeutschen Finanzverfassung
- 3.1 Entwicklung bis 1995
- 3.2 Darstellung des aktuellen (1995-2004) Finanzausgleichssystems
- 3.2.1 Kompetenzverteilung bei der Steuergesetzgebung
- 3.2.2 Verflechtung auf der Ausgabenseite
- 3.2.3 Verteilung der Steuererträge zwischen Bund und Ländern
- 4. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 1999
- 4.1 Klagegründe der „Geberländer“ vs. Argumentation der “Nehmerländer”
- 4.2 Elemente des Urteils
- 4.3 Bewertung / Reaktionsmöglichkeiten des Gesetzgebers
- 5. Die Reform von 2001 (gültig ab 2005)
- 5.1 Entstehungsgeschichte
- 5.2 Das Maßstäbegesetz
- 6. Bewertung/Zusammenfassende Thesen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Reformfähigkeit der deutschen Finanzverfassung, insbesondere im Hinblick auf die Reform von 2001. Sie analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Gesetzgebers bei der Anpassung des Finanzausgleichssystems vor dem Hintergrund des föderalen Systems Deutschlands.
- Bedeutung der Finanzverfassung im föderalen Staat
- Entwicklung der bundesdeutschen Finanzverfassung seit 1995
- Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1999 und seine Folgen
- Die Reform des Finanzausgleichssystems im Jahr 2001
- Herausforderungen des kooperativen Föderalismus bei der Verteilung von Aufgaben und Finanzen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik der Reformfähigkeit des deutschen Bundesstaates ein, wobei der Fokus auf der Finanzverfassung liegt. Kapitel 2 beleuchtet die Bedeutung und Grundprinzipien der Finanzverfassung im föderalen Staat. Kapitel 3 beschreibt die Entwicklung der bundesdeutschen Finanzverfassung bis zum Jahr 2004, einschließlich der Reform von 1993. Kapitel 4 analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 1999, die Klagegründe und die möglichen Reaktionen des Gesetzgebers. Kapitel 5 beschreibt die Reform von 2001 und das Maßstäbegesetz.
Schlüsselwörter
Finanzverfassung, Föderalismus, Finanzausgleich, Bundesverfassungsgericht, Reformfähigkeit, Steuergesetzgebung, Kompetenzverteilung, Bundesstaat, Kooperativer Föderalismus, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird die Finanzverfassung als „Kernstück der bundesstaatlichen Ordnung“ bezeichnet?
Weil sie regelt, wie Steuereinnahmen und Aufgaben zwischen Bund und Ländern verteilt werden, was entscheidend für die Stabilität des Föderalismus ist.
Was war der Anlass für die Reform der Finanzverfassung im Jahr 2001?
Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 11. November 1999 zwang den Gesetzgeber, das Finanzausgleichssystem transparenter und maßstabsgerechter zu gestalten.
Was versteht man unter dem „Maßstäbegesetz“?
Das Maßstäbegesetz legt die verfassungsrechtlichen Kriterien fest, nach denen der Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern berechnet werden muss.
Was ist der Unterschied zwischen „Geberländern“ und „Nehmerländern“?
Geberländer sind finanzstarke Bundesländer, die in den Ausgleichstopf einzahlen, während Nehmerländer finanzschwächere Länder sind, die Zuweisungen erhalten.
Warum ist die Reformfähigkeit im kooperativen Föderalismus oft eingeschränkt?
Da Reformen meist einen Konsens aller Beteiligten erfordern, führen Umverteilungsfragen oft zu Blockaden oder langwierigen Verhandlungsprozessen.
- Arbeit zitieren
- Dr. Harald Freter (Autor:in), 2003, Die Reformfähigkeit des deutschen Bundesstaats - untersucht am Beispiel der Finanzverfassung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121843