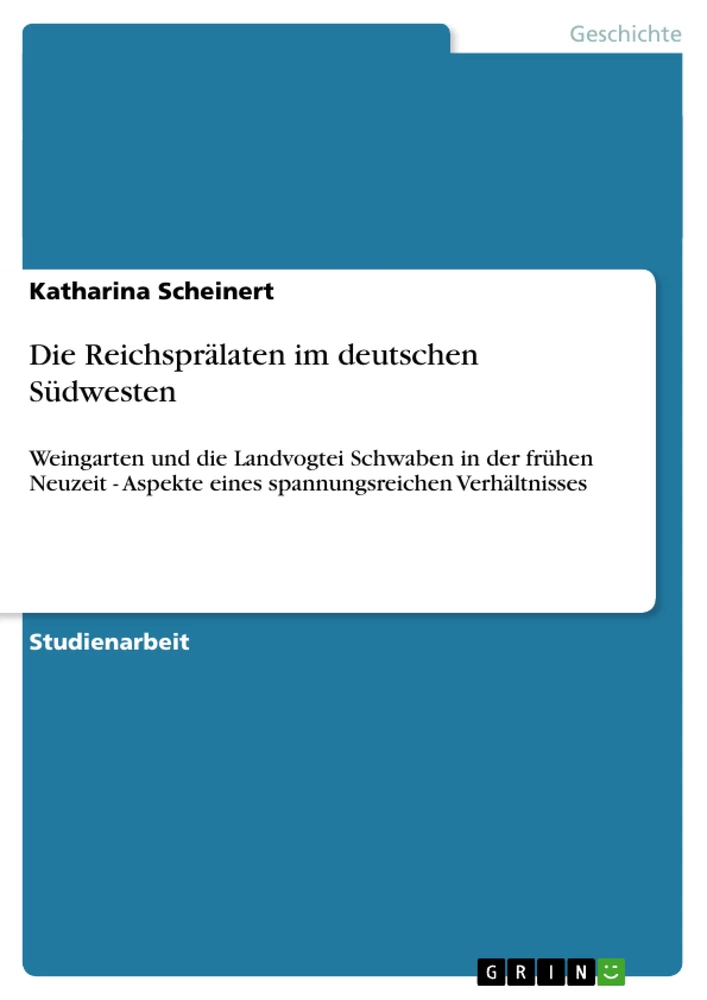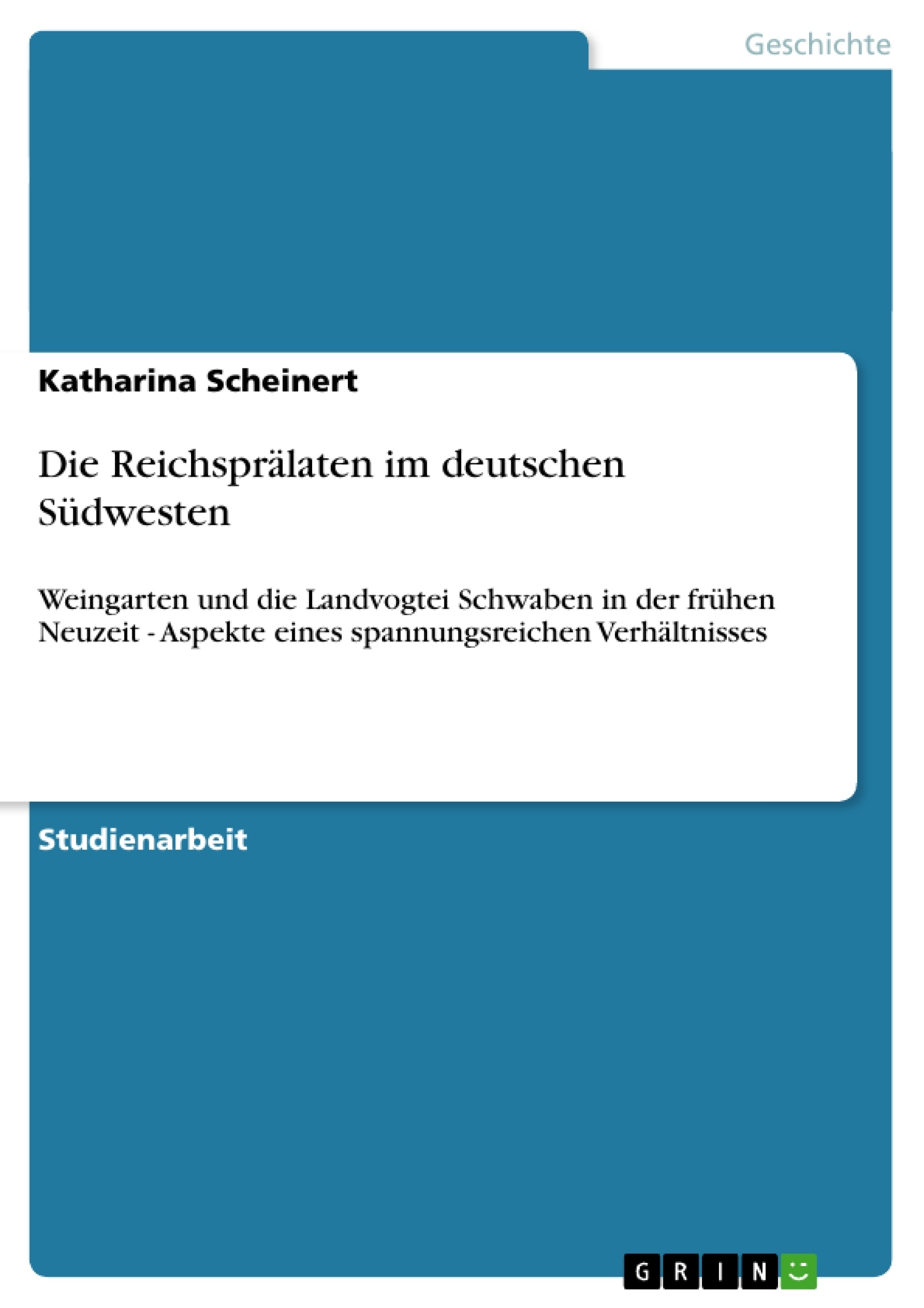In dieser Arbeit werden nicht alle geistlichen und weltlichen Territorialstaaten des deutschen Südwestens herausgearbeitet. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie in ihrer Vielzahl kaum eingrenzbar wären und das Thema somit weit über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen würde. Der Fokus wird sich deshalb nur auf die geistlichen Territorien, insbesondere auf die Reichsprälaten von Altdorf-Weingarten richten. Denn auch wo Bistümer, Klöster oder Stifte den staatlichen Grundbesitz zu ihren Ämtern und Herrschaften ausweiteten, handelt es sich durchweg um kleine Formen der Staatenbildung.
Hierbei habe ich mich hauptsächlich für die Literatur von KARL S. BADER: Der deutsche Südwesten in seiner territorialstaatlichen Entwicklung und ARMGARD VON REDEN-DOHNA: Reichsstandschaft und Klosterherrschaft sowie Zwischen Österreich Vorlanden und Reich. Die schwäbischen Reichsprälaten entschieden, um die etwas einseitige Gewichtung der verwendeten Literatur zu erklären. Diese fachwissenschaftlich historisch fundierten Texte stellen für mich den – über mehrere Jahrzehnte andauernden – Konflikt zwischen Österreich und den Schwäbischen Prälaten sehr ausführlich und übersichtlich dar. Die restliche Literatur wird lediglich für Ergänzungen herangezogen. Diese kurze, schriftliche Abhandlung soll Aufschlüsse über die damalige Weltanschauung und Kultur unserer Vorfahren geben und wird einen Zeitraum von ca. 540 Jahren umfassen.
Der Aufbau meiner Arbeit ist folgenermaßen gegliedert:
In dem Kapitel Vorgeschichte werden zunächst allgemeine Grundlagen und Begrifflichkeiten erklärt. Dies ist sinnvoll und notwendig, um spätere Sachverhalte historisch besser einordnen und verstehen zu können. Anschließend werde ich auf das Ende des Herzogtum Schwaben eingehen. Denn erst mit dem Fehlen der Herzoggewalt konnten sich, ab dem Jahre 1268, zahlreiche südwestdeutsche Kleinstaaten herausbilden. Das folgende Kapitel Reichsstände wird die reichsständischen Gruppen sowie ihre allgemeine Stimmverteilung im damaligen Reichstag darstellen. Dieses Kapitel dient als Übergang zum Hauptteil dieser Arbeit, indem die Politik der Reichsprälaten beschrieben wird. Dabei beschränke ich mich auf die Darstellung der Prälatenkollegien, gehe näher auf die klösterliche Territorienbildung und die Landvogtei Schwaben ein. Erklärungen zur Landvogtei sind unumgänglich, da an ihr die Territorialpolitik der Österreicher und der u.a. daraus resultierende Konflikt mit dem Kloster Weingarten veranschaulicht werden soll. Abschließen wird die Arbeit mit dem Zerfall und Untergang der Reichsprälaten, durch die Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1806, sowie einer allgemeinen Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorgeschichte
- 2.1 Allgemeine Grundlegungen
- 2.2 Das Ende des Herzogtums Schwaben und die Zeit der territorialen Umbildungen
- 3. Die Reichsstände
- 3.1 Die reichsständischen Gruppen
- 3.2 Die Stimmenverteilung im Reichstag
- 4. Die Reichspolitik der Prälaten
- 4.1 Prälatenkollegien
- 4.2 Klösterliche Territorienbildung
- 4.3 Die Landvogtei Schwaben
- 5. Die Territorialpolitik Vorderösterreichs
- 6. Der Widerstand der Weingartner Reichsprälaten
- 7. Zerfall und Untergang der Reichsprälaten
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Spannungsverhältnis zwischen den Reichsprälaten im deutschen Südwesten, insbesondere dem Kloster Weingarten, und der Landvogtei Schwaben in der frühen Neuzeit. Der Fokus liegt auf der Entwicklung geistlicher Territorien und deren Konflikt mit der österreichischen Territorialpolitik.
- Entwicklung geistlicher Territorien im deutschen Südwesten
- Konflikt zwischen den Reichsprälaten und der österreichischen Landvogtei Schwaben
- Klösterliche Territorienbildung und Reichspolitik
- Das Ende des Herzogtums Schwaben und die daraus resultierenden territorialen Umbildungen
- Der Widerstand der Weingartner Reichsprälaten gegen die österreichische Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema und die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Die Arbeit konzentriert sich auf die Reichsprälaten von Altdorf-Weingarten und deren Verhältnis zur Landvogtei Schwaben.
Kapitel 2 (Vorgeschichte): Klärung der Begriffe Herrschaft und Genossenschaft im mittelalterlichen Kontext. Beschreibung des Endes des Herzogtums Schwaben und der darauffolgenden Bildung südwestdeutscher Kleinstaaten.
Kapitel 3 (Die Reichsstände): Darstellung der reichsständischen Gruppen und ihrer Stimmenverteilung im Reichstag. Dies dient als Übergang zum Hauptteil der Arbeit.
Kapitel 4 (Die Reichspolitik der Prälaten): Beschreibung der Prälatenkollegien, der klösterlichen Territorienbildung und der Landvogtei Schwaben als zentraler Akteur im Konflikt.
Kapitel 5 (Die Territorialpolitik Vorderösterreichs): Analyse der österreichischen Territorialpolitik und deren Einfluss auf die Reichsprälaten.
Kapitel 6 (Der Widerstand der Weingartner Reichsprälaten): Beschreibung des Widerstandes des Klosters Weingarten gegen die österreichische Politik.
Schlüsselwörter
Reichsprälaten, Landvogtei Schwaben, Kloster Weingarten, frühe Neuzeit, Territorialpolitik, Österreich, Heiliges Römisches Reich, geistliche Territorien, Herrschaft, Genossenschaft, Kleinstaatenbildung.
- Citation du texte
- Katharina Scheinert (Auteur), 2009, Die Reichsprälaten im deutschen Südwesten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121846