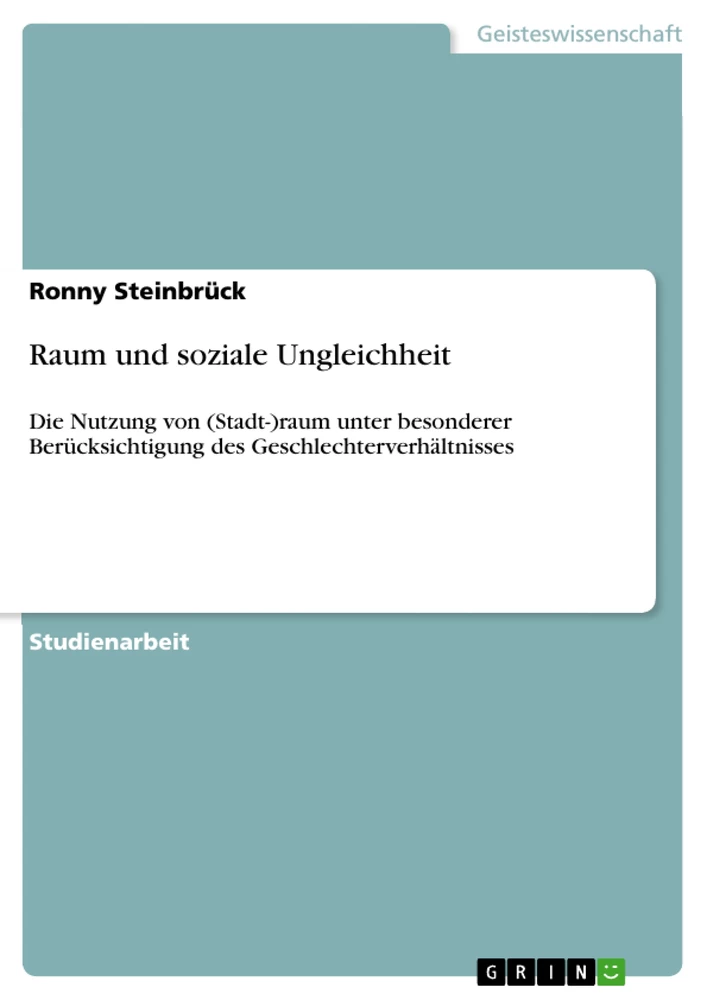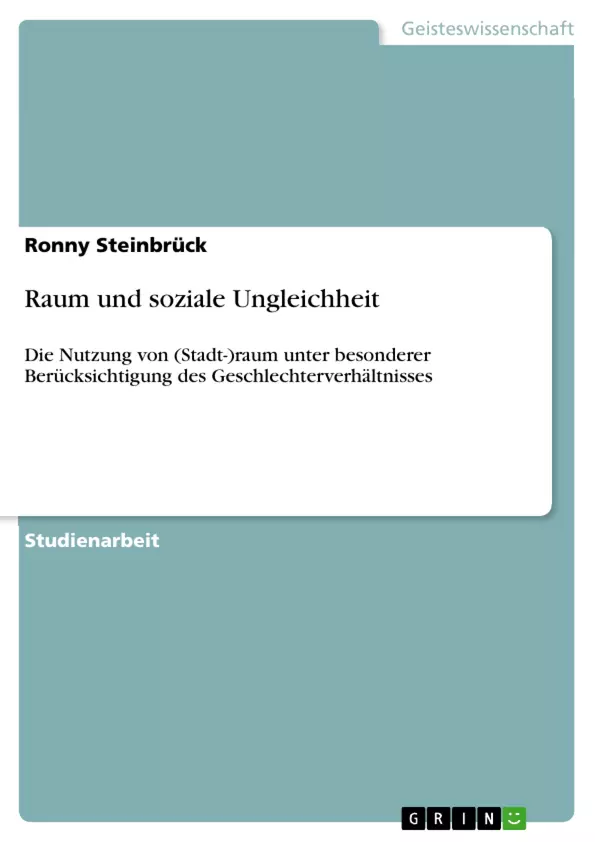Von Interesse ist der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und dem Geschlechterverhältnis in Bezug auf die Herstellung und Verfügbarkeit von Raum. Dazu soll im ersten Teil der Arbeit zunächst mit dem Begriff des Raumes eine Grundlage geschaffen werden. Dies geschieht mittels zweier Konzepte, die herausarbeiten, dass Raum sozial hergestellt ist. Im Mittelpunkt der Vertiefung stehen dabei Prozesse der Wahrnehmung, Bewertung und Synthese. Es wird sich zeigen, dass Raum relational ist, also von den Akteuren hergestellt wird, aber auch, dass er gleichzeitig die Akteure in ihrem Handeln beeinflusst. Darüber hinaus zeigen die Ausführungen eine weitere Besonderheit, nämlich die geschlechtsspezifische Konstitution und Konstruktion von Raum. Die Geschlechter erzeugen über jeweils eigene, entsprechend relevante Aspekte Raum und haben damit auch (tendenziell) verschiedene Beziehungen zu Raum. Aus dieser verschiedenen Aneignung von Raum resultieren unterschiedliche Konsequenzen für die sozialen Handlungen innerhalb der Räume. Am Beispiel des Angstraumes soll ein Fall der Aneignung öffentlicher Räume durch Frauen aufgezeigt werden. Hierzu wird es nötig sein einen kurzen Abriss der Sozialgeschichte des öffentlichen (Angst)Raumes zu geben. Anschließend folgt noch ein kurzer Abschnitt der sich dem Paradox der zu erwartenden Sicherheit widmet.
Es schließt sich der zweite Teil mit dem Kapitel über die Auseinandersetzung von Raum und sozialer Ungleichheit an, welches in diesem Zusammenhang den Begriff der Macht im Fokus haben wird. Hier werden wiederrum zwei Analysekonzepte vorgestellt um zum einen die Dimensionen sozialer Ungleichheit zu fassen und um zum anderen zu erfassen, wie Macht das Zusammenspiel von Raum und Geschlecht durchdringt. Ergänzt werden diese Ausführungen durch empirische Belege aus den Bereichen der Nutzung des öffentlichen Raumes sowie dem Berufsfeld der Architektinnen und Planerinnen, welche sich in einer exponierten Stellung befinden.
Im dritten Teil beschäftigt sich Kapitel 5 schließlich mit zwei Auswirkungen geschlechtsspezifischer Chancen der Nutzung von (Stadt)Raum anhand der Phänomene der historisch entstandenen Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit und deren geschlechtsspezifischer Zuordnung, sowie letztens des ambivalenten Prozesses der Gentrifizierung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Erarbeitung eines Konzepts von Raum
- 2.1 Einleitende Gedanken zum Begriff des „Raumes“
- 2.2 Zwei Handlungstheoretische Raumbegriffe
- 2.2.1 Spacing und Syntheseleistung
- 2.2.2 Konstitution und Konstruktion
- 2.3 Geschlechtsspezifische Herstellung von Raum
- 3. Konsequenzen der verschiedentlichen Wahrnehmung von (Stadt-)Raum für die Nutzung und Aneignung von (Stadt-)Raum
- 3.1 Sozialgeschichte des öffentlichen “(Angst-)Raumes”
- 3.2 Das Paradox der erwarteten und tatsächlichen (Un-)Sicherheit
- 4. Raum und soziale Ungleichheit
- 4.1 Analyse der (Macht-)Asymmetrie
- 4.2 Vier Dimensionen sozialer Ungleichheit
- 4.3 Vier Dimensionen der Analyse des Wirkungsgefüges Raum-Macht-Geschlecht
- 4.4 Empirische Belege für die Nutzung von Raum unter ausschließlicher Berücksichtigung der Genusgruppe Frau
- 4.4.1 Die besondere Stellung von Architektinnen und Planerinnen
- 4.4.2 Auswirkungen geschlechtsspezifischer Chancen der Nutzung von (Stadt-)Raum
- 5. Auswirkungen geschlechtsspezifischer Chancen der Nutzung von (Stadt-)Raum
- 5.1 Die Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit als geschlechtsspezifisch zugeordnete Sphären
- 5.2 Die sozialräumliche Aufwertung der innenstadtnahen Wohnviertel als Prozess mit ambivalenten Charakter
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit und dem Geschlechterverhältnis im Hinblick auf die Herstellung und Verfügbarkeit von Raum. Sie analysiert, wie Raum sozial konstruiert wird und wie diese Konstruktion geschlechtsspezifische Konsequenzen für die Nutzung und Aneignung von Raum hat. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Machtverhältnisse und ihrer Auswirkungen auf die räumliche Praxis von Frauen.
- Soziale Konstruktion von Raum
- Geschlechtsspezifische Raumaneignung
- Raum und soziale Ungleichheit
- Machtverhältnisse im Raum
- Räumliche Praxis von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und erläutert das gewählte Verständnis von Raum. Kapitel 2 entwickelt ein Konzept von Raum, das die soziale Herstellung und die geschlechtsspezifische Konstruktion von Raum betont. Kapitel 3 befasst sich mit den Konsequenzen der unterschiedlichen Wahrnehmung von Raum für Frauen, insbesondere im öffentlichen Raum, unter Berücksichtigung der Sozialgeschichte des "Angstraums" und des Paradoxons der erwarteten und tatsächlichen Sicherheit. Kapitel 4 analysiert Raum und soziale Ungleichheit, wobei Machtverhältnisse und deren Einfluss auf das Zusammenspiel von Raum und Geschlecht im Mittelpunkt stehen. Empirische Belege werden präsentiert, die sich auf die Nutzung des öffentlichen Raums durch Frauen und die Rolle von Architektinnen und Planerinnen konzentrieren. Kapitel 5 untersucht die geschlechtsspezifische Zuordnung von Privatheit und Öffentlichkeit sowie den ambivalenten Prozess der Gentrifizierung.
Schlüsselwörter
Raum, soziale Ungleichheit, Geschlechterverhältnis, Raumaneignung, Macht, öffentliche Raum, Architektur, Stadtplanung, Gentrifizierung, Angstraum.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet es, dass Raum „sozial hergestellt“ ist?
Raum ist nicht einfach nur eine physische Gegebenheit, sondern wird durch menschliches Handeln, Wahrnehmung und Bewertung konstituiert. Akteure erzeugen Räume durch ihre Anwesenheit und die Beziehungen, die sie darin knüpfen.
Inwiefern ist die Konstruktion von Raum geschlechtsspezifisch?
Männer und Frauen nehmen Räume oft unterschiedlich wahr und nutzen sie verschieden. Diese geschlechtsspezifische Aneignung führt dazu, dass Räume mit unterschiedlichen Bedeutungen und Machtverhältnissen aufgeladen werden.
Was versteht man unter einem „Angstraum“?
Ein Angstraum ist ein öffentlicher Raum, der aufgrund sozialer oder baulicher Gegebenheiten Gefühle der Unsicherheit hervorruft, insbesondere bei Frauen. Dies führt oft zu Vermeidungsstrategien und schränkt die räumliche Freiheit ein.
Welchen Einfluss hat Macht auf das Wirkungsgefüge von Raum und Geschlecht?
Machtverhältnisse bestimmen, wer Zugang zu bestimmten Räumen hat und wer diese gestalten darf. Historisch gesehen führte dies oft zu einer Trennung von privatem (weiblich zugeordnetem) und öffentlichem (männlich dominiertem) Raum.
Welche Rolle spielen Architektinnen und Planerinnen in diesem Kontext?
Architektinnen befinden sich in einer exponierten Stellung, da sie Räume aktiv gestalten können. Sie können dazu beitragen, geschlechtsspezifische Barrieren abzubauen und Städte inklusiver zu planen.
- Citar trabajo
- Ronny Steinbrück (Autor), 2008, Raum und soziale Ungleichheit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121889