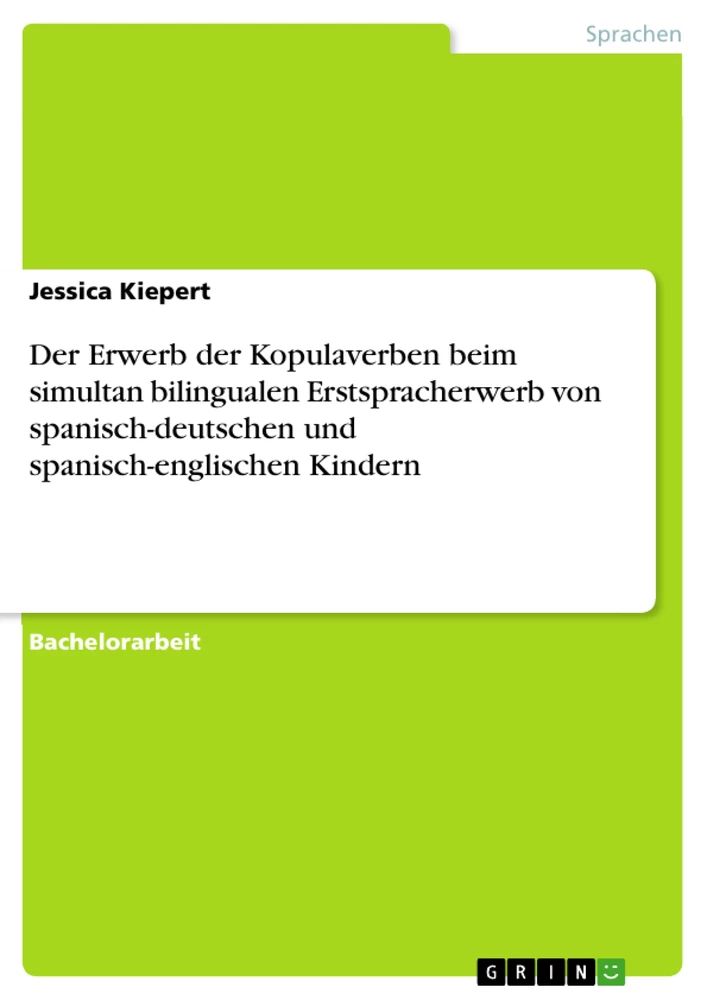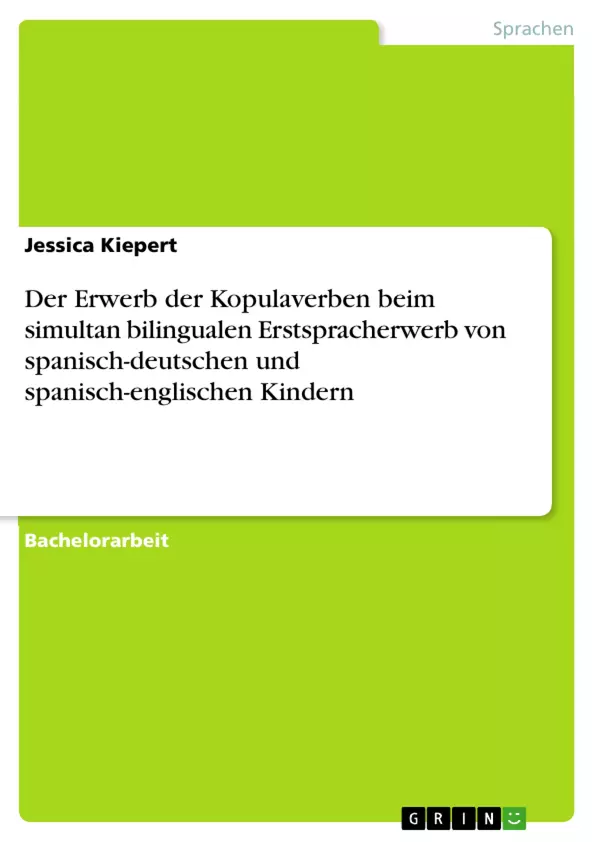Diese Arbeit wird die Thematik des Spracheneinflusses im simultan bilingualen Erstspracherwerb aufgreifen. Dabei wird sich hauptsächlich auf die Anfälligkeit eines grammatischen Phänomens als Ursache, nämlich das der Kopulaverben der Sprachen Spanisch, Deutsch und Englisch, konzentriert und analysiert, ob sich in diesem Kontext ein Spracheneinfluss nachweisen lässt. Des Weiteren soll untersucht werden, auf welche Weise sich dieser Spracheneinfluss äußert und in welche Richtung er verläuft. Konkret ließe sich die Fragestellung wie folgt formulieren:
Findet Spracheneinfluss – und wenn ja, in welcher Form – im Kontext der Kopulaverben bei den Sprachen Spanisch, Englisch und Deutsch statt?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen - Begriffsdefinitionen
- 2.1 Bilingualität/Bilinguismus: simultaner vs. sukzessiver Spracherwerb
- 2.2 Die verschiedenen Kopulasysteme
- 2.2.1 Das deutsche Kopulaverb SEIN und das englische Äquivalent BE
- 2.2.2 Die spanischen Kopulaverben SER und ESTAR
- 3. Der bilinguale L1-Erwerb
- 3.1 L1-Erwerbstheorien - der Nativismus/Generativismus
- 3.2 Die Möglichkeit des Spracheneinflusses
- 3.2.1 Definition
- 3.2.2 Manifestationen
- 3.2.3 Die Ursache für das Auftreten von Spracheneinfluss: erste Zusammenhänge mit der Sprachentrennung und Sprachdominanz
- 3.2.4 Grammatische Phänomene als Ursache für Spracheneinfluss
- 4. Forschungsarbeiten
- 5. Schlussfolgerungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Spracheneinfluss im simultan bilingualen Erstspracherwerb, insbesondere im Kontext der Kopulaverben der Sprachen Spanisch, Deutsch und Englisch. Sie befasst sich mit der Frage, ob und in welcher Form ein Spracheneinfluss im Bereich der Kopulaverben stattfindet. Die Arbeit zielt darauf ab, die möglichen Auswirkungen und Richtungen des Spracheneinflusses in diesem Kontext zu analysieren.
- Bilingualität/Bilinguismus im simultanen Erstspracherwerb
- Kopulasysteme in Spanisch, Deutsch und Englisch
- Spracheneinfluss im Erstspracherwerb
- Anfälligkeit grammatischer Phänomene für Spracheneinfluss
- Forschungsarbeiten zum Kopulaerwerb
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Spracheneinfluss im simultan bilingualen Erstspracherwerb vor und beleuchtet die Relevanz der Kopulaverben in den Sprachen Spanisch, Deutsch und Englisch. Kapitel 2.1 definiert den Begriff der Bilingualität und differenziert zwischen simultanem und sukzessivem Spracherwerb. Kapitel 2.2 stellt die verschiedenen Kopulasysteme in den drei Sprachen vor und analysiert ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Kapitel 3.1 fokussiert auf L1-Erwerbstheorien, insbesondere den nativistischen Ansatz von Chomsky. Kapitel 3.2 beleuchtet den Spracheneinfluss, definiert den Begriff, skizziert seine Manifestationen und untersucht die möglichen Zusammenhänge mit Sprachentrennung und Sprachdominanz. Kapitel 3.2.4 analysiert die Anfälligkeit grammatischer Phänomene für Spracheneinfluss anhand der Kopulaverben. Kapitel 4 präsentiert ausgewählte Forschungsarbeiten zum Kopulaerwerb, die die Vorhersagen aus Kapitel 3.2.4 verifizieren oder falsifizieren sollen.
Schlüsselwörter
Simultaner Erstspracherwerb, Bilingualität/Bilinguismus, Kopulaverben, Spracheneinfluss, Sprachentrennung, Sprachdominanz, grammatische Phänomene, Forschungsarbeiten, Spanisch, Deutsch, Englisch.
Häufig gestellte Fragen
Was unterscheidet simultanen von sukzessivem Spracherwerb?
Simultaner Spracherwerb bedeutet, dass ein Kind zwei Sprachen von Geburt an gleichzeitig lernt, während beim sukzessiven Erwerb die zweite Sprache erst nach der ersten erlernt wird.
Was sind Kopulaverben?
Kopulaverben sind Verben, die ein Subjekt mit einem Prädikatsnomen verbinden. Im Deutschen ist dies das Verb „sein“, im Englischen „be“. Im Spanischen gibt es die Besonderheit der zwei Kopulaverben „ser“ und „estar“.
Wie äußert sich Spracheneinfluss (Interferenz) bei bilingualen Kindern?
Spracheneinfluss tritt auf, wenn Strukturen einer Sprache in die andere übertragen werden. Die Arbeit untersucht, ob dies bei den komplexen spanischen Kopulaverben durch den Einfluss des Deutschen oder Englischen geschieht.
Welche Rolle spielt die Sprachdominanz beim Kopulaerwerb?
Die Dominanz einer Sprache kann dazu führen, dass deren grammatische Regeln auf die schwächere Sprache übertragen werden, was besonders bei Phänomenen wie der Unterscheidung zwischen „ser“ und „estar“ relevant ist.
Warum sind spanische Kopulaverben für die Forschung besonders interessant?
Da das Spanische zwischen dauerhaften Eigenschaften (ser) und vorübergehenden Zuständen (estar) unterscheidet, während Deutsch und Englisch nur ein Verb nutzen, ist dies ein anfälliges Feld für grammatischen Spracheneinfluss.
- Quote paper
- Jessica Kiepert (Author), 2021, Der Erwerb der Kopulaverben beim simultan bilingualen Erstspracherwerb von spanisch-deutschen und spanisch-englischen Kindern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1219418