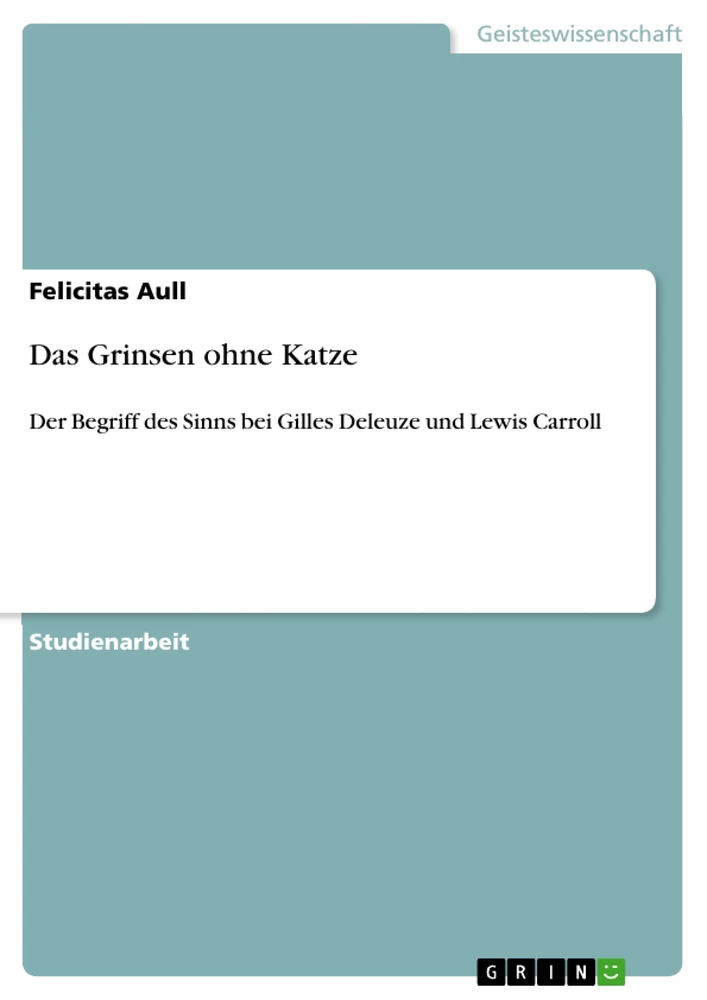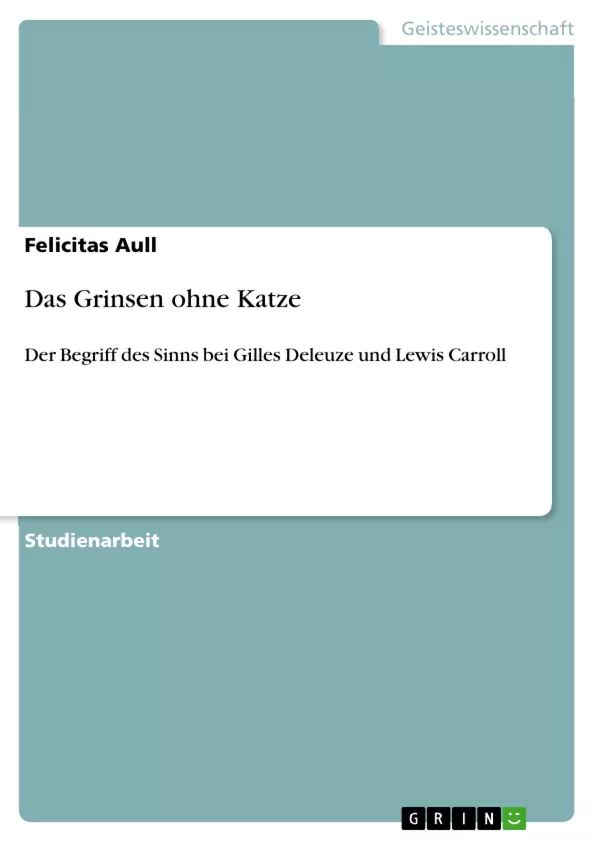„Dem Satz entzogen, ist der Sinn unabhängig von diesem, weil er dessen Bejahung und dessen Verneinung suspendiert, und ist dennoch nur sein entschwundenes Double: genau dieses Grinsen ohne Katze bei Carroll oder die kerzenlose Flamme.“
Nehmen wir uns der reinen Textaussage dieses Ausschnittes aus Deleuze’ Serie der Paradoxa, dem 5. Teil „Vom Sinn“, an, so fällt zunächst auf, dass Deleuze hier eine Einheit von Satz und Sinn formuliert, die eine trennbare ist. Der Sinn kann dem Satz also entzogen werden, und existiert dann als ein Double, wenn auch ein entschwundenes, weiter. Entschwindet dieser Sinn, so muss er, formaler Logik folgend, zuvor in den Satz selbst hinein gelegt, hinein gelesen, gesprochen, oder gesetzt worden sein. Er ist also die Voraussetzung für das Verständnis oder die Bedeutung eines Satzes, für den bestimmenden Inhalt. Daraus erklärt sich, dass er, nunmehr entschwunden, den Satz als ein Abstraktum zurücklässt, über das keine Aussage mehr getroffen werden kann. Die Bejahung und Verneinung seien suspendiert, der Satz als ein hohles Konstrukt, eine verlassene Form, weiterhin als grammatische Schöpfung nackt und bloß existierend.
Inhaltsverzeichnis
- Eine Annäherung an den Gegenstand
- Gilles Deleuze - „vom Sinn“
- Lewis Carroll - „das Grinsen ohne Katze“
- Das Paradox
- Verkörperung und Ereignis
- Strukturwandel
- Gleichzeitigkeit und Multidimensionalität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Begriff des Sinns bei Gilles Deleuze und Lewis Carroll im Kontext des Seminars „Der Begriff der Erfahrung bei Lewis Carroll, Henry James und Virginia Woolf“. Die Arbeit analysiert die Beziehung zwischen Satz und Sinn, insbesondere das Paradox des Sinns, der dem Satz entzogen, aber dennoch mit ihm verbunden ist.
- Das Verhältnis von Satz und Sinn bei Deleuze
- Das Paradox des Sinns: unbegrenzte Wucherung und sterile Verdopplung
- Das „Grinsen ohne Katze“ als Beispiel für das Paradox des Sinns
- Verkörperung und Ereignis im Kontext des Sinns
- Gleichzeitigkeit und Multidimensionalität als Strukturmerkmale des Sinns
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Eine Annäherung an den Gegenstand: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es Deleuzes Konzept des Sinns und Carrolls „Grinsen ohne Katze“ als Ausgangspunkt der Analyse präsentiert. Es wird die trennbare Einheit von Satz und Sinn diskutiert, wobei der Sinn als ein „entschwundenes Double“ des Satzes betrachtet wird.
Kapitel 2: Das Paradox: Hier wird das Paradox des Sinns im Detail erläutert. Deleuzes Beschreibung der unbegrenzten Wucherung und der sterilen Verdopplung als zwei Formen des Paradoxons im Satz wird vorgestellt.
Kapitel 3: Verkörperung und Ereignis: Dieses Kapitel behandelt den Sinn als Attribut, das im Satz erst wirkt. Es wird diskutiert, wie der Sinn als Oberflächenphänomen betrachtet werden kann, das gleichzeitig extern und intern wirkt, sowie der Zusammenhang zwischen Sinn und Ereignis im Kontext der zeitlichen und räumlichen Verortung.
Kapitel 4: Strukturwandel: Das Kapitel konzentriert sich auf die Gleichzeitigkeit und Multidimensionalität des Sinns. Es werden Deleuzes Rhizome und der Begriff der „reversiblen Sprunggröße“ der Zeit diskutiert, sowie die Multidimensionalität des Raumes im Kontext der Analyse des „Grinsens ohne Katze“.
Schlüsselwörter
Gilles Deleuze, Lewis Carroll, Sinn, Paradox, Satz, Ding, Verkörperung, Ereignis, Gleichzeitigkeit, Multidimensionalität, Rhizom, Virtualität, Wirklichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Hausarbeit?
Die Arbeit untersucht den Begriff des Sinns bei Gilles Deleuze und Lewis Carroll, insbesondere das Verhältnis zwischen Satz und Sinn.
Was bedeutet die Metapher „Grinsen ohne Katze“ in diesem Kontext?
Sie dient als Beispiel für das Paradox des Sinns, der als „entschwundenes Double“ unabhängig vom Satz (der Katze) existieren kann, aber dennoch auf ihn bezogen bleibt.
Welche Rolle spielt Gilles Deleuze in der Arbeit?
Deleuzes Werk „Logik des Sinns“ (insb. der Teil „Vom Sinn“) bildet die theoretische Grundlage für die Analyse der Paradoxa und der Struktur des Sinns.
Wie wird der Sinn als „Ereignis“ definiert?
Sinn wird als Oberflächenphänomen betrachtet, das gleichzeitig intern und extern wirkt und eng mit der zeitlichen und räumlichen Verortung von Ereignissen verknüpft ist.
Was versteht die Arbeit unter der „Multidimensionalität“ des Sinns?
Es beschreibt die Strukturmerkmale des Sinns, die Deleuze durch das Konzept des Rhizoms und die Gleichzeitigkeit von Virtualität und Wirklichkeit erklärt.
In welchem Seminar wurde dieses Thema behandelt?
Das Thema wurde im Rahmen des Seminars „Der Begriff der Erfahrung bei Lewis Carroll, Henry James und Virginia Woolf“ erarbeitet.
- Quote paper
- B.A. Felicitas Aull (Author), 2008, Das Grinsen ohne Katze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122037