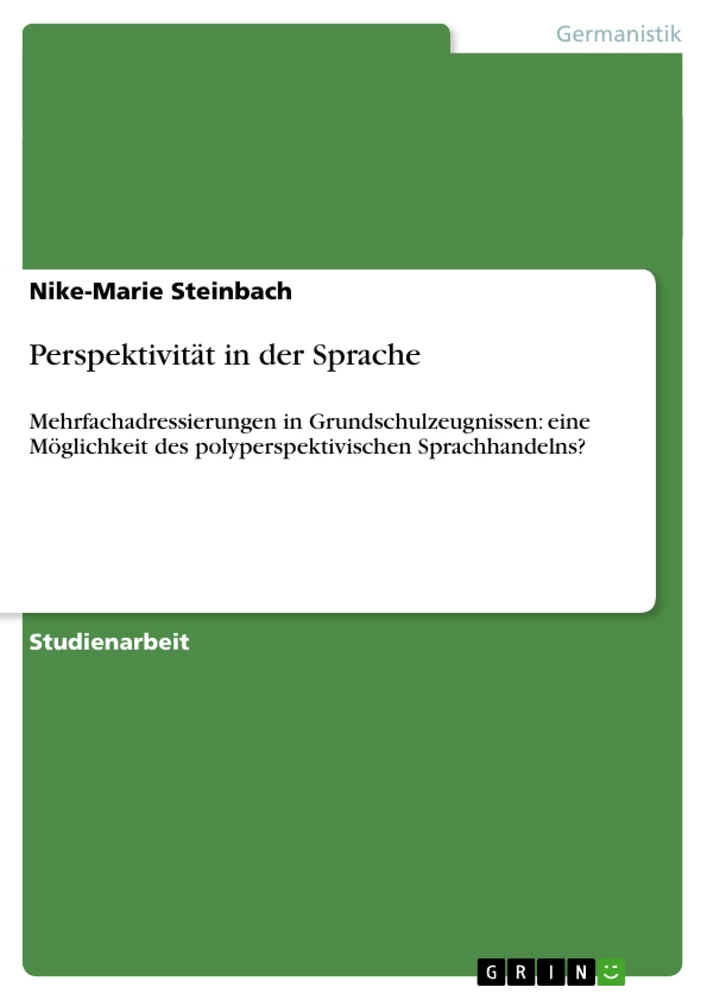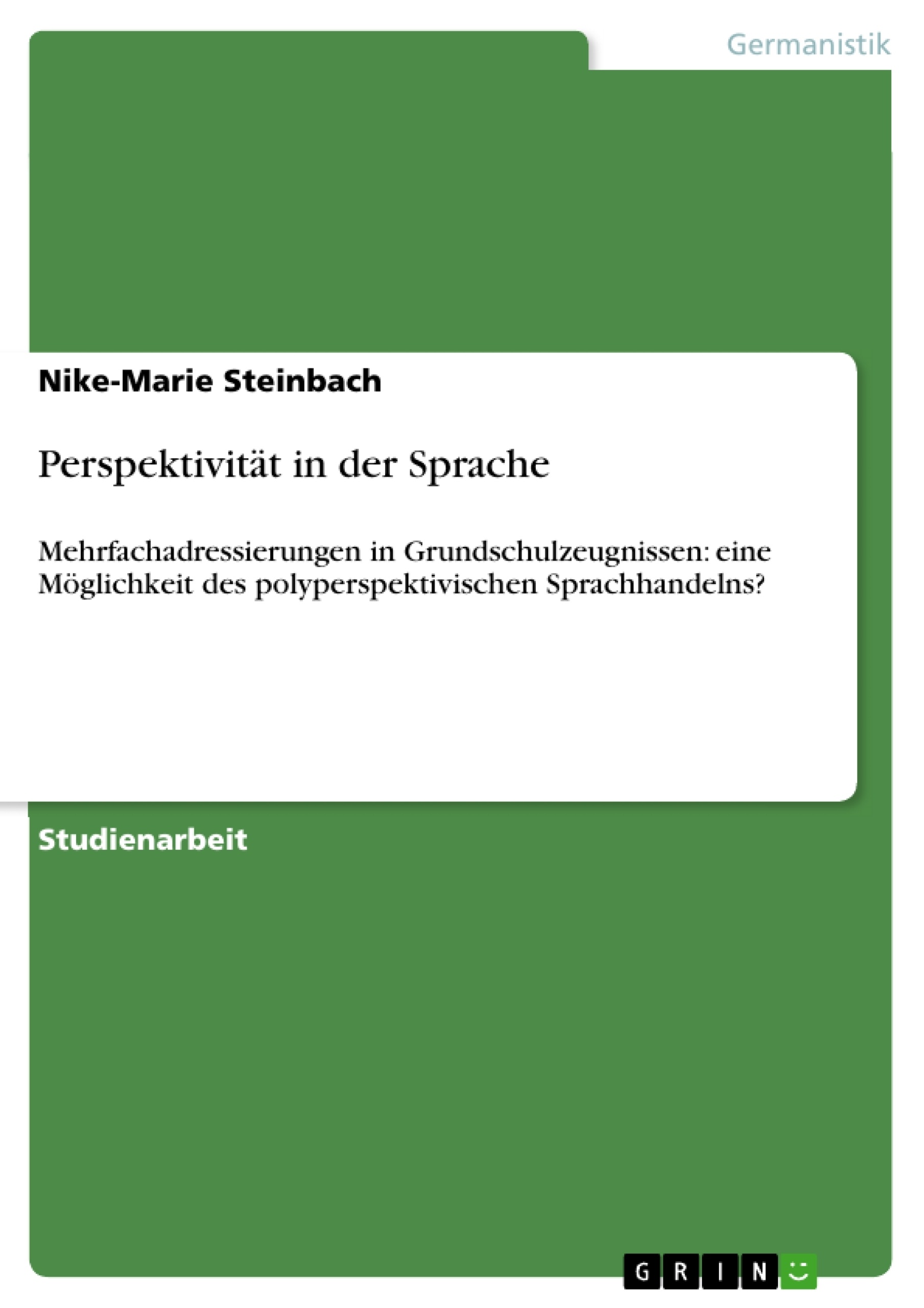Der Mensch nimmt die Welt mittels seiner Sinne wahr und verarbeitet diese Eindrücke mithilfe seines Verstandes, der wiederum durch die Sinneseindrücke des Menschen geformt wurde und wird. Von diesem Verstand „entspringen Begriffe“, werden Worte formuliert, wird Sprache entwickelt und benutzt. Und diese Sprache wird erneut von den Sinnen aufgenommen und vom Verstand verarbeitet. Nun verfügt jeder Mensch über eine unterschiedliche „Sinnlichkeit“, lebt jeder in einer unterschiedlichen Welt und nimmt somit unterschiedliche Eindrücke wahr, die von einem Verstand, der schon von unterschiedlichen Impressionen geprägt wurde, auf unterschiedliche Weise verarbeitet werden.
Sprache ist ein Mittel zum Kommunizieren, zum Vermitteln von Informationen, das so eingesetzt werden soll, dass trotz der genannten 'Unterschiedlichkeiten' ein Gedankenaustausch möglich ist. Da nun jeder Mensch eine unterschiedliche Perspektive auf die Welt hat, kann es dabei zu Missverständnissen führen. Dennoch gibt es vielleicht eine Möglichkeit, diese unterschiedlichen Perspektiven zu nutzen.
Um dies aufzuzeigen werde ich in dieser Arbeit zunächst das Phänomen der Perspektivität innerhalb der menschlichen Wahrnehmung, der Malerei und der Sprache verdeutlichen. Dann werde ich die Möglichkeit des polyperspektivischen Sprachhandelns an der Mehrfachadressierung erläutern und anhand der Formulierungen in Grundschulzeugnissen exemplifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Perspektivität
- 2.1 Perspektivität: ein anthropologisches und kulturelles Phänomen
- 2.1.1 Terminologie
- 2.1.2 Perspektivität als anthropologisches Phänomen
- 2.1.3 Perspektivität als kulturelles Phänomen
- 2.2 Perspektivität in der Malerei
- 2.2.1 Bildende Kunst als Objektivierungsform
- 2.2.2 Perspektivität in Bildern
- 2.2.3 Zentralperspektive
- 2.2.4 Polyperspektive
- 2.3 Perspektivität in der Sprache
- 2.1 Perspektivität: ein anthropologisches und kulturelles Phänomen
- 3 Mehrfachadressierung
- 3.1 Typologie der Adressaten
- 3.1.1 Adressierungsarten
- 3.1.2 Adressierungsformen
- 3.1.3 Verhältnis von Adressierungsformen und Adressierungsarten
- 3.2 Typologie der Mehrfachadressierung
- 3.2.1 Offene Mehrfachadressierung
- 3.2.2 Verdeckte Mehrfachadressierung
- 3.2.2.1 Kodierte Mehrfachadressierung
- 3.2.2.2 Inszenierte Mehrfachadressierung
- 3.1 Typologie der Adressaten
- 4 Textanalyse: Mehrfachadressierungen in Grundschulzeugnissen
- 4.1 Form der Mehrfachadressierung
- 4.1.1 Adressierungsarten in Grundschulzeugnissen
- 4.1.2 Adressierungsformen in Grundschulzeugnissen
- 4.1.3 Kodierte Mehrfachadressierung in Grundschulzeugnissen
- 4.2 Analyse einiger mehrfachadressierter Formulierungen aus Grundschulzeugnissen
- 4.3 Fazit zur Textanalyse
- 4.1 Form der Mehrfachadressierung
- 5 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Perspektivität in der Sprache, insbesondere im Kontext der Mehrfachadressierung. Ziel ist es, die Möglichkeiten polyperspektivischen Sprachhandelns aufzuzeigen und anhand von Beispielen aus Grundschulzeugnissen zu illustrieren.
- Perspektivität als anthropologisches und kulturelles Phänomen
- Perspektivität in der Malerei und deren Bezug zur Sprache
- Typologie der Mehrfachadressierung (offene und verdeckte Formen)
- Analyse von Mehrfachadressierungen in Grundschulzeugnissen
- Potenziale und Herausforderungen polyperspektivischen Sprachhandelns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Perspektivität und deren Relevanz für die sprachliche Kommunikation ein. Kapitel 2 beleuchtet Perspektivität als anthropologisches und kulturelles Phänomen, untersucht ihren Ausdruck in der Malerei und schließlich ihren Einfluss auf die Sprache. Kapitel 3 befasst sich mit der Mehrfachadressierung, indem es verschiedene Arten und Formen der Adressierung sowie deren Verhältnis zueinander differenziert. Kapitel 4 analysiert die Verwendung von Mehrfachadressierungen in Grundschulzeugnissen und präsentiert exemplarische Formulierungen.
Schlüsselwörter
Perspektivität, Mehrfachadressierung, Sprachhandeln, Polyperspektive, Grundschulzeugnisse, Kommunikation, Wahrnehmung, Kognition, Objektivierung.
- Quote paper
- Nike-Marie Steinbach (Author), 2008, Perspektivität in der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122038