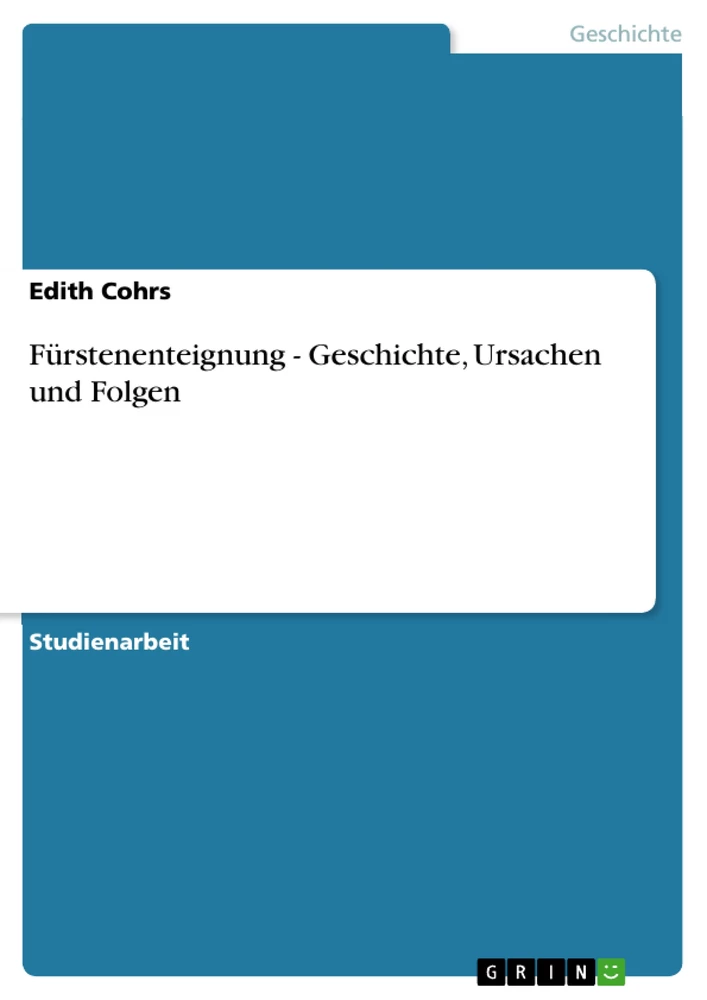Während der Novemberrevolution 1918 wurde die Republik von Weimar ausgerufen. In den nun folgenden goldenen 20’ern gab es mehrere Fälle, indem ein vergleichsweise unscheinbarer Anlass die innenpolitische Stabilität erschütterte. Einer dieser Fälle war die vermögensrechtliche Auseinandersetzung der Länder mit den früher regierenden Fürstenhäusern. Sie aktivierte den sozialen Sprengstoff, der sich seit Jahren angesammelt hatte. Während der Revolutionsära wurde das fürstliche Eigentum zwar beschlagnahmt. Es wurde jedoch nicht wie in Österreich, einfach enteignet. Gegen die Beschlagnahmung ihres Eigentums zogen Mitglieder der ehemals regierenden Fürstenhäuser und deren Nebenlinien immer häufiger vor Gericht. Dort siegten sie nach langen Verhandlungen regelmäßig. Diese Siege erlangten sie jedoch nicht nur wegen der formalen Rechtslage, sondern auch wegen der monarchistischen Einstellung der Richter. Ihre Rechtssprüche erregten in der Öffentlichkeit Entrüstung. Dem Fiskus gingen nämlich Vermögenswerte in Millionenhöhe verloren, während die Währungs- und Haushaltssanierung auf Kosten der breiteren sozialen Schichten ging.
Am 19. Januar 1926 brachten SPD und KPD gemeinsam im Reichstag einen Gesetzesentwurf ein, der die entschädigungslose Enteignung der Fürsten zugunsten der Erwerbslosen, der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen, der Sozial- und Kleinrentner, der bedürftigen Opfer der Inflation, der Landarbeiter, Kleinpächter und Kleinbauern verlangte. Dieses Gesetz der zur Fürstenenteignung sollte im Wege des Volksbegehrens verwirklicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffe
- Volksbegehren
- Volksentscheid
- Das Gesetzgebungsverfahren des Deutschen Reiches gem. Artikel (Art.) 57, 68 - 77, 165 IV Weimarer Reichsverfassung (WRV)
- Gemeinsame rechtliche Grundlagen von Volksbegehren und Volksentscheid
- Verfassungsrechtliche Grundlagen
- Volksentscheid, Volksbegehren gemäß Art. 73 WRV
- Volksentscheid im Falle des Einspruchs durch den Reichsrat gem. Art. 74 III WRV
- Außerkraftsetzung eines Reichstagsbeschlusses durch Volksentscheid gem. Art. 75 WRV
- Änderung der Verfassung gem. Art. 76 WRV
- Gesetz über den Volksentscheid vom 27. Juni 1921 in der Fassung vom 31. Dezember 1923
- Auszug aus der Verordnung über Reichswahlen und -abstimmungen (Reichsstimmordnung vom 14. März 1924) in der Fassung vom 14. Mai 1926; Abschnitt V: Sonderbestimmungen für Volksbegehren und Volksentscheid
- Verfassungsrechtliche Grundlagen
- Fürstenenteignung
- Ursachen der Fürstenenteignung
- historisch, rechtliche Gründe für die Fürstenenteignung
- Das Volksbegehren "Enteignung der Fürstenvermögen" vom 04. - 17. März 1926
- Der Reichsvolksentscheid über die Enteignung der Fürstenvermögen am 20. Juni 1926
- politische und gesellschaftliche Auswirkungen der "Fürstenenteignung" auf die Weimarer Republik
- öffentliche Meinung zur Fürstenenteignung
- politische und gesellschaftliche Folgen der "Fürstenenteignung" für die Republik von Weimar
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Fürstenenteignung in der Weimarer Republik und beleuchtet die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, die zu einem Volksbegehren und einem Volksentscheid führten. Der Fokus liegt auf den historischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Aspekten der Fürstenenteignung und deren Auswirkungen auf die Weimarer Republik.
- Rechtliche Grundlagen von Volksbegehren und Volksentscheid in der Weimarer Verfassung
- Historische Gründe und Ursachen für die Fürstenenteignung
- Politische und gesellschaftliche Auswirkungen des Volksbegehrens und Volksentscheids
- Öffentliche Meinung zur Fürstenenteignung
- Das Gesetzgebungsverfahren des Deutschen Reiches im Kontext der Fürstenenteignung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit der Bedeutung der direkten Volksgesetzgebung in der Weimarer Verfassung und stellt die Volksinitiative als Instrument des Volkes dar. Kapitel 1 definiert die Begriffe Volksbegehren und Volksentscheid, während Kapitel 2 das Gesetzgebungsverfahren des Deutschen Reiches im Kontext der Weimarer Verfassung beleuchtet. Kapitel 3 untersucht die rechtlichen Grundlagen von Volksbegehren und Volksentscheid. Kapitel 4 betrachtet die Ursachen und historischen Gründe für die Fürstenenteignung. Kapitel 5 analysiert das Volksbegehren "Enteignung der Fürstenvermögen", während Kapitel 6 den Reichsvolksentscheid über die Enteignung der Fürstenvermögen behandelt. Die Kapitel 7 und 8 befassen sich mit den politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Fürstenenteignung auf die Weimarer Republik.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Volksbegehren, Volksentscheid, Fürstenenteignung, Weimarer Republik, Gesetzgebungsverfahren, Verfassungsgeschichte, politische und gesellschaftliche Auswirkungen, öffentliche Meinung. Die Arbeit befasst sich mit den rechtlichen Grundlagen der direkten Demokratie in der Weimarer Republik und beleuchtet die historische Entwicklung der Fürstenenteignung. Dabei werden sowohl die rechtlichen Rahmenbedingungen als auch die gesellschaftlichen und politischen Folgen dieses Ereignisses beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Fürstenenteignung in der Weimarer Republik?
Die Fürstenenteignung war eine politische und rechtliche Auseinandersetzung in den 1920er Jahren über das Vermögen der ehemals regierenden Fürstenhäuser, die nach der Novemberrevolution 1918 abgesetzt worden waren.
Warum kam es 1926 zu einem Volksbegehren?
SPD und KPD brachten das Volksbegehren ein, um eine entschädigungslose Enteignung der Fürsten zu erreichen. Die Erlöse sollten Kriegshinterbliebenen, Arbeitslosen und Opfern der Inflation zugutekommen.
Welche Rolle spielten die Gerichte bei der Fürstenabfindung?
Viele Richter hatten eine monarchistische Einstellung und sprachen den Fürstenhäusern in Rechtsstreitigkeiten regelmäßig hohe Entschädigungen zu, was in der von Inflation geplagten Bevölkerung auf große Entrüstung stieß.
Was ist der Unterschied zwischen einem Volksbegehren und einem Volksentscheid?
Ein Volksbegehren ist der Antrag des Volkes auf Erlass eines Gesetzes. Erhält dieser genug Unterschriften und lehnt der Landtag/Reichstag den Entwurf ab, kommt es zum Volksentscheid, der eigentlichen Abstimmung der Bürger.
Wie ging der Volksentscheid am 20. Juni 1926 aus?
Obwohl eine überwältigende Mehrheit der Abstimmenden für die Enteignung stimmte, scheiterte der Volksentscheid am erforderlichen Quorum, da nicht genug Wahlberechtigte an der Abstimmung teilnahmen.
Welche rechtlichen Grundlagen der Weimarer Verfassung werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert insbesondere die Artikel 73 bis 76 der Weimarer Reichsverfassung (WRV), welche die direkte Demokratie und Gesetzgebungsverfahren durch das Volk regeln.
- Arbeit zitieren
- Edith Cohrs (Autor:in), 1992, Fürstenenteignung - Geschichte, Ursachen und Folgen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12216