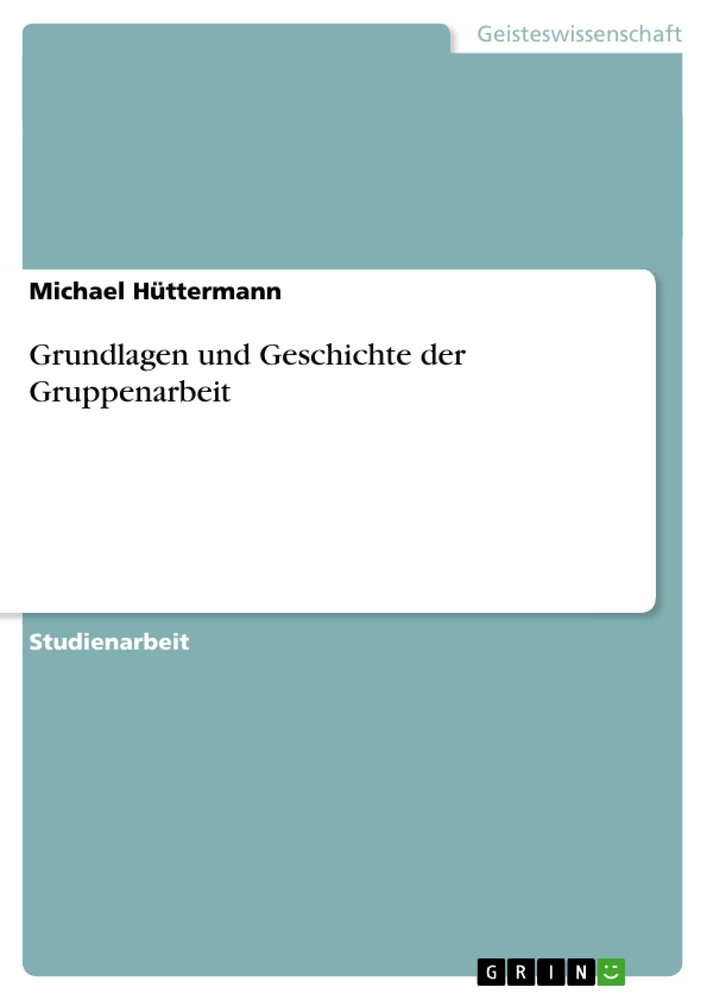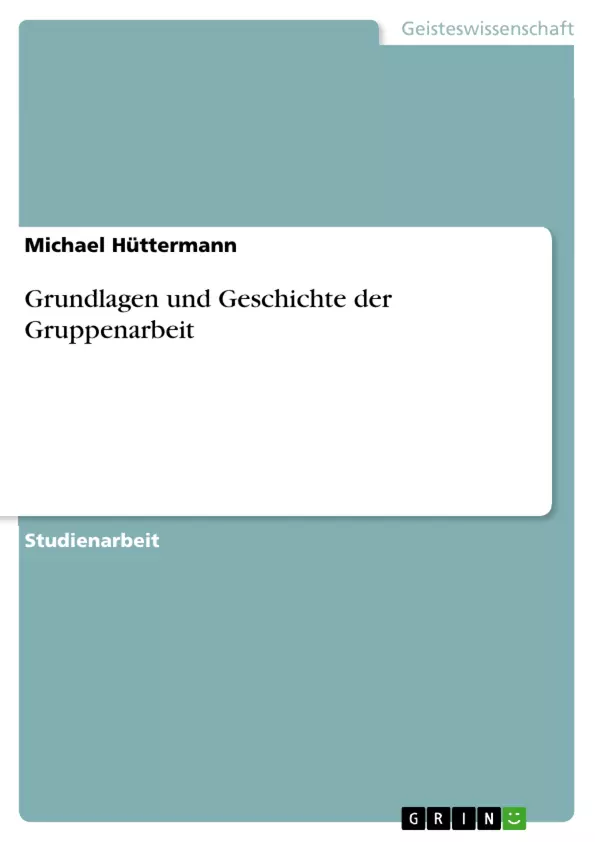Seitdem die Gruppenarbeit bewußt als Methode der sozialen Arbeit wahrgenommen und genutzt wird, wird auch nach einer klaren und allgemeingültigen Definition dafür gesucht.
Obwohl dies seit vielen Jahren der Fall ist, in denen sich sowohl die Gruppenarbeit selbst als auch die Ansichten und Definitionsversuche darüber verändert haben, gibt es bis heute nicht die eine Definition, die allgemein gültig ist und die von allen Menschen, die an Gruppenarbeit beteiligt sind akzeptiert wird.
Es gibt verschiedene Definitionen bzw. Definitionsansätze, die aber alle verschieden ausgelegt und durch neue Aspekte ergänzt werden können. Die soziale Gruppenarbeit wird als eine Methode der Sozialarbeit bezeichnet. Die „Kernaufgaben“ der sozialen Gruppenarbeit sind:
„1. Individuen richtig zu beurteilen, ihnen zur Klärung und dazu zu helfen, die Wechselwirkung zwischen ihren inneren Motiven und den Forderungen der Gesellschaft zu bewältigen und
2. zu helfen, die soziale Umwelt zu verändern, wenn sie für die Entwicklung des Einzelnen schädigend wirkt.
Jede besondere Einrichtung, die in der Sozialarbeit praktiziert wird, hat noch enger begrenzte und spezifische Aufgaben.“ (Vgl. Gisela Konopka: „Soziale Gruppenarbeit: Ein helfender Prozeß“, S. 52) Die soziale Gruppenarbeit findet u.a. in der Gesundheits-, Sozial- und Jugendhilfe sowie in der Erziehung und Erholung statt und ist in diesen Bereichen eine helfende Methode. Sie wird aber auch in anderen Gruppen eingesetzt die verschiedene Ziele und Interessen haben.
In all diesen Gruppen können die unterschiedlichsten Menschen Mitglieder sein, z.B. Gesunde oder Kranke oder Menschen mit verschiedenen Interessen, die sich zu einer Gruppe zusammenschließen.
Wichtig ist dabei die Gruppe an sich; „die Interaktion zwischen Einzelnen“. (Vgl. Gisela Konopka: „Gruppenarbeit: Ein helfender Prozeß“ S. 45)
Insgesamt können die verschiedenen Definitionsansätze zu folgender Definition zusammengefaßt werden:
„Soziale Gruppenarbeit ist eine Methode der Sozialarbeit, die den Einzelnen durch sinnvolle Gruppenerlebnisse hilft, ihre soziale Funktionsfähigkeit zu steigern und ihren persönlichen Problemen, ihren Gruppenproblemen oder den Problemen des öffentlichen Lebens besser gewachsen zu sein.“ (Vgl. Gisela Konopka: „Soziale Gruppenarbeit: Ein helfender Prozeß“ S.39)
Inhaltsverzeichnis
- Begriffserklärung Gruppenarbeit
- Geschichtliche Entwicklung
- Die Settlement-Bewegung
- Die Barnetts, Toynbee Hall (1883) als Aussenstelle der Universität in einem Londoner Slum
- Jane Addams, Hull House (1889) – Ein Nachbarschaftsheim
- Die Wandervogelbewegung
- Situation nach dem zweiten Weltkrieg
- Der Jugendhof Vlotho
- Das Haus am Rupenhorn
- Das Haus Schwalbach
- Gemeinwesenarbeit / Studentenbewegung
- Therapeutische Bewegung
- Offene Jugendarbeit
- Feministische Gruppenarbeit
- Selbsthilfegruppen
- Friedensbewegung
- Die Settlement-Bewegung
- Ziele von Gruppenarbeit
- Gruppenphasen / Leitungsmodelle
- Gruppenphasen
- Leitungsmodelle
- Methoden der Gruppenarbeit
- Beispiele von kommunikationsorientierten Methoden
- Brainstorming
- Methode „66“
- Rollenspiel
- Beispiele von sachorientierten Methoden
- Referat
- Podiumsgespräch
- Expertenbefragung
- Beispiele von kommunikationsorientierten Methoden
- Kritische Einschätzung / Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk befasst sich mit den Grundlagen und der Geschichte der Gruppenarbeit. Es beleuchtet die Entwicklung der Gruppenarbeit von ihren Anfängen bis zur Gegenwart und analysiert verschiedene Ansätze, Methoden und Ziele der Gruppenarbeit.
- Historische Entwicklung der Gruppenarbeit
- Theoretische Grundlagen der Gruppenarbeit
- Methoden und Techniken der Gruppenarbeit
- Ziele und Wirkungen der Gruppenarbeit
- Kritische Betrachtung der Gruppenarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Begriffserklärung Gruppenarbeit
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Gruppenarbeit“ und beleuchtet verschiedene Definitionsansätze. Es stellt die „Kernaufgaben“ der sozialen Gruppenarbeit nach Gisela Konopka dar und beschreibt den Einsatzbereich der Methode in verschiedenen Bereichen wie Gesundheits-, Sozial- und Jugendhilfe.
Geschichtliche Entwicklung
Die Settlement-Bewegung
Die Barnetts, Toynbee Hall (1883) als Aussenstelle der Universität in einem Londoner Slum
Dieser Abschnitt beschreibt die Gründung von Toynbee Hall durch Studenten der Universität Cambridge, die sich mit den sozialen Problemen der Londoner Slums auseinandersetzen wollten. Das Ziel war es, die Lebensverhältnisse durch aktives Mitleben zu verbessern und soziale Probleme zu lösen.
Jane Addams, Hull House (1889) – Ein Nachbarschaftsheim
Das Kapitel beleuchtet die Gründung des Hull House durch Jane Addams in Chicago. Es zeigt die Entwicklung des Hull House zu einem Nachbarschaftsheim, das sich für die Integration und Unterstützung von Einwanderern einsetzte und verschiedene Bildungs- und Freizeitangebote für die Bewohner des Viertels anbot.
Die Wandervogelbewegung
Dieser Abschnitt behandelt die Entstehung und Entwicklung der Wandervogelbewegung in Deutschland. Er beschreibt die Ziele der Bewegung, die vor allem in der naturnahen Lebensweise, der Förderung von Gemeinschaft und dem Streben nach Selbstbestimmung lagen.
Situation nach dem zweiten Weltkrieg
Das Kapitel beleuchtet die Situation der Gruppenarbeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beschreibt die Herausforderungen, die sich aus den Folgen des Krieges und den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen ergaben.
Ziele von Gruppenarbeit
Dieses Kapitel behandelt die Ziele von Gruppenarbeit. Es zeigt die unterschiedlichen Zielsetzungen, die von der Förderung der individuellen Entwicklung bis zur Lösung von sozialen Problemen reichen.
Gruppenphasen / Leitungsmodelle
Gruppenphasen
Dieser Abschnitt beschreibt verschiedene Gruppenphasen, die in Gruppenprozessen auftreten können. Es beleuchtet die typischen Merkmale und Herausforderungen jeder Phase und zeigt Möglichkeiten der Leitung und Moderation von Gruppen.
Leitungsmodelle
Das Kapitel behandelt verschiedene Leitungsmodelle, die in der Gruppenarbeit zum Einsatz kommen. Es stellt unterschiedliche Ansätze und Konzepte zur Führung von Gruppen vor.
Methoden der Gruppenarbeit
Beispiele von kommunikationsorientierten Methoden
Brainstorming
Dieser Abschnitt beschreibt die Brainstorming-Methode als ein Beispiel für eine kommunikationsorientierte Methode. Er zeigt die Vorteile und Anwendungsbereiche dieser Methode und beleuchtet die Prinzipien und Regeln des Brainstormings.
Methode „66“
Dieses Kapitel stellt die „66“-Methode vor, eine weitere Methode, die die Kommunikation in Gruppen fördert.
Rollenspiel
Der Abschnitt erläutert das Rollenspiel als Methode der Gruppenarbeit.
Beispiele von sachorientierten Methoden
Referat
Dieses Kapitel beschreibt das Referat als eine sachorientierte Methode der Gruppenarbeit.
Podiumsgespräch
Dieser Abschnitt beleuchtet das Podiumsgespräch als eine weitere Methode der Gruppenarbeit, die sich auf die Diskussion von Sachthemen fokussiert.
Expertenbefragung
Das Kapitel behandelt die Expertenbefragung als eine sachorientierte Methode der Gruppenarbeit.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieses Textes sind: Gruppenarbeit, soziale Arbeit, Geschichte, Entwicklung, Methoden, Ziele, Leitungsmodelle, Gruppenphasen, Kommunikation, Sachorientierung.
- Quote paper
- Michael Hüttermann (Author), 2003, Grundlagen und Geschichte der Gruppenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/12217