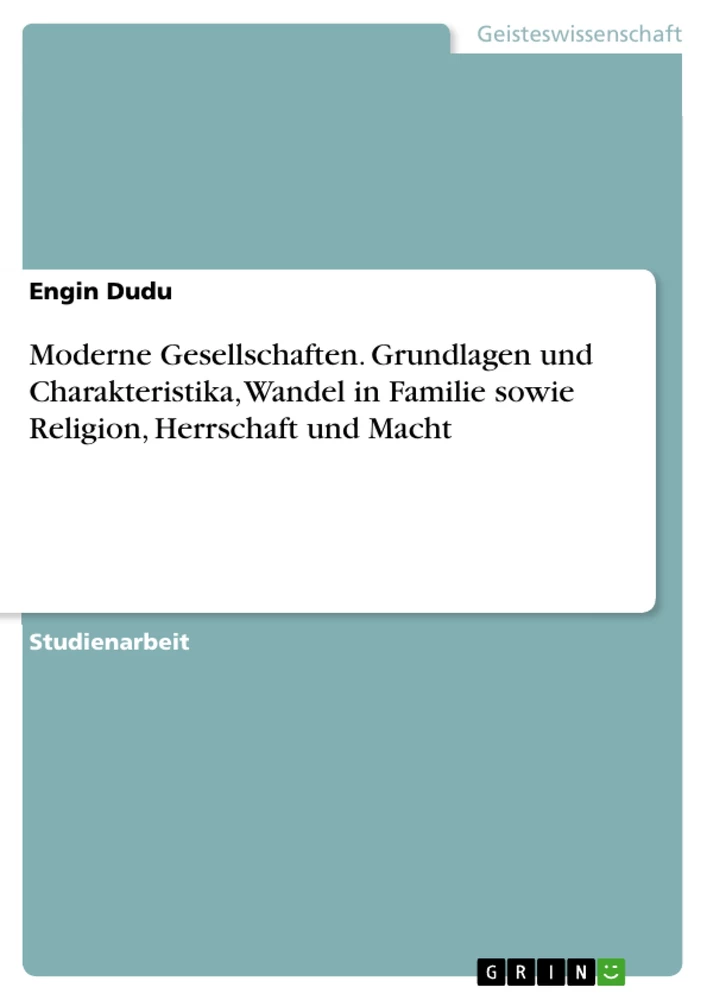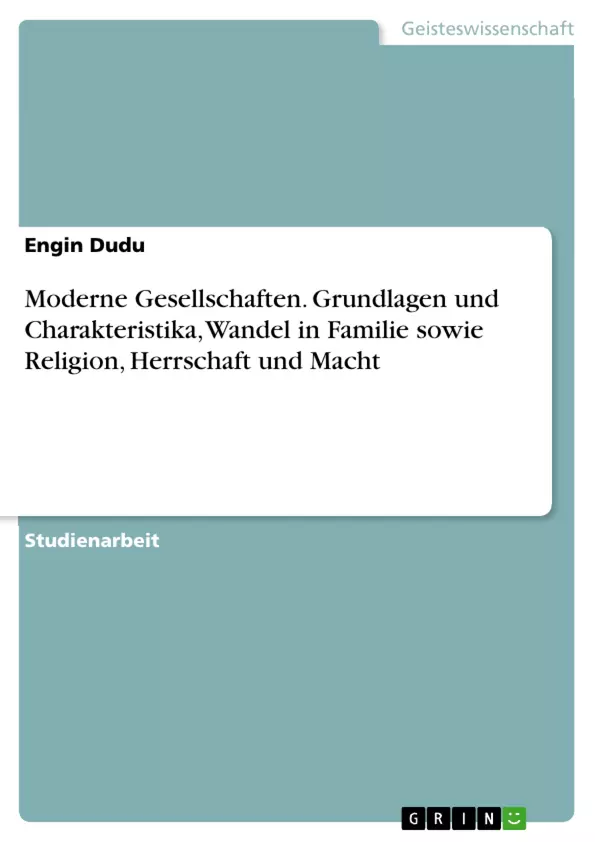Diese Arbeit soll einen Überblick über die Grundlagen und Charakteristika moderner Gesellschaften geben. Dabei werde ich neben bestimmten Definitionen von einigen Klassikern der Soziologie, hauptsächlich auf die Überlegung von Berger und Luckmann eingehen. Es soll der Entstehungsprozess von einer Gesellschaft und die Integration des Einzelnen in diese Gesellschaft dargestellt werden, bevor ein Einblick auf die Charakteristika moderner Gesellschaften stattfindet. Am Ende gehe ich auf drei Grundbegriffe – Familie, Religion und Macht – ein und versuche in den Diskussionsabschnitten Zusammenhänge darzustellen sowie gewisse Entwicklungen in diesen Bereichen kritisch zu hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Gesellschaft - Historie, Entstehung und Charakteristika
- Historischer Überblick
- Wahrnehmung/Entstehung einer Gesellschaft
- Charakteristika moderner Gesellschaften
- Wandel der Familie
- Wandel der Religion
- Grund und Funktion der Religion
- Sozialer Wandel der Religion nach Scheuch
- Herrschaft und Macht
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit bietet einen Überblick über die Grundlagen und Charakteristika moderner Gesellschaften. Sie untersucht den Entstehungsprozess von Gesellschaften und die Integration des Einzelnen, beleuchtet charakteristische Merkmale moderner Gesellschaften und analysiert die Entwicklungen in den Bereichen Familie, Religion und Macht. Die Arbeit verknüpft klassische soziologische Ansätze mit aktuellen Überlegungen.
- Definition und Abgrenzung moderner Gesellschaften
- Entstehung und Entwicklung von Gesellschaften im historischen Kontext
- Charakteristika moderner Gesellschaften (z.B. Arbeitsteilung, Bildungssystem)
- Wandel von Familie und Religion
- Herrschaft und Macht in modernen Gesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung thematisiert die Schwierigkeit, den Begriff „Moderne Gesellschaften“ präzise zu definieren, obwohl bestimmte Merkmale wie demokratische Staatsformen, Arbeitsteilung und kapitalistische Ökonomien offensichtlich sind. Die Arbeit skizziert ihren Fokus: eine Auseinandersetzung mit den Grundlagen und Charakteristika moderner Gesellschaften, unter Einbezug klassischer soziologischer Perspektiven, insbesondere Berger und Luckmann, sowie eine Analyse der Entwicklungen in den Bereichen Familie, Religion und Macht.
Grundlagen der Gesellschaft - Historie, Entstehung und Charakteristika: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über Gesellschaftstypen, beginnend mit Jäger- und Sammlergesellschaften bis hin zu modernen Gesellschaften. Es beleuchtet die Entwicklung von Agrar-, Weide- und traditionellen Gesellschaften und analysiert die zunehmende Ungleichheit im Verlauf dieser Entwicklung. Der Abschnitt über die Wahrnehmung von Gesellschaften greift die Theorien von Berger und Luckmann auf, welche die gesellschaftlichen Strukturen aus dem Zusammenhang von Wissen und Realität herleiten. Abschließend werden die Charakteristika moderner Gesellschaften nach Nassehi vorgestellt und mit den Ansichten klassischer Soziologen verglichen.
Historischer Überblick: Dieser Abschnitt zeichnet einen umfassenden historischen Überblick über die Entwicklung von Gesellschaften nach, beginnend mit Jäger- und Sammlerkulturen bis zu modernen Gesellschaften. Er beschreibt die Übergänge von Agrar- über Weide- zu traditionellen Gesellschaften und die damit verbundene zunehmende soziale Ungleichheit. Die Entstehung der „Ersten Welt“ durch die industrielle Revolution, Urbanisierung und die Herausbildung von Nationalstaaten wird ebenso behandelt wie die Entwicklung der „Zweiten Welt“ im Kontext der russischen Revolution und der anschließende Wandel in den post-sowjetischen Gesellschaften. Schließlich werden Entwicklungs- und Schwellenländer im Kontext des globalen Modernisierungsprozesses betrachtet, wobei die herausragende Rolle der „Ersten Welt“ als Vorbild und die komplexen Machtverhältnisse im globalen Süden hervorgehoben werden.
Wahrnehmung/Entstehung einer Gesellschaft: Dieser Teil der Arbeit konzentriert sich auf die soziologische Betrachtung der Gesellschaft, indem er verschiedene Definitionen und Perspektiven – insbesondere die von Emile Durkheim und Max Weber – diskutiert. Im Mittelpunkt steht jedoch die Perspektive von Berger und Luckmann. Ihre Theorie wird ausführlich erläutert, die den Doppelcharakter der Gesellschaft (objektive und subjektive Züge) betont und die Entstehung gesellschaftlicher Strukturen aus dem Wissen der Gesellschaft herleitet. Die Autoren betonen dabei den dynamischen Prozess der wechselseitigen Beeinflussung zwischen objektiver Realität und subjektivem Erleben und der Entstehung von gesellschaftlicher Wirklichkeit durch die Internalisierung von Wissen.
Schlüsselwörter
Moderne Gesellschaften, Soziologie, Gesellschaftstheorien, Historischer Wandel, Familie, Religion, Macht, Sozialer Wandel, Berger und Luckmann, Industrialisierung, Urbanisierung, Rationalisierung, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Moderne Gesellschaften
Was ist der Inhalt der Seminararbeit?
Die Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über moderne Gesellschaften. Sie behandelt deren Grundlagen und Charakteristika, untersucht ihren Entstehungsprozess und die Integration des Einzelnen, analysiert Entwicklungen in den Bereichen Familie, Religion und Macht und verknüpft klassische soziologische Ansätze mit aktuellen Überlegungen. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab: Definition und Abgrenzung moderner Gesellschaften, historische Entwicklung von Gesellschaften (von Jäger- und Sammlergesellschaften bis zu modernen Gesellschaften), Charakteristika moderner Gesellschaften (Arbeitsteilung, Bildungssystem etc.), Wandel von Familie und Religion, sowie Herrschaft und Macht in modernen Gesellschaften. Dabei werden klassische soziologische Theorien von Autoren wie Berger und Luckmann berücksichtigt.
Welche soziologischen Theorien werden verwendet?
Die Seminararbeit bezieht sich auf klassische soziologische Ansätze, insbesondere auf die Theorien von Berger und Luckmann, die den Entstehungsprozess gesellschaftlicher Strukturen aus dem Zusammenhang von Wissen und Realität erklären. Auch Emile Durkheim und Max Weber werden erwähnt und ihre Perspektiven diskutiert. Die Arbeit vergleicht zudem verschiedene Ansichten klassischer Soziologen mit den Erkenntnissen von Nassehi.
Wie wird der historische Wandel von Gesellschaften dargestellt?
Der historische Überblick beginnt mit Jäger- und Sammlergesellschaften und verfolgt die Entwicklung über Agrar-, Weide- und traditionelle Gesellschaften bis hin zu modernen Gesellschaften. Er beleuchtet die zunehmende soziale Ungleichheit im Verlauf dieser Entwicklung, die Entstehung der "Ersten Welt" durch Industrialisierung und Urbanisierung, die Entwicklung der "Zweiten Welt" und den Wandel in post-sowjetischen Gesellschaften sowie Entwicklungs- und Schwellenländer im Kontext der Globalisierung.
Wie wird der Wandel von Familie und Religion behandelt?
Die Arbeit beschreibt den Wandel von Familie und Religion als wichtige Aspekte moderner Gesellschaften. Im Bezug auf Religion wird der grundsätzliche Funktion und der soziale Wandel nach Scheuch untersucht. Die genauen Details zum Wandel der Familie und der Religion sind in den entsprechenden Kapiteln im Detail ausgeführt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Moderne Gesellschaften, Soziologie, Gesellschaftstheorien, Historischer Wandel, Familie, Religion, Macht, Sozialer Wandel, Berger und Luckmann, Industrialisierung, Urbanisierung, Rationalisierung, Globalisierung.
Welche Kapitel enthält die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Grundlagen der Gesellschaft - Historie, Entstehung und Charakteristika (inkl. Historischer Überblick und Wahrnehmung/Entstehung einer Gesellschaft), Wandel der Familie, Wandel der Religion, Herrschaft und Macht, und Conclusio.
Wo finde ich weitere Informationen?
Die vollständige Seminararbeit mit detaillierten Ausführungen zu allen genannten Themen steht zur Verfügung (genaue Quelle hier einfügen, falls zutreffend).
- Arbeit zitieren
- Engin Dudu (Autor:in), 2020, Moderne Gesellschaften. Grundlagen und Charakteristika, Wandel in Familie sowie Religion, Herrschaft und Macht, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1223212