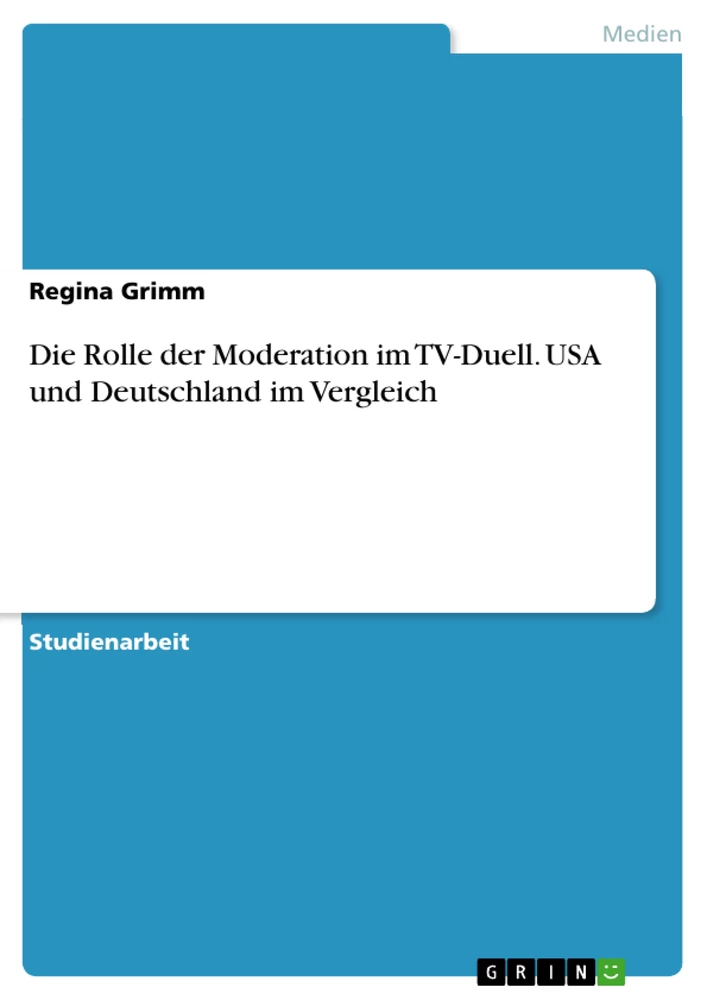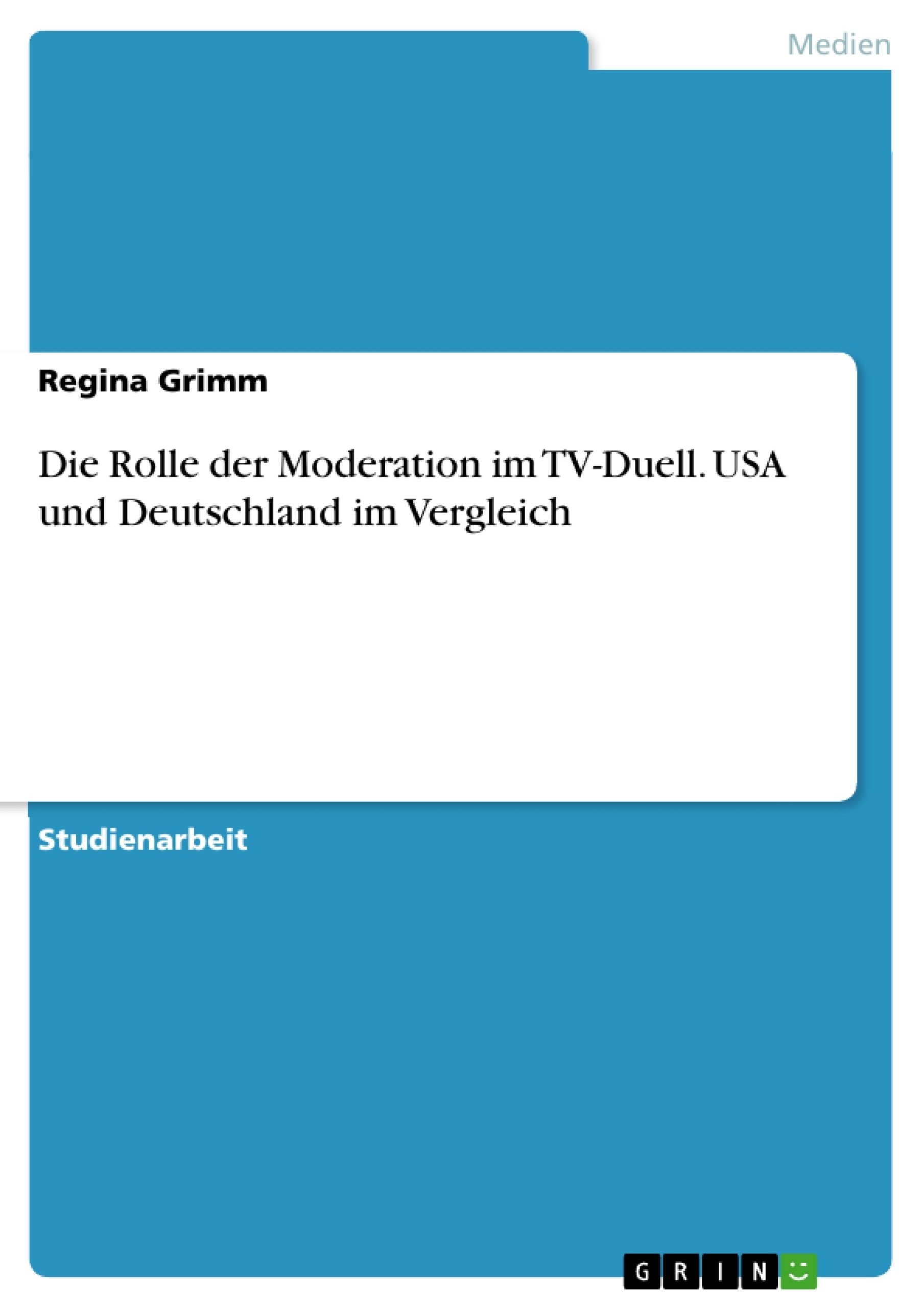In dieser Arbeit werden zwei konkrete Fernsehdebatten aus den USA und Deutschland im Hinblick auf die Rolle der Moderation analysiert und miteinander verglichen. Die Untersuchungsaspekte sind dabei die Rahmenbedingungen der Inszenierung, sowie die eigentliche Moderation und Interviewführung. Das Ziel ist es herauszuarbeiten, inwiefern sich die beiden Moderationsstile voneinander unterscheiden und wie dies zu erklären ist.
Seit der Präsidentschaftswahl 1960 in den USA diskutieren in sogenannten TV-Duellen die zwei aussichtsreichsten Kandidierenden für ein hohes politisches Amt die zentralen Themen des Wahlkampfs. Dabei informieren sie die Zuschauenden über ihre politische Positionierung und auch ihre eigene Person, selbstverständlich mit dem Ziel, ihre Position im Wahlkampf zu verbessern.
Die Aufgabe der moderierenden Person(en) ist es den Ablauf der Debatte zu strukturieren, durch ihre Fragen die Themenschwerpunkte festzulegen und für einen konstruktiven Verlauf der Sendung zu sorgen. Während zuvor sogenannte „Elefantenrunden“ mit mehreren Kandidierenden üblich waren, wird sich seit 2002 in Deutschland stärker an dem aus den USA stammenden Prinzip der „Great Debates“ orientiert, das auch eine direkte Auseinandersetzung der beiden politischen Akteurinnen und Akteure zulässt. Jedoch unterscheidet sich das amerikanische Wahlsystem deutlich vom bundesdeutschen. Während ersteres von zwei ähnlich starken Parteien dominiert wird und auf die persönliche Überzeugungskraft der beiden Kandidierenden zugeschnitten ist, herrscht in Deutschland ein diverseres Parteienklima. Zudem besteht in Deutschland im Gegensatz zu den USA auch die Möglichkeit auf eine große Koalition, also ein gemeinsames Regieren der Parteien der Kandidierenden.
Diese Unterschiede haben Auswirkungen auf den Charakter des TV-Duells und somit auch auf das Rollenverständnis der jeweiligen das Duell moderierenden Person(en). Inwiefern das der Fall ist und wie sich diese Unterschiede niederschlagen wird in dieser Arbeit untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Beispiele
- Mögliche Rollenverständnisse der Moderation
- Rahmenbedingungen
- Personenkonstellation
- Positionierung im Raum
- Moderation und Interviewführung
- Regelung der Redezeit
- Redeanteil der moderierenden Personen
- Anzahl und Charakter der Steuerungsaktionen
- Definition der Steuerungsaktionen
- Analyse
- Unterschiedliche Fragetypen
- Definition der Fragetypen
- Analyse
- Unterbrechungen und Störungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Rolle der Moderation im TV-Duell anhand eines Vergleichs zweier Fernsehdebatten aus den USA und Deutschland. Ziel ist es, die Unterschiede in den Moderationsstilen aufzuzeigen und diese Unterschiede im Kontext der jeweiligen Rahmenbedingungen und der politischen Systeme zu erklären.
- Analyse der Moderationsrollen im Vergleich
- Einfluss der Rahmenbedingungen auf die Moderation
- Unterschiede in den politischen Systemen und deren Auswirkungen auf TV-Duelle
- Auswertung der Moderationstechniken
- Vergleich der Gestaltung und Struktur der beiden Fernsehdebatten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema TV-Duelle ein und erläutert die Rolle der Moderation in diesem Kontext. Sie stellt die Relevanz des Themas dar und skizziert den Forschungsansatz.
- Beispiele: Dieses Kapitel präsentiert die beiden ausgewählten TV-Duelle, das amerikanische Duell zwischen Trump und Clinton sowie das deutsche Duell zwischen Merkel und Schulz, und beschreibt die relevanten Rahmenbedingungen.
- Mögliche Rollenverständnisse der Moderation: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Rollenverständnisse der Moderation in politischen Fernsehsendungen, insbesondere die Unterscheidung zwischen „Leiter“ und „Moderator“.
- Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel untersucht die Rahmenbedingungen der beiden TV-Duelle, einschließlich der Personenkonstellation und der Positionierung der Teilnehmer im Raum, und analysiert deren Einfluss auf die Moderation.
- Moderation und Interviewführung: Dieses Kapitel analysiert die Moderationstechniken, einschließlich der Regelung der Redezeit, des Redeanteils der moderierenden Personen, der Steuerungsaktionen, der Fragetypen und der Unterbrechungen und Störungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Moderation, TV-Duell, politische Fernsehsendungen, Wahlkampfkommunikation, Interviewführung, Rahmenbedingungen, Personenkonstellation, Positionierung im Raum, Redezeit, Steuerungsaktionen, Fragetypen, Unterbrechungen und Störungen. Im Vergleich werden die Besonderheiten des amerikanischen und deutschen Wahlsystems und deren Auswirkungen auf die Gestaltung von TV-Duelen beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich TV-Duelle in den USA und Deutschland?
US-Duelle sind stärker auf die persönliche Überzeugungskraft im Zweiparteiensystem zugeschnitten, während deutsche Duelle das diversere Parteienklima und Koalitionsmöglichkeiten widerspiegeln.
Welche Aufgaben hat die Moderation in einem politischen Duell?
Die Moderation strukturiert den Ablauf, setzt durch gezielte Fragen Themenschwerpunkte und sorgt für einen konstruktiven, regelkonformen Verlauf der Debatte.
Was ist der Unterschied zwischen einem "Leiter" und einem "Moderator"?
Ein Leiter führt eher technisch durch die Sendung, während ein Moderator aktiv durch Nachfragen und Steuerungsaktionen in den Diskurs eingreift.
Welchen Einfluss hat die Sitzordnung (Positionierung im Raum)?
Die räumliche Nähe oder Distanz zwischen den Kandidaten und Moderatoren beeinflusst die Dynamik der Konfrontation und die Wahrnehmung der Zuschauer.
Wie wird die Redezeit in TV-Duellen kontrolliert?
Oft gibt es strikte Zeitvorgaben pro Antwort, deren Einhaltung von den Moderatoren überwacht wird, um eine faire Verteilung der Redeanteile zu sichern.
- Citation du texte
- Regina Grimm (Auteur), 2020, Die Rolle der Moderation im TV-Duell. USA und Deutschland im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1223358