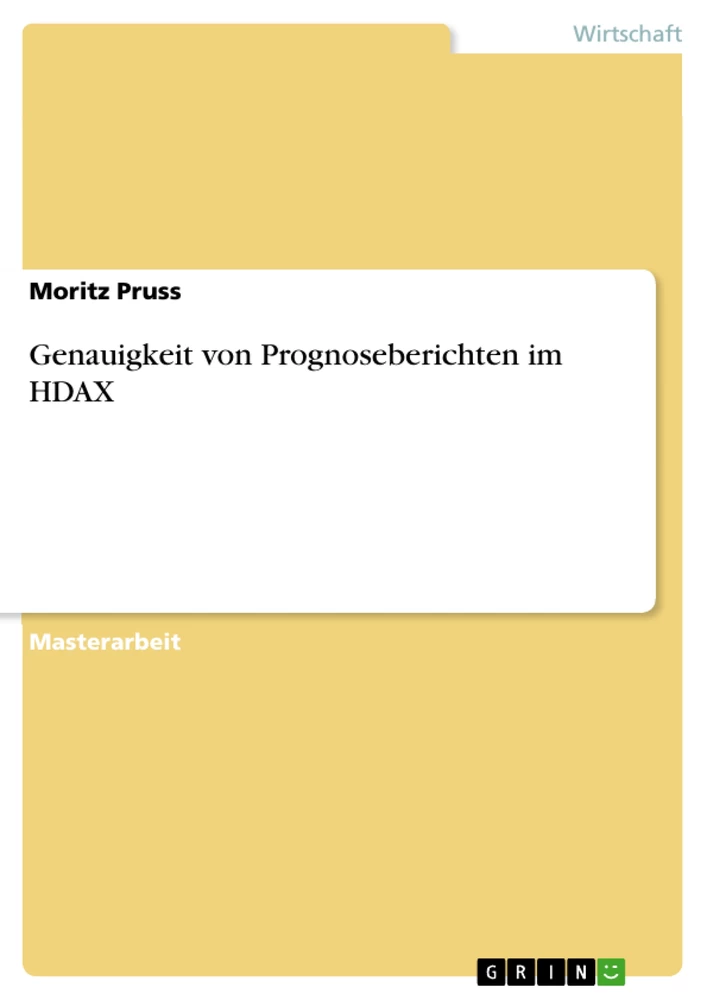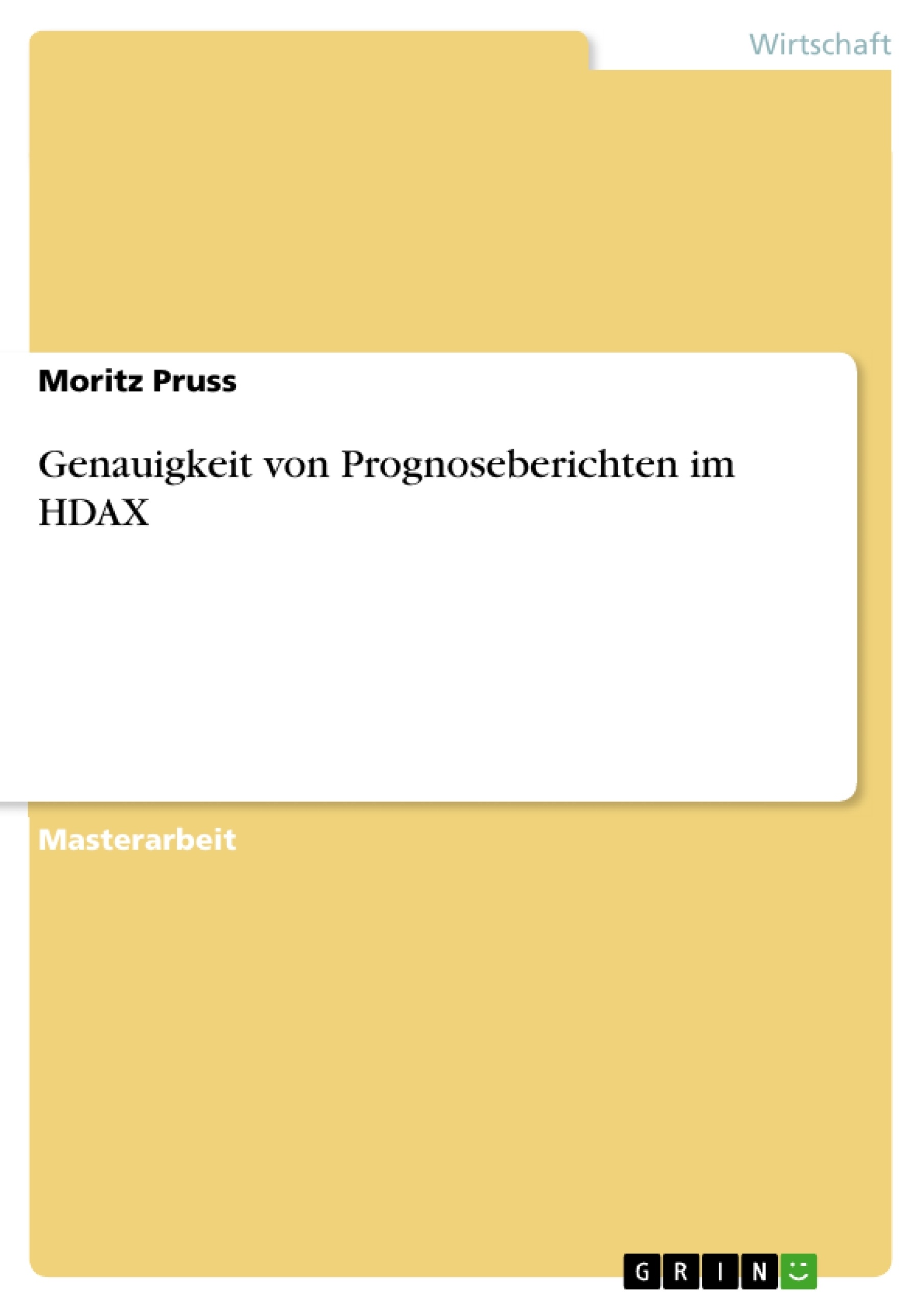Die vorliegende Untersuchung strebt an, den Schätzfehler von Analystenschätzungen mit der Normenkonformität des Prognoseberichts und weiteren Kontrollvariablen zu erklären, um die Bedeutung normenkonformer Berichterstattung für den Kapitalmarkt zu erforschen.
Managementprognosen sind eine wichtige Informationsquelle für Anleger. Zukunftsorientierten Informationen wie Prognosen wird bei der Anlageentscheidung mehr Bedeutung beigemessen als vergangenheitsorientierten Daten, da der verfolgte Zweck die Erzielung künftiger Renditen ist. Mit vergangenheitsorientierten Informationen ist es dem Anleger lediglich möglich, die eigenen Erwartungen respektiv mit der Realität abzugleichen. Die Bedeutung zukunftsorientierter Informationen für die Investitionsentscheidungen ist weitestgehend unumstritten.
Da das Management einen besseren Zugang zu entscheidungsrelevanten Informationen hat, existiert zwischen dem Management und den Anlegern eine Informationsasymmetrie. Managementprognosen helfen, diese Informationsasymmetrie zwischen Management und Anlegern zu verringern. Eine geringere Informationsasymmetrie drückt sich auch beim Unternehmen in einer erhöhten Liquidität und geringeren Kapitalkosten aus.
Eine zeitliche Komponente in der Berichterstattung des Unternehmens findet sich im Konzernabschluss durch die Einbeziehung von Prognosen im Lagebericht. Nach den Regelungen der International Financial Reporting Standards ist die Erstellung eines lageberichtsähnlichen Teils der Berichterstattung nicht verpflichtend. In Deutschland sind kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtet, einen Lagebericht nach den Regelungen des HGB aufzustellen unabhängig davon, ob diese ihren Bericht nach den International Financial Reporting Standards aufstellen. Die genaue Ausgestaltung des Prognoseberichts wird durch das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee (DRSC) im Deutschen Rechnungslegungs Standard (DRS) 20 konkretisiert. Die Ausgestaltung des DRS folgt dem Management Approach und vermittelt somit den Adressaten die Sicht des Managements, inklusive dessen Zugang zu internen Informationen über die künftige Entwicklung des Unternehmens.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Gang der Untersuchung
- 1.3 Überblick über den Stand der Forschung
- 2 Grundlagen der Prognoseberichterstattung börsennotierter Konzerne
- 2.1 Definition und Merkmale von Prognosen
- 2.2 Prognoseberichterstattung nach HGB
- 2.3 Aktuelle Regulierung der Prognoseberichterstattung gemäß DRS 206
- 2.3.1 Prognosegegenstand
- 2.3.2 Prognosehorizont und Prognosepräzision
- 2.3.3 Prognosetransparenz
- 2.3.4 Prognosen bei außergewöhnlich hoher Unsicherheit
- 3 Finanzanalysten
- 3.1 Definition und Aufgabenbereich
- 3.2 Managementprognosen und Analystenschätzungen
- 4 Grundlagen der empirischen Untersuchung
- 4.1 Datengrundlage
- 4.2 Untersuchungsmethodik
- 4.2.1 Güte der Prognoseberichte
- 4.2.2 Finanzanalystenschätzungen
- 4.2.3 Kontrollvariablen
- 4.2.4 Multivariate Analyse
- 5 Ergebnisse der empirischen Analyse
- 5.1 Deskriptive Statistik
- 5.1.1 Gesamtauswertung
- 5.1.2 Auswertung nach Indizes
- 5.1.3 Auswertung nach Branchen
- 5.2 Multivariate Analyse
- 6 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Genauigkeit von Prognoseberichten im HDAX. Das Hauptziel ist die empirische Analyse der Güte von Prognoseberichten börsennotierter Unternehmen und deren Vergleich mit Analystenschätzungen. Die Arbeit untersucht den Einfluss verschiedener Faktoren auf die Prognosegenauigkeit.
- Genauigkeit von Prognoseberichten im HDAX
- Vergleich von Managementprognosen und Analystenschätzungen
- Einfluss der Regulierung (DRS 206) auf die Prognosegenauigkeit
- Analyse der Prognoseberichtsqualität anhand verschiedener Kriterien
- Untersuchung der Prognosegenauigkeit in verschiedenen Branchen und Indizes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Prognoseberichterstattung im HDAX ein, beschreibt die Problemstellung der oft mangelnden Genauigkeit von Prognosen und benennt die Ziele der Untersuchung. Es skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu diesem Thema.
2 Grundlagen der Prognoseberichterstattung börsennotierter Konzerne: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es definiert Prognosen, beschreibt deren Merkmale und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen der Prognoseberichterstattung nach HGB und insbesondere die aktuelle Regulierung gemäß DRS 206. Die verschiedenen Aspekte der Prognoseberichterstattung wie Prognosegegenstand, -horizont, -präzision und -transparenz werden detailliert erläutert, insbesondere im Kontext von hoher Unsicherheit.
3 Finanzanalysten: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle von Finanzanalysten im Kontext von Prognoseberichten. Es definiert den Aufgabenbereich von Finanzanalysten und analysiert den Vergleich zwischen den Managementprognosen der Unternehmen und den unabhängigen Schätzungen der Analysten. Dieser Vergleich bildet eine wichtige Grundlage für die spätere empirische Untersuchung.
4 Grundlagen der empirischen Untersuchung: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die verwendeten Daten, die gewählte Untersuchungsmethodik (inklusive der Gütekriterien für Prognoseberichte, der Berücksichtigung von Analystenschätzungen und Kontrollvariablen) sowie die angewandte multivariate Analyse zur Überprüfung der Hypothesen.
5 Ergebnisse der empirischen Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Analyse, unterteilt in deskriptive Statistiken (Gesamtauswertung, Auswertung nach Indizes und Branchen) und die Ergebnisse der multivariaten Analyse. Es werden deskriptive Statistiken zur Prognosepräzision und zum Umfang der Prognoseberichte dargestellt und im Kontext von unterschiedlichen Indizes und Branchen analysiert. Die Ergebnisse der multivariaten Analyse liefern detaillierte Einblicke in die Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen und der Prognosegenauigkeit.
Schlüsselwörter
Prognosegenauigkeit, Prognoseberichterstattung, HDAX, DRS 206, Finanzanalysten, Analystenschätzungen, Managementprognosen, Empirische Untersuchung, Multivariate Analyse, Prognosepräzision, Prognosetransparenz, Gütekriterien.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Genauigkeit von Prognoseberichten im HDAX
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Genauigkeit von Prognoseberichten im HDAX (Hochdividenden-Aktienindex). Im Mittelpunkt steht der empirische Vergleich der Güte von Managementprognosen mit Analystenschätzungen und die Analyse des Einflusses verschiedener Faktoren auf die Prognosegenauigkeit.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die empirische Analyse der Genauigkeit von Prognoseberichten börsennotierter Unternehmen im HDAX und deren Vergleich mit den Schätzungen unabhängiger Finanzanalysten. Die Arbeit untersucht den Einfluss von Faktoren wie der Regulierung (DRS 206) und der Qualität der Prognoseberichte auf die Genauigkeit der Prognosen. Zusätzlich wird die Prognosegenauigkeit in verschiedenen Branchen und Indizes untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Genauigkeit von Prognoseberichten im HDAX, dem Vergleich von Managementprognosen und Analystenschätzungen, dem Einfluss der Regulierung (DRS 206), der Analyse der Prognoseberichtsqualität anhand verschiedener Kriterien und der Untersuchung der Prognosegenauigkeit in verschiedenen Branchen und Indizes.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Forschungsstand), Grundlagen der Prognoseberichterstattung (inkl. HGB und DRS 206), Finanzanalysten und deren Rolle, Grundlagen der empirischen Untersuchung (Methodologie, Daten, Analysemethoden), Ergebnisse der empirischen Analyse (deskriptive und multivariate Analyse) und Schlussbetrachtung.
Welche Methoden werden in der empirischen Untersuchung angewendet?
Die empirische Untersuchung basiert auf einer detaillierten Beschreibung der Methodik, einschließlich der verwendeten Daten, der Gütekriterien für Prognoseberichte, der Berücksichtigung von Analystenschätzungen und Kontrollvariablen. Zur Überprüfung der Hypothesen wird eine multivariate Analyse eingesetzt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse der empirischen Analyse werden in zwei Teile gegliedert: deskriptive Statistiken (Gesamtauswertung, Auswertung nach Indizes und Branchen) und die Ergebnisse der multivariaten Analyse. Es werden sowohl deskriptive Statistiken zur Prognosepräzision und zum Umfang der Prognoseberichte als auch detaillierte Einblicke in die Zusammenhänge zwischen den untersuchten Variablen und der Prognosegenauigkeit präsentiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Prognosegenauigkeit, Prognoseberichterstattung, HDAX, DRS 206, Finanzanalysten, Analystenschätzungen, Managementprognosen, Empirische Untersuchung, Multivariate Analyse, Prognosepräzision, Prognosetransparenz, Gütekriterien.
Welche Bedeutung hat DRS 206 für die Arbeit?
DRS 206 (Deutsches Rechnungslegungsstandard) beschreibt die aktuelle Regulierung der Prognoseberichterstattung. Die Arbeit untersucht den Einfluss dieser Regulierung auf die Genauigkeit der Prognosen.
Wie werden Managementprognosen und Analystenschätzungen verglichen?
Der Vergleich zwischen Managementprognosen und Analystenschätzungen bildet eine zentrale Grundlage der empirischen Untersuchung. Die Arbeit analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Prognosetypen und deren Einfluss auf die Prognosegenauigkeit.
- Citation du texte
- Moritz Pruss (Auteur), 2022, Genauigkeit von Prognoseberichten im HDAX, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1224063