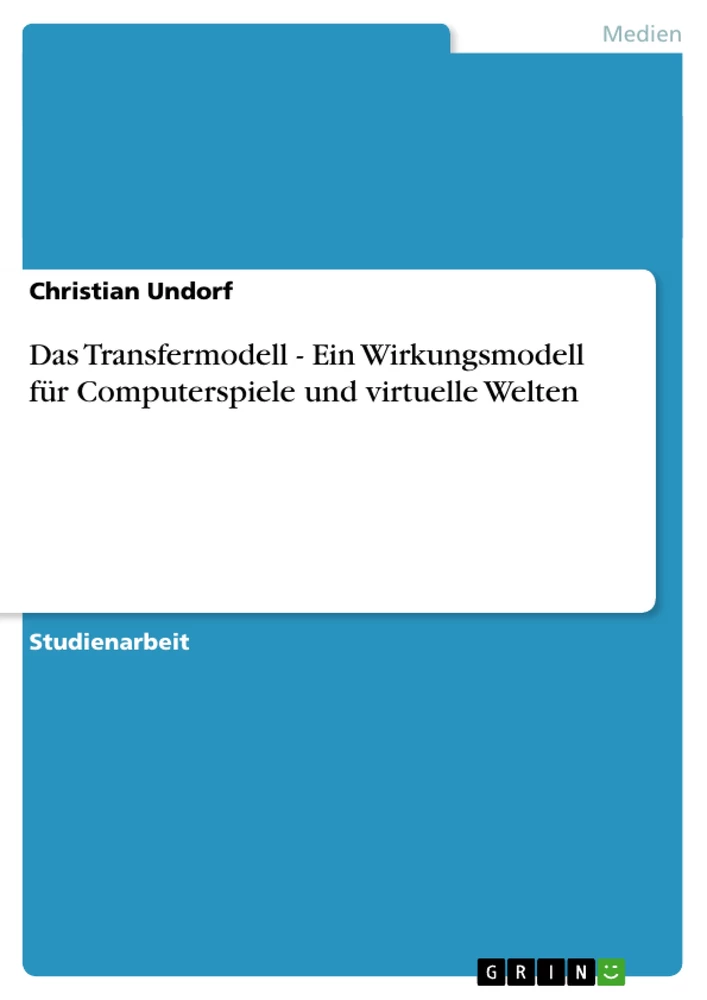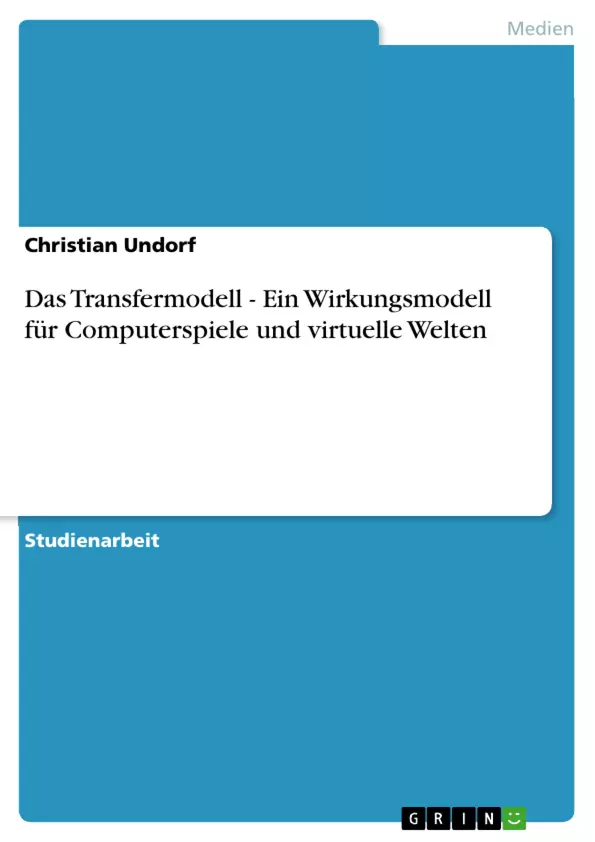Der Umgang mit dem Computer ist heutzutage eine Selbstverständlichkeit. Ob wir sie nun sehen können oder nicht – überall in unserem Alltag begegnen wir Computertechnik. Der Umgang bzw. das Bedienen von Computern ist somit zweifelsfrei zur Schlüsselkompetenz bzw. kulturellen Praxis geworden. Denn auch in unserer Freizeit haben Computer längst Einzug gehalten. Hier stehen wir nun aber offenbar vor einem Dilemma: Denn während vor allem Eltern, Erzieher und Pädagogen sich durchaus dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche im Umgang mit dem Computer als Arbeitsgerät gefördert werden, indem sie beispielsweise verstärkt in der Schule in den Unterricht mit einbezogen werden, so sieht die gleiche Gruppe es oftmals gar nicht gerne, wenn der Nachwuchs zum Freizeitvergnügen vor dem Bildschirm sitzt. Denn wird das Gerät zum reinen Spielen benutzt, weckt das nicht selten die Sorge bzw. Furcht, der Computer könne aggressiv machen oder zur Vereinsamung des Kindes führen. Werden Kinder oder Jugendliche hinsichtlich ihrer Gewaltbereitschaft besonders auffällig – trauriges Beispiel wären hier insbesondere die Schreckensszenarien von Amokläufen an Schulen – so dauert es meistens nicht lange, bis in den Medienberichten enthüllt wird, dass der oder die Täter mit Vorliebe stark gewalthaltige Computerspiele gespielt haben soll(en). In diesem Zusammenhang ist auch der inzwischen schon geläufige Begriff des „Killerspiels“ entstanden. So widmete der Kultursender ARTE am 28.07.08 einen ganzen Themenabend dem Zusammenhang zwischen Gewalt und Computerspielen. Als Überschrift für diese Sendestrecke wählte man provokativ "Digital spielen - Analog morden".
Nach einer kurzen, einleitenden Erörterung der Frage, was den Reiz des Spielens am Bildschirm eigentlich ausmacht, soll in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden, dass starre, monokausale Wirkungsmodelle die Prozesse während des Computerspiels nur unzureichend zu fassen und zu erklären vermögen. Anhand des von Jürgen Fritz und seinen Mitarbeitern auf der Basis herkömmlicher Lerntransfers entwickelten sog. „Transfermodells“ soll schließlich ein neuer Ansatz der Medienwirkungsforschung für Bildschirmspiele vorgestellt werden. Ein kleiner Exkurs zum „Encoding/Decoding“-Modell der Cultural Studies ergänzt die Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Reiz des Computerspielens
- Spielanlässe – warum werden Computerspiele gespielt?
- Über, Frust' und, Flow' – welche Emotionen begleiten das Spiel am Computer?
- Das Transfermodell
- Was sind,Transfers'?
- Wann finden Transfers statt?
- Der kulturwissenschaftliche Blick: Das Encoding/Decoding-Modell von Stuart Hall - ein Exkurs
- Medienaneignung im soziokulturellen Kontext
- Drei hypothetische Lesarten von Medientexten
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirkung von Computerspielen und virtuellen Welten. Sie hinterfragt einseitige Wirkungsmodelle und präsentiert das Transfermodell als alternativen Ansatz der Medienwirkungsforschung. Ein Exkurs zu Stuart Halls Encoding/Decoding-Modell ergänzt die Betrachtung der Medienaneignung.
- Der Reiz des Computerspielens und die damit verbundenen Motivationen
- Das Transfermodell als Erklärungsansatz für die Wirkung von Computerspielen
- Die Rolle von Macht und Ohnmacht im Spielerlebnis
- Emotionen wie Frustration und Flow im Kontext des Computerspielens
- Medienaneignung im soziokulturellen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die aktuelle Diskussion um Computerspiele und deren Wirkung vor, insbesondere im Hinblick auf Gewalt. Kapitel 2 untersucht die Motivationen hinter dem Computerspielen, fokussiert auf die Machtbalance und den Spielerfolg als zentrale Aspekte. Kapitel 3 beschreibt das Transfermodell als komplexeren Ansatz zur Analyse von Medienwirkungen. Kapitel 4 bietet einen Exkurs zum Encoding/Decoding-Modell von Stuart Hall, um die Medienaneignung im soziokulturellen Kontext zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Computerspiele, virtuelle Welten, Medienwirkungsforschung, Transfermodell, Encoding/Decoding-Modell, Macht, Ohnmacht, Spielerfolg, Frustration, Medienaneignung, soziokultureller Kontext.
- Quote paper
- Christian Undorf (Author), 2008, Das Transfermodell - Ein Wirkungsmodell für Computerspiele und virtuelle Welten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122413