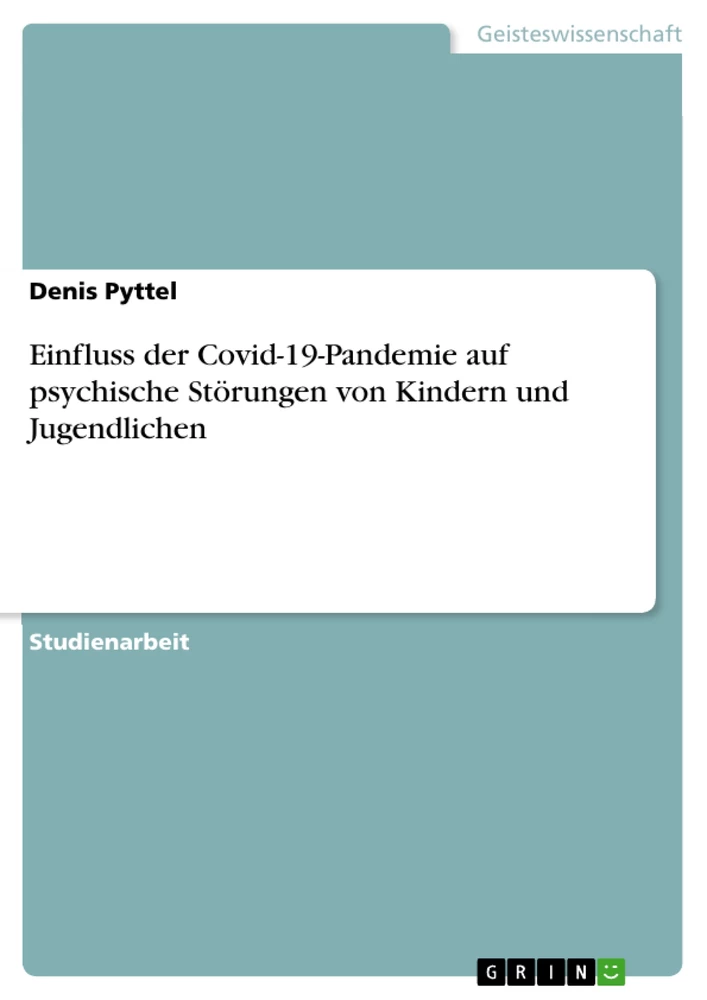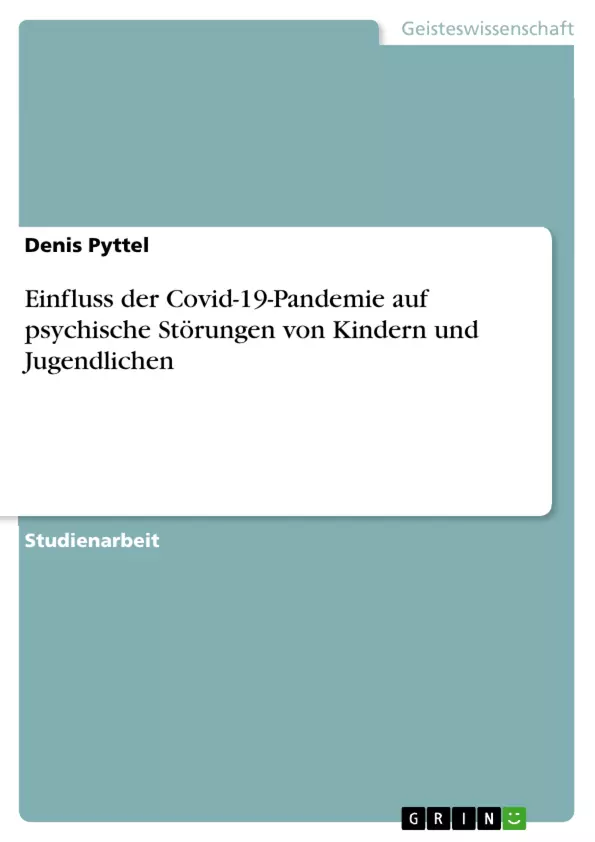Psychische Störungen sind sehr komplex und vielfältig, daher wird in Kapitel 2 ein Überblick über mögliche psychische Störungen aus dem Kindes- und Jugendalter gegeben. Dabei wird auf die Angststörungen, die Zwangsstörungen, die Ticsstörungen, die hyperkinetischen Störungen, der Störung des Sozialverhaltens, der umschriebenen Entwicklungsstörungen, der Depression, der Essstörungen und dem Substanzmissbrauch eingegangen und einen Vergleich (Gemeinsamkeiten und Unterschiede) zum Erwachsenenalter gemacht. Kapitel 3 beschäftigt sich nochmal mit der hyperkinetischen Störung ADHS, der umschriebenen Entwicklungsstörungen, sowie der Depression im Bezug zu Covid-19 Pandemie. Die Covid-19 Pandemie hat viele Menschen belastet, aber Kinder und Jugendliche, vor allem mit psychischen Störungen haben viel damit zu kämpfen gehabt, weshalb dieses Kapitel darüber aufklären soll, was für Auswirkungen die Pandemie hatte. Ziel dieser Arbeit ist es zu demonstrieren, wie vielfältig psychische Störungen sind, wie diese entstehen, aussehen und behandelt werden können, vor allem im Bezug zur Covid-19 Pandemie in Kapitel 3.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Störungen im Kindes- und Jugendalter
- Störungen im Kindesalter
- Angststörungen
- Zwangsstörung
- Ticstörung
- Hyperkinetische Störung
- Störung des Sozialverhaltens
- Umschriebene Entwicklungsstörungen
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit dem Erwachsenenalter
- Störungen im Jugendalter
- Depression
- Essstörung
- Substanzmissbrauch
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit dem Erwachsenenalter
- Zusammenfassung
- Störungen im Kindesalter
- Psychische Störungen während der Covid-19 Pandemie
- ADHS
- Umschriebene Entwicklungsstörungen
- Depression
- Zusammenfassung
- Diskussion
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Fallstudie analysiert den Einfluss der Covid-19-Pandemie auf psychische Störungen von Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild von der Vielfältigkeit psychischer Störungen, ihrer Entstehung, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten, insbesondere im Kontext der Pandemie, zu zeichnen.
- Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter: Überblick über verschiedene Störungsbilder wie Angststörungen, Zwänge, Tics, ADHS, Störungen des Sozialverhaltens, umschriebene Entwicklungsstörungen, Depression, Essstörungen und Substanzmissbrauch.
- Einfluss der Covid-19-Pandemie: Analyse der Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen, insbesondere im Hinblick auf ADHS, umschriebene Entwicklungsstörungen und Depression.
- Vergleich mit dem Erwachsenenalter: Darstellung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der Ausprägung und Behandlung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter im Vergleich zum Erwachsenenalter.
- Behandlungsmöglichkeiten: Vorstellung von Interventionen und Behandlungsansätzen für psychische Störungen im Kontext der Pandemie.
- Komplexität der Thematik: Betonung der Vielschichtigkeit und Komplexität psychischer Störungen und der Notwendigkeit einer professionellen Therapie bei Verdacht auf eine Störung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter ein und stellt die Relevanz der Thematik im Kontext der Covid-19-Pandemie heraus.
- Störungen im Kindes- und Jugendalter: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene psychische Störungen, die typischerweise im Kindes- und Jugendalter auftreten. Es werden u.a. Angststörungen, Zwänge, Tics, ADHS, Störungen des Sozialverhaltens, umschriebene Entwicklungsstörungen, Depression, Essstörungen und Substanzmissbrauch behandelt. Das Kapitel beinhaltet auch einen Vergleich dieser Störungen mit dem Erwachsenenalter.
- Psychische Störungen während der Covid-19 Pandemie: In diesem Kapitel wird der Fokus auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen gelegt, insbesondere auf ADHS, umschriebene Entwicklungsstörungen und Depression. Es werden die Herausforderungen und besonderen Belastungen für diese Personengruppe während der Pandemie erläutert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter, Covid-19-Pandemie, Entwicklungsstörungen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Tics, ADHS, Störungen des Sozialverhaltens, umschriebene Entwicklungsstörungen, Depression, Essstörungen, Substanzmissbrauch, Behandlungsansätze, Interventionen und die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat die Covid-19-Pandemie Kinder mit ADHS beeinflusst?
Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen (wie Homeschooling) stellten Kinder mit ADHS vor enorme Herausforderungen, da Routinen wegfielen und die Belastung im häuslichen Umfeld stieg.
Welche psychischen Störungen treten im Jugendalter häufig auf?
Häufige Störungen im Jugendalter sind Depressionen, Essstörungen und Substanzmissbrauch.
Gibt es Unterschiede bei psychischen Störungen zwischen Kindern und Erwachsenen?
Ja, Symptome können sich im Kindesalter anders äußern (z.B. somatische Beschwerden statt verbalisierter Traurigkeit bei Depressionen). Die Arbeit analysiert diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Was sind umschriebene Entwicklungsstörungen?
Dazu gehören beispielsweise Lese-Rechtschreib-Störungen oder Rechenstörungen, die durch die Schulschließungen während der Pandemie oft verstärkt wurden.
Was ist das Ziel dieser Fallstudie?
Ziel ist es aufzuklären, wie vielfältig psychische Störungen sind und welche spezifischen Auswirkungen die Covid-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit der jungen Generation hatte.
- Quote paper
- Denis Pyttel (Author), 2022, Einfluss der Covid-19-Pandemie auf psychische Störungen von Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1224538