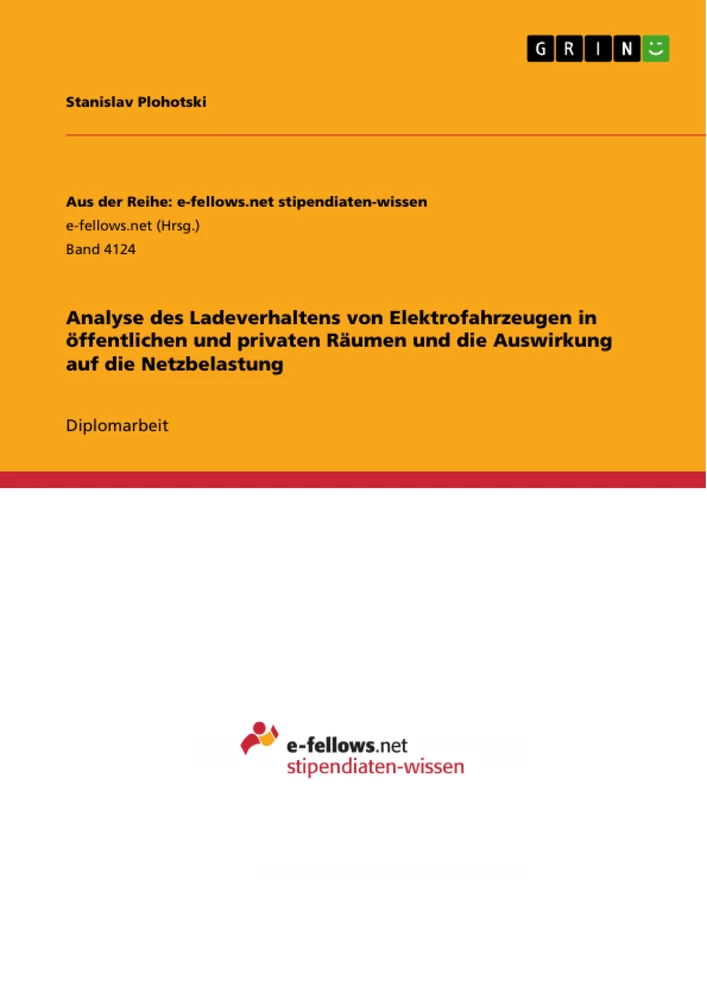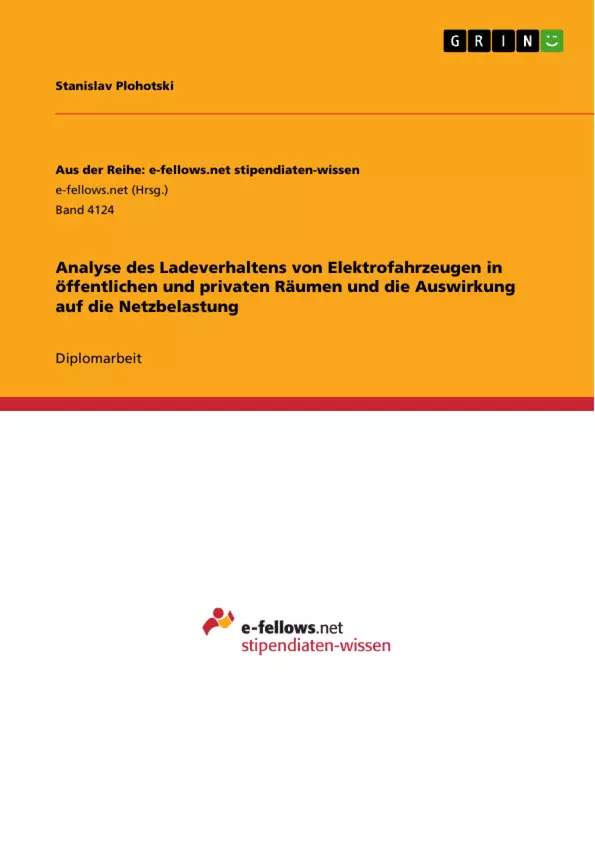In der vorliegenden Diplomarbeit wird das Ladeverhalten von privaten und gewerblichen Elektrofahrzeugen in der Region Stuttgart untersucht. Für diese Analyse werden 20 Fahrzeuge für einen Zeitraum von neun Monaten in einem Flottenversuch betrieben. Die Probanden haben dabei die Möglichkeit, das Fahrzeug an einer heimischen Wallbox und an öffentlichen Ladestationen zu laden, die durch einen regionalen Energieversorger bereitgestellt und überwacht werden.
Die aufgezeichneten Daten werden in einem ersten Schritt bereinigt und anschließend zu einem kombinierten Datensatz zusammengeführt, mit dem sich das Ladeverhalten der Flotte charakterisieren lässt. Eine der grundlegenden Fragestellungen ist die Einteilung der Probanden in charakteristische Nutzergruppen anhand ihres Ladeverhaltens.
Insbesondere werden nachfolgende Schwerpunkte des Ladens untersucht:
Bei der Analyse des Ladeverhaltens wird neben den Anteilen an privaten und öffentlichen Ladevorgängen auch der Beginn der Ladevorgänge, die Steckdauer sowie die tatsächliche Nutzung der bereitgestellten öffentlichen Ladeinfrastruktur betrachtet. Die technische Analyse beschreibt die während eines Ladevorgangs in der Fahrzeugbatterie ab-laufenden Prozesse und zeigt die daran beteiligten Kenngrößen auf. Dieser Analyse-Abschnitt projiziert auch das im Flottenversuch vorliegende Ladeverhalten auf Batterielebensdauer senkende Faktoren. Mittels des Zusammenspiels zwischen dem Ladepunkt und dem Elektrofahrzeug wird der Wirkungsgrad für einen Ladevorgangs ermittelt. Weiterhin wird der Einfluss der Außentemperatur auf unterschiedliche Aspekte des Ladens betrachtet.
Der Erlös eines Energieversorgers durch ein Elektrofahrzeug wird bei der energiewirtschaftlichen Analyse dargelegt. Darin wird weiterhin der Energiebedarf an unterschiedlichen Wochentagen sowie über den Tagesverlauf betrachtet um daraus ein Lastprofil für ein Elektrofahrzeug abzuleiten. In Verbindung mit einem H0-Standardlastprofil wird ein kombiniertes Lastprofil für ein 4-Personen-Haushalt mit Elektrofahrzeug erstellt.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Arbeit ist eine Betrachtung der Fahrzeugverfügbarkeit am Netz und des resultierenden Energiepufferpotenzials. Die Verfügbarkeit und das Pufferpotenzial werden auf ein Elektromobilitätsszenario 2020 projiziert und die resultierenden energiewirtschaftlichen Implikationen für Ladelastverschiebung und bidirektionales Laden abgeleitet.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Kurzfassung
- Abstract
- 1. Einleitung
- 1.1. Motivation und Ziel der Arbeit
- 1.2. Fachgebiet der Arbeit
- 1.3. Zielstellung
- 1.4. Lösungsansatz
- 1.5. Gliederung der Arbeit
- 2. Gegenwart und Zukunft der Elektromobilität
- 2.1. Aspekte der Elektromobilität
- 2.2. Infrastruktur in Deutschland
- 2.2.1. Aktuelle Situation
- 2.2.2. Zukünftige Herausforderungen
- 2.3. Das Projekt Audi NEoS
- 3. Theoretische Analysegrundlagen
- 3.1. Statistische Grundlagen
- 3.1.1. Lebensdaueranalyse
- 3.1.2. Kernel Density Estimation
- 3.2. Technische Grundlagen
- 3.2.1. Energiespeicher und -systeme
- 3.3. Energiewirtschaftliche Grundlagen
- 3.3.1. Belastungsdarstellung
- 3.3.2. Stromhandel und Strompreisentstehung auf dem EPEX-Spotmarkt
- 3.1. Statistische Grundlagen
- 4. Arbeitsrahmen
- 4.1. Infrastruktur
- 4.1.1. Der Audi A1 e-tron
- 4.1.2. Die private EnBW-Wallbox
- 4.1.3. Die öffentliche EnBW-Ladestation
- 4.2. Messtechnik und Rohdatenzusammenstellung
- 4.2.1. Fahrzeugspezifische Rohdaten
- 4.2.2. Backendspezifische Rohdaten
- 4.1. Infrastruktur
- 5. Rohdatenaufbereitung
- 5.1. Rohdatenstruktur
- 5.1.1. Grundsätzlicher Datensatzaufbau
- 5.1.2. Fahrzeugspezifischer Datensatz
- 5.1.3. Backendspezifischer Datensatz
- 5.1.4. Ergänzende Datenstrukturen
- 5.2. Datensatzkombination
- 5.3. Analysestruktur
- 5.1. Rohdatenstruktur
- 6. Datenanalyse
- 6.1. Analyse des Ladeverhaltens
- 6.1.1. Nutzungsverteilung der Ladeinfrastruktur
- 6.1.2. Ladebeginn
- 6.1.3. Wöchentlicher Ladebeginn
- 6.1.4. Steckdauer
- 6.1.5. Öffentliche Infrastrukturnutzung
- 6.2. Technische Analyse
- 6.2.1. Der vollhubige Ladevorgang
- 6.2.2. Belastung auf Batterielebensdauer
- 6.2.3. Temperatureinfluss
- 6.2.4. Wirkungsgrad
- 6.3. Energiewirtschaftliche Analyse
- 6.3.1. Strompreis am EPEX-Spotmarkt
- 6.3.2. Umsatz für den Energieversorger
- 6.3.3. Energiebedarf
- 6.3.4. Lastprofil des Flottenversuchs
- 6.1. Analyse des Ladeverhaltens
- 7. Implikationen für die Energiewirtschaft
- 7.1. Verfügbarkeitspotenzial
- 7.2. Energiespeicherpozenzial
- 7.3. Prognose 2020
- 8. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse des Ladeverhaltens von privaten und gewerblichen Elektrofahrzeugen in der Region Stuttgart, basierend auf Daten eines Flottenversuchs. Ziel ist es, das Ladeverhalten der Flotte zu charakterisieren, charakteristische Nutzergruppen zu identifizieren und die Auswirkungen auf technische und energiewirtschaftliche Aspekte zu untersuchen. Zu den Schwerpunkten gehören die Nutzung der Ladeinfrastruktur, die technischen Parameter des Ladevorgangs, die Batterielebensdauer, die Netzbelastung und das Potenzial für Lastverschiebung und bidirektionales Laden.
- Charakterisierung des Ladeverhaltens von Elektrofahrzeugen im Flottenversuch
- Identifizierung von Nutzergruppen mit unterschiedlichem Ladeverhalten
- Analyse technischer Einflussfaktoren auf den Ladevorgang und die Batterielebensdauer
- Ermittlung der Netzbelastung durch das Laden von Elektrofahrzeugen
- Bewertung des Potenzials für Lastverschiebung und bidirektionales Laden
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Einleitung
- Motivation und Ziel der Arbeit
- Fachgebiet und Projektpartner
- Zielstellung der Arbeit
- Lösungsansatz und Gliederung
- Kapitel 2: Gegenwart und Zukunft der Elektromobilität
- Definition der Elektromobilität
- Wirtschaftliche, politische und ökologische Aspekte
- Aktuelle Situation und Herausforderungen der Infrastruktur
- Zukünftige Ladekonzepte und die Bedeutung von Smart Grids
- Das Projekt Audi NEoS
- Kapitel 3: Theoretische Analysegrundlagen
- Statistische Grundlagen: Lebensdaueranalyse, KDE, Hypothesentests
- Technische Grundlagen: Energiespeicher, Batterietechnik, Lebensdauer von Li-Ion Batterien
- Energiewirtschaftliche Grundlagen: Lastprofile, Stromhandel am EPEX-Spotmarkt
- Kapitel 4: Arbeitsrahmen
- Beschreibung der Infrastruktur: Audi A1 e-tron, EnBW-Wallboxen, öffentliche Ladestationen
- Messtechnik: Datenlogger, ISZ, Backend-Systeme
- Rohdatenzusammenstellung und Auswertungszeitraum
- Kapitel 5: Rohdatenaufbereitung
- Datenstruktur und Import in Matlab
- Filterkriterien zur Bereinigung der Rohdaten
- Kombination der Daten aus verschiedenen Quellen
- Aufbau der Datenstruktur für die Analyse
- Kapitel 6: Datenanalyse
- Analyse des Ladeverhaltens: Nutzergruppen, Ladebeginn, Steckdauer, Nutzung der öffentlichen Ladeinfrastruktur
- Technische Analyse: Vollhubiger Ladevorgang, Batterielebensdauer, Temperatureinfluss, Wirkungsgrad
- Energiewirtschaftliche Analyse: Strompreis, Umsatz, Energiebedarf, Lastprofile
- Kapitel 7: Implikationen für die Energiewirtschaft
- Verfügbarkeitspotenzial: Steckdauer, Fahrzeugverfügbarkeit
- Energiespeicherpotenzial: Energiequelle, Energiesenke, Lastspiel
- Prognose 2020: Energiespeicherkapazität, Energiequelle, Lastverschiebung
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Ladeverhalten von Elektrofahrzeugen, dem Einfluss des Ladeverhaltens auf die Batterielebensdauer und den energiewirtschaftlichen Implikationen. Schlüsselwörter umfassen die Themenbereiche Elektromobilität, Ladeverhalten, Ladeinfrastruktur, Batterielebensdauer, Lastverschiebung, bidirektionales Laden, Smart Grids und die Analyse von empirischen Daten aus einem Flottenversuch.
Häufig gestellte Fragen
Wo laden Elektroautofahrer am häufigsten?
Die Studie zeigt, dass ein Großteil der Ladevorgänge an privaten Wallboxen zu Hause stattfindet, ergänzt durch öffentliche Ladestationen.
Wie beeinflusst das Laden das Stromnetz?
Gleichzeitiges Laden vieler Fahrzeuge, besonders am frühen Abend, kann zu Lastspitzen führen, die durch intelligentes Lademanagement abgemildert werden müssen.
Was ist bidirektionales Laden?
Dabei kann das Elektrofahrzeug nicht nur Strom aufnehmen, sondern bei Bedarf auch Energie zurück ins Stromnetz oder ins Haus einspeisen.
Welchen Einfluss hat die Temperatur auf den Ladevorgang?
Extreme Außentemperaturen können den Wirkungsgrad beim Laden senken und die Batterielebensdauer sowie die Reichweite beeinflussen.
Was ist das Projekt Audi NEoS?
Ein Flottenversuch in der Region Stuttgart, der das reale Ladeverhalten von Elektrofahrzeugen wie dem Audi A1 e-tron wissenschaftlich untersucht hat.
- Quote paper
- Stanislav Plohotski (Author), 2014, Analyse des Ladeverhaltens von Elektrofahrzeugen in öffentlichen und privaten Räumen und die Auswirkung auf die Netzbelastung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1224811