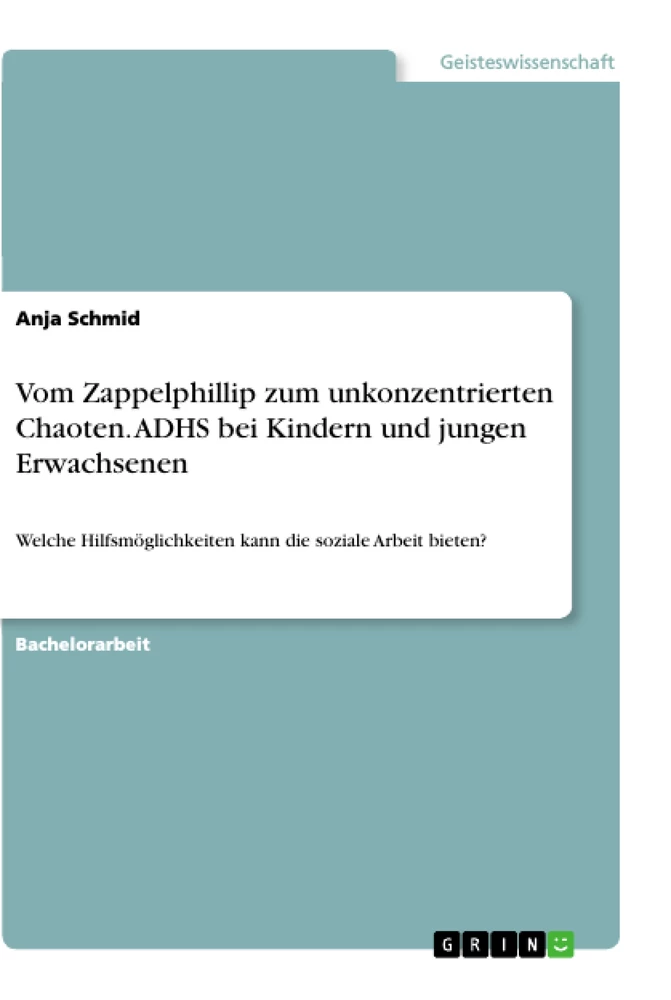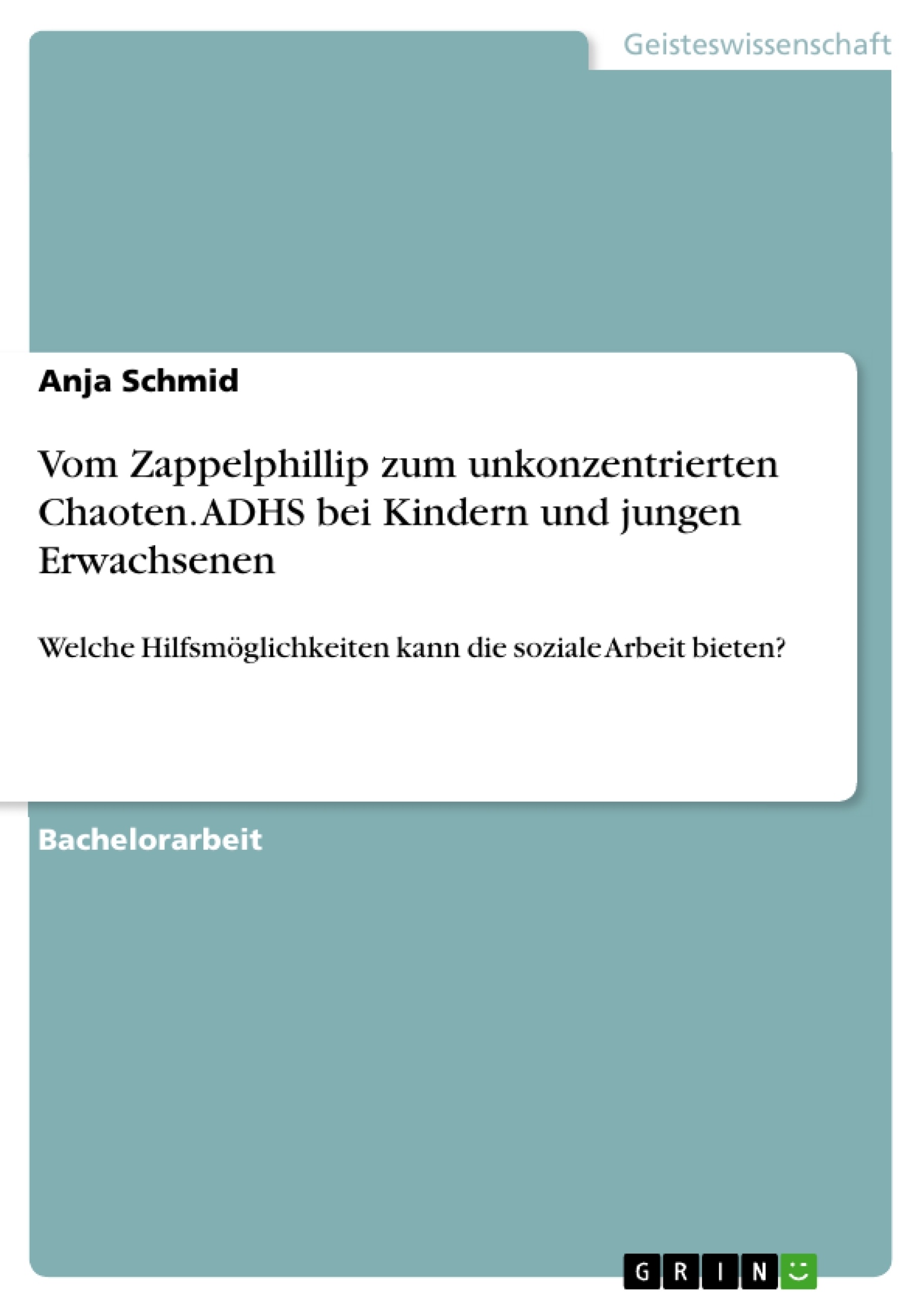Anfänglich werde ich Näheres zum ersten Psychiater Heinrich Hoffmann erläutern, der sich erstmals mit der Störung des impulsiven Kindes, dem Struwwelpeter, beschäftigte und durch weitere populäre Bilderbuchgeschichten sowie weltweit bekannte Gedichte berühmt wurde. Weiterhin gibt es einen kurzen Einblick darüber, in wieweit und in welchen Ländern ADHS auftritt und diagnostiziert wird. Es folgt die Erklärung, wie sich der Zappelphillip zum unkonzentrierten Chaoten entwickelte. Erläutert wird dies anhand des Krankheitsbildes, sowie durch die verschiedenen Alterstufen von „ADHS im Kindes und Jugendalter“.
Anschließend gehen die Ausführungen in den Bereich der verschiedenen Klassifikationen nach dem ICD-10 und dem DSM-IV. Im Allgemeinen führe ich dazu die Diagnoseverfahren auf. Danach folgen die Pathogenese, die verschiedenen Äthiologischen Faktoren sowie die Komorbidität. Weiterhin wird der Teil der Beeinträchtigungen zum Thema, die die Kinder und Jugendlichen aufgrund der Störung haben. Da es im Alltag zwischen Eltern und Kindern oft schwierig ist, möchte ich noch näher auf den Alltag der Jugendlichen mit ADHS eingehen und welche Schwierigkeiten sie heutzutage haben.
Danach folgt der Therapieteil, der die verschiedenen Diäten enthält, sowie die zahlreichen Forschungen auf diesem Gebiet und deren Erkenntnisse. Da die Therapie sehr weit reichend ist und mehrere Bereiche umfasst, wird ein weiterer Abschnitt dieser Arbeit die Medikamente, deren Nebenwirkungen und die Untersuchungen auf diesem Gebiet näher beleuchten. Da es immer öfter auch negative Schlagzeilen zu ADHS gibt, habe ich diese ebenso mit in diese Arbeit aufgenommen und mich mit den Irrtümern,
Missverständnissen, Mythen, Kritikern und deren Äußerungen beschäftigt, sowie Presseberichte des vergangenen Jahres aufgezeigt.
Darüber hinaus werden Hilfsmöglichkeiten für Eltern und geeignete Erziehungskonzepte beleuchtet, um das Zusammenleben der Familie harmonisch gestalten zu können. Der letzte Teil beschäftigt sich mit der empirischen Studie, dem Fremdbeobachtungsbogen für Lehrer, Sozialpädagogen und Erzieher und mit dem Auswertungsteil und seinen dazugehörigen Thesen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von Aufmerksamkeit
- 2.1 Was man unter Aufmerksamkeit versteht?
- 3. ADHS im Kindes- und Jugendalter
- 3.1 Definition
- 3.1.1 Aufmerksamkeitsdefizit ohne Hyperaktivität (ADS)
- 3.1.2 Aufmerksamkeitsdefizit mit Hyperaktivität (ADHS)
- 3.2 Wie oft treten die Aufmerksamkeitsstörungen auf?
- 3.3 Wer ist besonders gefährdet, ein ADHS zu entwickeln?
- 3.3.1 Merkmale der Eltern und der Familien
- 3.3.2 Merkmale der Schwangerschaft
- 3.3.3 Merkmale in der frühen Kindheit
- 3.4 Die verschiedenen Alterstufen und deren klinisches Bild
- 3.4.1 Kleinkindalter (0 bis ca. 4 Jahre)
- 3.4.2 Kindergartenalter (ca. 3-5 Jahre)
- 3.4.3 Jüngere Schulkinder (ca. 6-10 Jahre)
- 3.4.4 Ältere Schulkinder (ca. 11-14 Jahre)
- 3.4.5 Jugendliche (ca. 15-20 Jahre)
- 3.5 Der Drang nach dem Extremen
- 3.5.1 Die Folgen für die Psyche
- 3.6 Mädchen mit ADHS
- 3.6.1 Wie reagieren Mädchen mit ADHS
- 3.6.2 Die Probleme, die Mädchen mit ADHS haben, ...
- 3.7 Verschwinden Aufmerksamkeitsstörungen von alleine?
- 3.1 Definition
- 4. Klassifikationen
- 4.1 Die Veränderung der Aufmerksamkeitsstörung und ihre Erkenntnisse
- 4.2 Die Klassifikation nach dem ICD-10
- 4.3 Das multiaxiale Klassifikationsschema anhand eines Beispiels
- 4.4 Typische Merkmale einer Aufmerksamkeitsstörung
- 4.4.1 Die Grundmerkmale am Beispiel von Nicolas
- 4.4.2 Aufmerksamkeitsschwäche - „ablenkbar und nicht bei der Sache“
- 4.4.3 Impulsivität und Überaktivität - „aufgedreht und chaotisch!“
- 4.4.4 Ein weiteres Beispiel wie chaotisch und gefährlich diese Kinder handeln
- 5. Diagnose
- 5.1 Wie wird die Diagnose gestellt?
- 5.2 Diagnosemethoden von denen abgeraten wird
- 6. Pathogenese/Ätiologische Faktoren
- 6.1 Zwillingsforschung
- 6.2 Prä- und Perinatale Faktoren
- 6.3 Nahrungsmittelallergie
- 6.4 Neuropsychologische Befunde
- 6.5 Neurochemische Befunde
- 6.6 Botenstoffe im Gehirn (Neurotransmitter)
- 6.7 Umweltfaktoren
- 6.8 Komorbidität
- 7. Die Auswirkungen
- 7.1 Die alltäglichen Beeinträchtigungen
- 7.2 Die weiteren Folgen
- 7.3 Lernstörungen
- 7.4 Die Soziale Schwierigkeit und Aggressivität bei Kindern
- 7.5 Die Stimmungsschwankungen und Ängste bei Kindern
- 7.6 Kaspern und Meidungsverhalten
- 7.7 Die besonderen Fähigkeiten und Begabungen von ADHS-Kindern und Jugendlichen
- 8. Der Alltag mit schwierigen ADHS-Jugendlichen
- 8.1 Warum ist es heute so schwierig für Jugendliche mit ADHS?
- 8.2 Die neuen Medien
- 8.3 Schulsituation
- 9. Therapie
- 9.1 Die verschiedenen Ansätze im diätischen Bereich
- 9.1.1 Die Feingold-Diät (nach Ben Feingold)
- 9.1.2 Die Hafer-Diät nach Herta Hafer
- 9.1.3 Die oligo-antigene Diät nach Egger
- 9.1.4 Fettsäuren und ihre langkettigen, mehrfach ungesättigten Derivate nach Richardson und Puri
- 9.2 Wie wirksam sind die Diättherapien wirklich?
- 9.2.1 Die Untersuchungen
- 9.3 Die Medikamente oder anders formuliert: „Wenn’s doch hilft… Was spricht dann dagegen?“
- 9.3.1 Was man bisher versucht hat - zur Geschichte der medikamentösen Behandlung
- 9.4 Der heutige Stand der Medikation
- 9.4.1 Die einzelnen Medikamente
- 9.4.2 Herzklopfen, Schwindel?.... Nebenwirkungen?
- 9.4.3 Monoaminooxidasehemmer, Beispielsweise Aurorix (Roche)
- 9.4.4 Imipramin z.B. Tofranil (Novartis), Desipramin, z.B. Perofran (Novartis)
- 9.4.5 Fenetyllin, z.B. Captagon (Asta Medica)
- 9.4.6 Amphetaminil, z.B. AN 1 (Krugmann)
- 9.5 Kaffee??? Cola??? Was bewirkt das?
- 9.6 Fazit
- 9.1 Die verschiedenen Ansätze im diätischen Bereich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes- und Jugendalter. Ziel ist es, ein breites Verständnis der Störung zu vermitteln, von den diagnostischen Kriterien über die ätiologischen Faktoren bis hin zu den therapeutischen Ansätzen. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Herausforderungen im Alltag betroffener Kinder und Jugendlicher sowie der Unterstützungsmöglichkeiten für Eltern und Fachkräfte.
- Definition und Klassifizierung von ADHS
- Ätiologische Faktoren und Pathogenese von ADHS
- Auswirkungen von ADHS auf den Alltag und die Entwicklung
- Therapeutische Ansätze und medikamentöse Behandlung
- Hilfestellungen für Eltern und Fachkräfte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung liefert einen Überblick über die gesamte Arbeit und skizziert die Themen, die im Folgenden behandelt werden. Sie führt den Leser ein in die Thematik der ADHS und bereitet ihn auf die detaillierten Ausführungen in den nachfolgenden Kapiteln vor. Besonderer Fokus liegt auf der historischen Entwicklung der Betrachtung von impulsiven Kindern und der weltweiten Verbreitung der Diagnose ADHS.
3. ADHS im Kindes- und Jugendalter: Dieses Kapitel definiert ADHS und ADS, beleuchtet die Häufigkeit der Störung und die Risikofaktoren für deren Entstehung. Es beschreibt das klinische Bild der Störung in verschiedenen Altersgruppen, von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter, und untersucht die spezifischen Herausforderungen, denen Mädchen mit ADHS begegnen. Die Ausführungen berücksichtigen die Entwicklung des Kindes und die sich ändernden Symptome und Herausforderungen in den jeweiligen Lebensphasen.
4. Klassifikationen: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Klassifizierungssystemen für ADHS, insbesondere dem ICD-10. Es werden die diagnostischen Kriterien detailliert erläutert und anhand von Beispielen verdeutlicht. Ein wichtiger Aspekt ist die Darstellung der typischen Merkmale einer Aufmerksamkeitsstörung, wie Aufmerksamkeitsschwäche, Impulsivität und Hyperaktivität. Das Kapitel vergleicht und kontrastiert verschiedene diagnostische Ansätze und betont die Wichtigkeit einer differenzierten Betrachtung.
5. Diagnose: In diesem Kapitel werden die Methoden der ADHS-Diagnostik detailliert besprochen. Es wird ein klarer Fokus auf bewährte diagnostische Verfahren gelegt und gleichzeitig vor ungeeigneten Methoden gewarnt. Die wichtigsten Aspekte zur Durchführung einer zuverlässigen Diagnose werden herausgestellt, um Missverständnisse und Fehldiagnosen zu vermeiden.
6. Pathogenese/Ätiologische Faktoren: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Ursachen von ADHS. Es werden verschiedene Theorien und Forschungsergebnisse zu genetischen Faktoren (Zwillingsforschung), pränatalen und perinatalen Einflüssen, Nahrungsmittelallergien, neuropsychologischen und neurochemischen Befunden sowie Umweltfaktoren und Komorbidität präsentiert. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand und betont die Komplexität der Ursachen von ADHS.
7. Die Auswirkungen: Dieses Kapitel beleuchtet die vielfältigen Auswirkungen von ADHS auf den Alltag betroffener Kinder und Jugendlicher. Es werden die Beeinträchtigungen in verschiedenen Lebensbereichen wie Schule, Sozialkontakten und Familie beschrieben. Besondere Aufmerksamkeit wird den emotionalen und psychischen Folgen wie Stimmungsschwankungen, Ängsten und Schwierigkeiten im sozialen Umgang gewidmet. Das Kapitel hebt auch die Bedeutung der individuellen Stärken und Begabungen von Kindern und Jugendlichen mit ADHS hervor.
8. Der Alltag mit schwierigen ADHS-Jugendlichen: Dieses Kapitel fokussiert auf die besonderen Herausforderungen im Alltag von Jugendlichen mit ADHS. Es beleuchtet die Einflüsse der modernen Medien und die spezifischen Schwierigkeiten in der Schulsituation. Das Kapitel bietet Einblicke in die Perspektiven und Erfahrungen von Jugendlichen mit ADHS und deren Familien, um ein umfassendes Verständnis für die täglichen Herausforderungen zu schaffen.
9. Therapie: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Therapieansätze bei ADHS, darunter diätetische Maßnahmen (z.B. Feingold-Diät, Hafer-Diät, oligo-antigene Diät) und die medikamentöse Behandlung. Es werden die Wirksamkeit der verschiedenen Ansätze diskutiert, die Vor- und Nachteile der Medikamente erörtert und die Nebenwirkungen detailliert beschrieben. Es wird auf die Geschichte der medikamentösen Behandlung eingegangen und der aktuelle Stand der Medikation dargestellt. Das Kapitel schließt mit einem Fazit zur Therapie von ADHS.
Schlüsselwörter
ADHS, ADS, Aufmerksamkeitsstörung, Hyperaktivität, Impulsivität, Diagnose, Klassifikation, ICD-10, Ätiologie, Pathogenese, Therapie, Medikamente, Nebenwirkungen, Alltag, Schule, Familie, Kinder, Jugendliche, Komorbidität, Sozialverhalten, Lernstörungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes- und Jugendalter"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes- und Jugendalter. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, sowie Schlüsselwörter. Die einzelnen Kapitel behandeln Definition und Klassifizierung von ADHS, ätiologische Faktoren, Auswirkungen auf den Alltag, verschiedene Therapieansätze (inklusive diätetischer Maßnahmen und medikamentöser Behandlung) und geben Hilfestellungen für Eltern und Fachkräfte.
Was wird unter ADHS und ADS verstanden?
Das Dokument definiert ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und ADS (Aufmerksamkeitsdefizitstörung) und differenziert zwischen diesen beiden Formen der Störung. Es erläutert die Symptome und deren Ausprägung in verschiedenen Altersgruppen.
Wie häufig tritt ADHS auf und wer ist besonders gefährdet?
Die Häufigkeit von ADHS wird im Dokument beschrieben, ebenso wie Risikofaktoren, einschließlich elterlicher Merkmale, Merkmale der Schwangerschaft und der frühen Kindheit.
Wie äussert sich ADHS in verschiedenen Altersstufen?
Das Dokument beschreibt das klinische Bild von ADHS im Kleinkindalter, Kindergartenalter, im jüngeren und älteren Schulalter sowie im Jugendalter. Es werden die alterspezifischen Herausforderungen und Symptome beleuchtet.
Wie wird ADHS diagnostiziert?
Das Dokument beschreibt die Methoden der ADHS-Diagnostik, nennt bewährte Verfahren und warnt vor ungeeigneten Methoden. Es betont die Wichtigkeit einer zuverlässigen Diagnose zur Vermeidung von Fehldiagnosen.
Welche Ursachen werden für ADHS diskutiert?
Das Dokument untersucht verschiedene ätiologische Faktoren, darunter genetische Faktoren (Zwillingsforschung), pränatale und perinatale Einflüsse, Nahrungsmittelallergien, neuropsychologische und neurochemische Befunde, Umweltfaktoren und Komorbidität.
Welche Auswirkungen hat ADHS auf den Alltag betroffener Kinder und Jugendlicher?
Die Auswirkungen von ADHS auf Schule, soziale Kontakte, Familie und die psychische Entwicklung werden ausführlich dargestellt. Das Dokument beleuchtet auch die emotionalen Folgen wie Stimmungsschwankungen und Ängste.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt verschiedene Therapieansätze, darunter diätetische Maßnahmen (Feingold-Diät, Hafer-Diät, oligo-antigene Diät) und die medikamentöse Behandlung. Die Wirksamkeit der verschiedenen Ansätze wird diskutiert und die Vor- und Nachteile der Medikamente, inklusive Nebenwirkungen, werden erläutert.
Welche Medikamente werden bei ADHS eingesetzt?
Das Dokument listet verschiedene Medikamente auf, die bei der Behandlung von ADHS eingesetzt werden, und beschreibt deren Anwendung und mögliche Nebenwirkungen. Es wird auch auf die Geschichte der medikamentösen Behandlung eingegangen.
Welche Herausforderungen gibt es im Alltag mit ADHS-Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf neue Medien und die Schulsituation?
Das Dokument beleuchtet die besonderen Herausforderungen im Alltag von Jugendlichen mit ADHS, insbesondere die Einflüsse neuer Medien und die spezifischen Schwierigkeiten in der Schulsituation.
- Citar trabajo
- Anja Schmid (Autor), 2008, Vom Zappelphillip zum unkonzentrierten Chaoten. ADHS bei Kindern und jungen Erwachsenen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122489