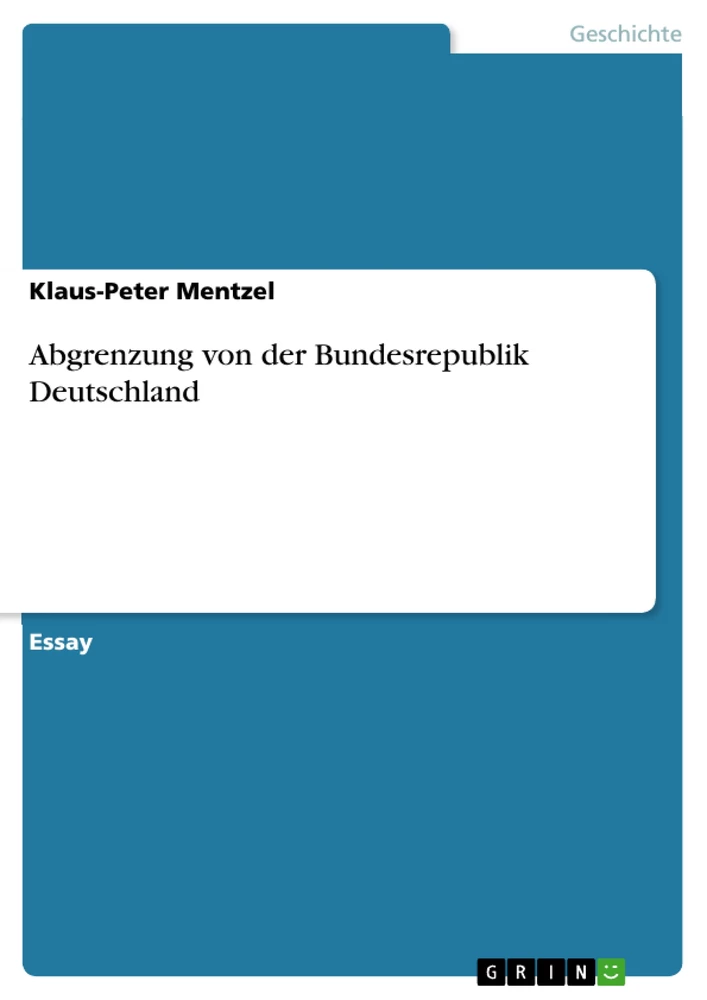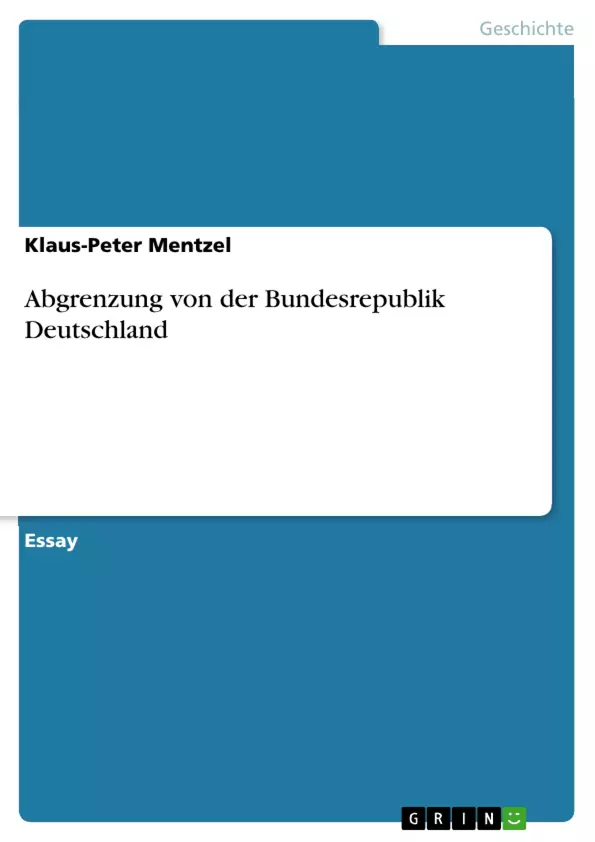Nach den Verträgen von Moskau, Warschau und nach dem Grundlagenvertrag war es der DDR möglich, auch Außenpolitik nach Westen zu machen. Während alle Staaten im Osten europäische Pläne und Wünsche entwickelten, blieb die DDR auf den Feind in Bonn und den Freund in Moskau fixiert; der eine bestritt ihr Daseinsrecht, der andere garantierte es.
Dennoch versuchte sich die DDR-Außenpolitik auch in der West-Politik. Ganz allmählich gelang es ihr, die skeptischen Westregierungen davon zu überzeugen, dass die DDR nicht im sowjetischen Auftrag, sondern im eigenen Namen auftrat. Die Mauer jedoch bezeichnete die Grenze, die der Westpolitik des Staates DDR gesetzt blieb. Nach Bender musste sich die DDR abschotten, von denen, die sie umwarb.
Die Hauptschwierigkeiten für die neue Außenpolitik lagen in Moskau. “Spiegelverkehrt erging es der DDR mit ihrer Westpolitik ähnlich wie der Bundesrepublik mit ihrer Ostpolitik: Die Verbündeten befürchteten ,daß „ihre“ Deutschen zu weit zum anderen „Lager“ hin abdrifteten.“ Kurz nach Unterzeichnung des Moskauer Vertrages hatte Breschnew Honecker ermahnt, die Entspannung dürfe nicht zu einer Annäherung zwischen den deutschen Staaten führen, Abgrenzung sei notwendig.
Inhaltsverzeichnis
- Abgrenzung von der Bundesrepublik
- Die Politik der Abgrenzung
- Der Nationenbegriff
- Die DDR-Identität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Außen- und Deutschlandpolitik der DDR von 1945 bis 1990, insbesondere die Strategie der Abgrenzung von der Bundesrepublik. Es wird analysiert, wie die DDR ihre nationale Identität im Kontext des Kalten Krieges und des sozialistischen Systems definierte und ihre Beziehungen zum Westen und zur Bundesrepublik gestaltete.
- Die Entwicklung der DDR-Außenpolitik nach dem Abschluss der Verträge mit der Sowjetunion und Polen.
- Die Rolle der "Zwei-Nationen-Theorie" in der Abgrenzungspolitik der DDR.
- Die Auseinandersetzung der DDR mit der bundesdeutschen Ostpolitik und dem Konzept der Kulturnation.
- Die Konstruktion der DDR-Identität und der Versuch, ein sozialistisches Nationalbewusstsein zu schaffen.
- Die Entwicklung des Nationsbegriffs in der DDR und seine theoretische Fundierung.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Anfänge der DDR-Außenpolitik nach den Verträgen von Moskau und Warschau und dem Grundlagenvertrag. Es zeigt die Schwierigkeiten, die sich aus der Abhängigkeit von der Sowjetunion und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer eigenständigen Westpolitik ergaben. Der zweite Abschnitt behandelt die "Politik der Abgrenzung" der DDR, die sich auf sozioökonomische Unterschiede und politische Organisationsprinzipien konzentrierte, um die Existenz zweier deutscher Nationen zu begründen. Der dritte Teil analysiert die Auseinandersetzung der DDR mit dem bundesdeutschen Konzept der Kulturnation und die Entwicklung der "Zwei-Nationen-Theorie" als Teil der Abgrenzungspolitik. Im letzten Abschnitt vor dem Schluss wird die Konstruktion der DDR-Identität und das Bemühen um ein sozialistisches Nationalbewusstsein untersucht.
Schlüsselwörter
DDR-Außenpolitik, Abgrenzungspolitik, Zwei-Nationen-Theorie, Nationale Identität, Sozialistisches Nationalbewusstsein, Deutschlandpolitik, Ostpolitik, Kulturnation, Kalter Krieg, SED.
Häufig gestellte Fragen
Was war die „Abgrenzungspolitik“ der DDR?
Es war die Strategie der DDR-Führung, sich politisch und ideologisch von der BRD abzuschotten, um die Existenz einer eigenen sozialistischen Nation zu begründen.
Was besagt die „Zwei-Nationen-Theorie“?
Die DDR behauptete, dass sich auf deutschem Boden zwei eigenständige Nationen entwickelt hätten: eine sozialistische in der DDR und eine bürgerlich-kapitalistische in der BRD.
Welche Rolle spielte Moskau in der DDR-Westpolitik?
Die Sowjetunion befürchtete oft eine zu starke Annäherung der deutschen Staaten und mahnte die DDR regelmäßig zur strikten Abgrenzung.
Wie versuchte die DDR eine eigene Identität zu schaffen?
Durch die Förderung eines „sozialistischen Nationalbewusstseins“ und die Abkehr vom gesamtdeutschen Konzept der „Kulturnation“.
Welchen Einfluss hatten Verträge wie der Grundlagenvertrag?
Diese Verträge ermöglichten der DDR zwar eine aktivere Außenpolitik, verschärften aber gleichzeitig den internen Zwang zur ideologischen Abgrenzung.
- Citation du texte
- Klaus-Peter Mentzel (Auteur), 2008, Abgrenzung von der Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122493