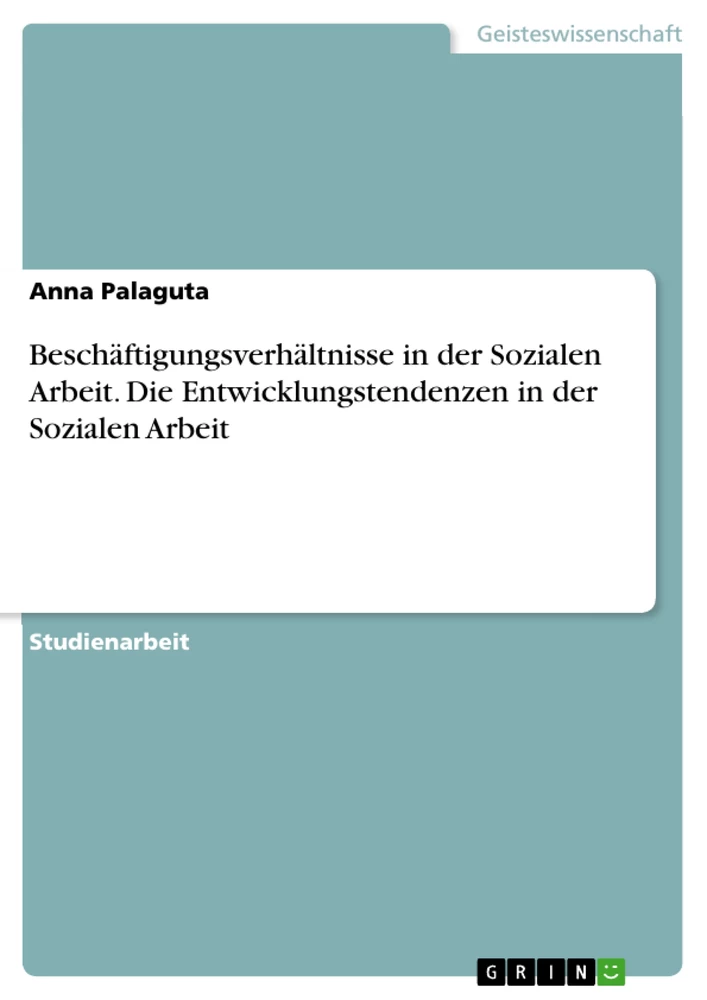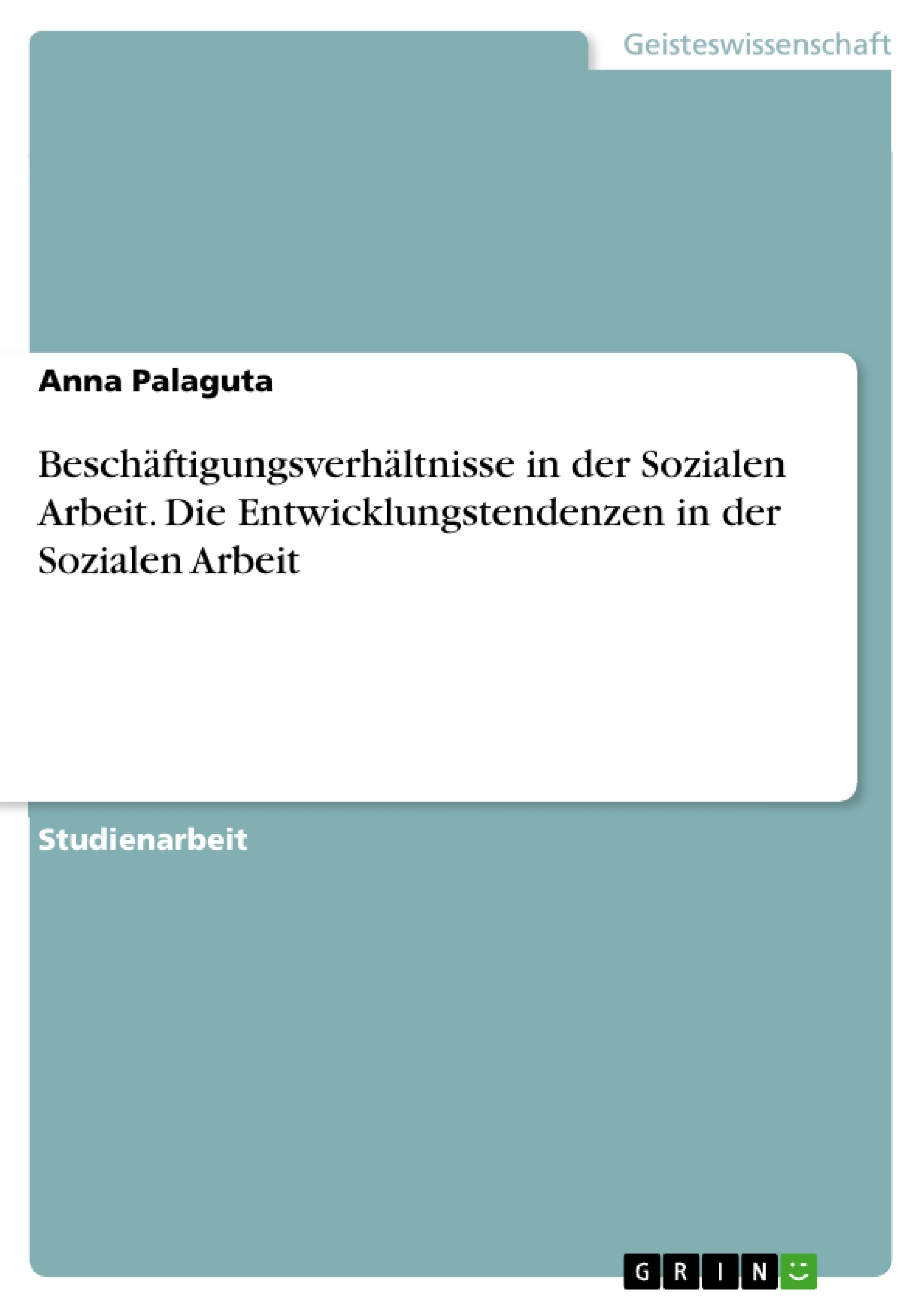Die Soziale Arbeit ist eine junge Profission, die Geschichte lässt sich ins Mittelalter zurückverfolgen. Die Armenführsorge, war der erste Ursprung der Sozialhilfe im Mittelalter. Die Maßnahmen der Armenpflege dienten der Bekämpfung der Armut und nicht der Ursachenbekämpfung. Der Theologe Thomas Aquin, hat die erste Theorie über Armut aufgestellt. Der Hintergrund seiner Theorie ist die zu dem Zeitpunkt herrschende Gesellschaftsordnung, welche auf Arm und Reich
unterteilt war. Die Almosenlehre von Thomas Aquin, zielte auf die Pflicht zur Hilfe für bedürftige. Die Almosenlehre vermittelte ein Pflichtgefühl, welches auf der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, und Nächstenliebe basierte.
Im 16. Jahrhundert entwickelte, der Humanist Juan Luis Vives, die Almosenlehre zu einem System der Armenführsorge, weiter. Diese Weiterentwicklung strebte zur Ursachenbekämpfung von Armut. Die Grundsätze der Theorie waren: eine Arbeitspflicht für Arme, Armenverzeichnis und ein Erziehungsprinzip in der Armenpflege einzuführen. Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff der Armenführsorge, durch den Begriff der Wohlfahrtspflege abgelöst. Zudem wurde eine Sozialreform eingeführt zusätzlich zu der gesetzlichen Sozialversicherung, dass führte zu einer großen Entwicklung in der
Wohlfahrtspflege. Die Sozialreform, wurde in den 1880-er Jahren verabschiedet und beinhaltete die gesetzliche Krankenversicherung, Unfallversicherung, Alters- und Invalidenversicherung. Die Arbeitslosenversicherung wurde später im Jahr 1927, durch ein Gesetzt über Arbeitsvermittlung und Arbeitsversicherung, eingeführt.
Bereits vor dem ersten Weltkrieg wurde in Deutschland die soziale Führsorge und später die behördliche Familien- und Jugendführsorge ausgebaut, somit wurde die Fürsorgearbeit professionalisiert. Die Mitarbeiter der Führsorge haben eine Ausbildung erhalten, welche zu der Systematisierung und Rationalisierung der Abläufe führte. In der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945), wurden alle Ansätze der Sozialen Arbeit in Hinblick auf Erziehung, Bildung und Wohlfahrtspflege unterdrückt und zu Gunsten des NS-Regimes instrumentalisiert. Nach dem Jahr 1945 änderte sich der Begriff der Wohlfahrtspflege in Fürsorge und ab 1960 in Sozialarbeit. Im Jahr 1960, durch die Einführung der Diplomstudiengänge für Sozialarbeit begann der akademische Weg der Professionalisierung der Sozialen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Wurzeln der Sozialen Arbeit
- Ziele und Funktionen der Sozialen Arbeit
- Berufsperspektiven der Sozialen Arbeit
- Tätigkeitsfeld der Sozialen Arbeit
- Träger der Sozialen Arbeit
- Finanzierung Sozialer Arbeit
- Berufschancen und Arbeitsmarktentwicklung
- Wandel in der Sozialen Arbeit
- Demografische Auswirkungen
- Digitalisierung
- Covid-19 Pandemie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklungstendenzen in der Sozialen Arbeit und analysiert die daraus resultierenden Chancen und Risiken für Arbeitnehmer:innen. Sie betrachtet die historischen Wurzeln der Sozialen Arbeit, ihre Ziele und Funktionen, die verschiedenen Tätigkeitsfelder, die Träger und Finanzierung sowie die aktuelle Arbeitsmarktentwicklung.
- Historische Entwicklung der Sozialen Arbeit
- Ziele und Funktionen der Sozialen Arbeit
- Aktuelle Trends und Herausforderungen im Berufsfeld der Sozialen Arbeit
- Chancen und Risiken für Arbeitnehmer:innen in der Sozialen Arbeit
- Bedeutung der Digitalisierung und des demografischen Wandels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung befasst sich mit den historischen Wurzeln der Sozialen Arbeit, beginnend mit der Armenführsorge im Mittelalter bis hin zur Entwicklung der Wohlfahrtspflege im 19. Jahrhundert und der Professionalisierung der Sozialen Arbeit im 20. Jahrhundert. Außerdem werden die Ziele und Funktionen der Sozialen Arbeit erläutert, mit Fokus auf das "Doppelte Mandat" von Hilfe und Kontrolle.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Berufsperspektiven der Sozialen Arbeit. Es werden die vielfältigen Tätigkeitsfelder im Detail dargestellt, von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen über die Arbeitsmarktintegration bis hin zur Pflege und dem Umgang mit abweichendem Verhalten. Außerdem werden die verschiedenen Träger der Sozialen Arbeit, wie Vereine, Wohlfahrtsverbände und öffentliche Einrichtungen, vorgestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den aktuellen Entwicklungen in der Sozialen Arbeit. Die Auswirkungen der Digitalisierung, des demografischen Wandels und der Covid-19-Pandemie auf das Berufsfeld werden analysiert.
Schlüsselwörter
Soziale Arbeit, Berufsfeldentwicklung, Beschäftigungsverhältnisse, Chancen, Risiken, historische Wurzeln, Ziele, Funktionen, Tätigkeitsfelder, Träger, Finanzierung, Arbeitsmarkt, Digitalisierung, Demografischer Wandel, Covid-19 Pandemie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die historischen Ursprünge der Sozialen Arbeit?
Die Soziale Arbeit hat ihre Wurzeln in der mittelalterlichen Armenfürsorge, die primär auf Gerechtigkeit und Nächstenliebe basierte, jedoch zunächst nur die Symptome und nicht die Ursachen von Armut bekämpfte.
Wer war Thomas von Aquin und was war seine Theorie zur Armut?
Thomas von Aquin stellte eine der ersten Theorien zur Armut auf, die sogenannte Almosenlehre. Diese betonte die Pflicht zur Hilfe für Bedürftige basierend auf der damaligen Gesellschaftsordnung.
Welche Neuerungen führte Juan Luis Vives im 16. Jahrhundert ein?
Vives entwickelte die Armenpflege hin zur Ursachenbekämpfung. Er führte Grundsätze wie die Arbeitspflicht für Arme, ein Armenverzeichnis und Erziehungsprinzipien ein.
Wann wurde die Sozialversicherung in Deutschland eingeführt?
Die wesentlichen Sozialreformen wurden in den 1880er Jahren verabschiedet (Kranken-, Unfall- und Altersversicherung), während die Arbeitslosenversicherung erst 1927 folgte.
Was versteht man unter dem "Doppelten Mandat" der Sozialen Arbeit?
Das doppelte Mandat beschreibt die zwei Kernfunktionen der Sozialen Arbeit: die Hilfe für das Individuum einerseits und die soziale Kontrolle im Auftrag der Gesellschaft andererseits.
Wie beeinflusst die Digitalisierung die Soziale Arbeit?
Die Digitalisierung gilt als aktueller Trend, der neue Arbeitsweisen und Herausforderungen für die professionelle Hilfe und Verwaltung in der Sozialen Arbeit mit sich bringt.
- Citation du texte
- Anna Palaguta (Auteur), 2022, Beschäftigungsverhältnisse in der Sozialen Arbeit. Die Entwicklungstendenzen in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1224931