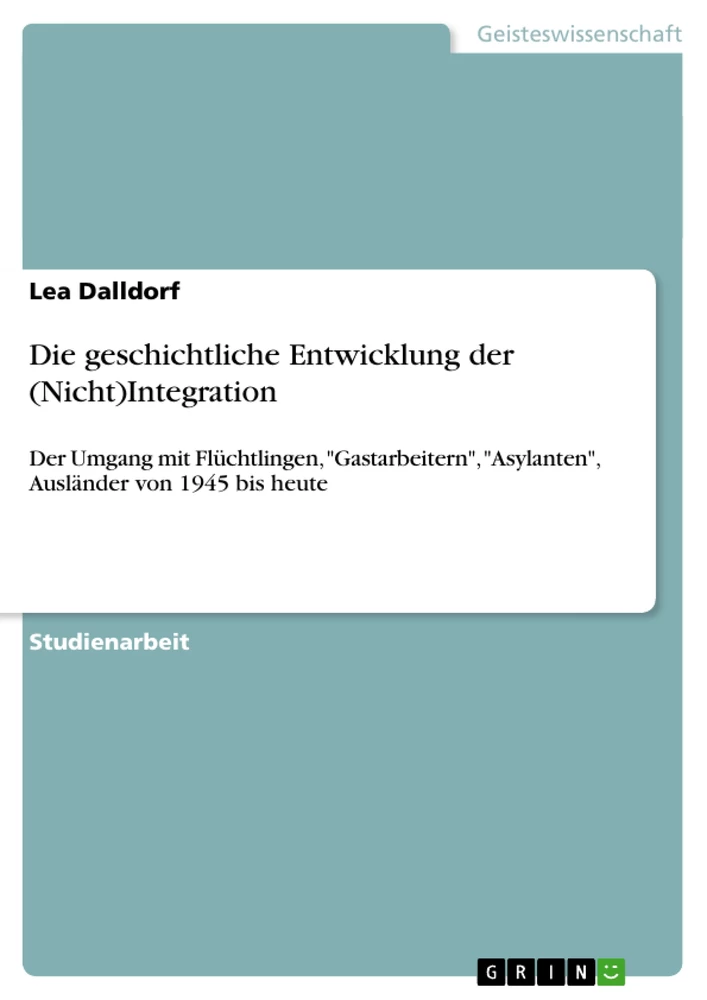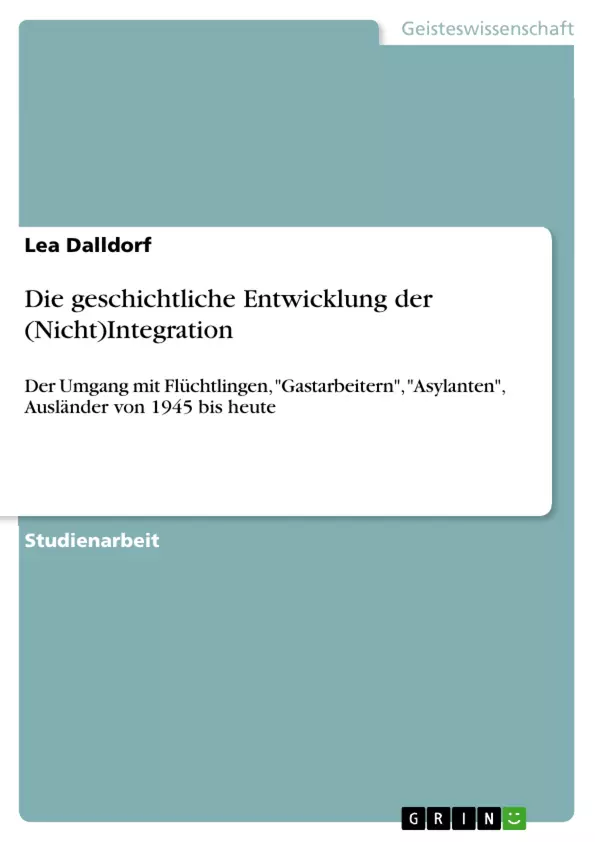In der folgenden Arbeit sollen die gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge der Geschichte Deutschlands, im chronologischen Verlauf dargestellt werden, welche die Grundlage für einen Integrations- oder Nicht-Integrationsprozess von Ausländern lieferten und liefern und die Handlungsbasis für Soziale Arbeit im Bereich Integration von Ausländern bilden. Die Auseinandersetzung mit dieser Problematik erfährt gerade heute durch die immer wieder stattfindenden öffentlichen Diskussionen zum Thema „Integration“ ihre besondere Aktualität. Da ich privat sehr viel Kontakt mit ausländischen Mitmenschen pflege, ist es mir möglich nicht nur die tagtäglichen politischen Diskussionen in Radio und Fernsehen zu verfolgen, sondern auch die Realität der Betroffenen mit zu erleben. Für mich besteht daher zu diesem Thema ein ganz persönlicher Bezug und hat aus diesem Grund ein ganz besonderes Interesse bei mir hervorgerufen. Selbstverständlich wird sich jedoch um eine faktenreiche, wissenschaftliche Darstellung bemüht worden.
Da dieses Thema sehr komplex ist, wird sich auf eine Auswahl von Daten und Fakten beschränkt, die jedoch genügend Aufschluss darüber bietet, wie es zu der heutigen Haltung und Problematik im Umgang mit Ausländern gekommen ist. Im Folgenden wird mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges begonnen und die Problematik der Ostvertriebenen geschildert, wie auch Seiten beleuchtet, die einen teilweise gelungenen Integrationsprozess erkennen lassen, welchem ganz bestimmte Umstände zu Grunde lagen. Anhand dessen soll gezeigt werden, dass Integrationsprozesse immer von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig sind und je nach diesen ganz unterschiedlich verlaufen. Besonders verwiesen werden soll auf die Geschichte der Arbeitsemigranten, da hier die Verbindung zu unser heutigen Integrationsproblematik zu sehen ist, welche explizit in diesem Zusammenhang heute zu zahlreichen Diskussionen führt. Anschließend wird der besondere Verlauf unter der Regierung Kohl dargestellt, um dann einen Überblick über die gegenwärtige Situation bezüglich des Themas zu geben. Abgeschlossen wird mit einer eigenen Stellungnahme.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Integration von Flüchtlingen nach Ende des 2. Weltkrieges
- 2.1 Kriegsende
- 2.2 Flüchtlinge und Vertriebene als Ersatz für Gefallene und Kriegsgefangene
- 2.3 Soziale Diskrepanzen und Unterschiede
- 2.3.1 Vertriebenenverbände
- 2.4 Soziale Arbeit nach Kriegsende
- 2.5 Nicht-Integration nicht möglich?
- 3. Die Massenbeschäftigung von „Gastarbeitern“ und deren massiven Folgeprobleme
- 3.1 Neue Arbeitskräfte braucht das Land
- 3.2 Das Leben eines Arbeitsemigranten
- 3.2.1 Erlebnis eines „Gastarbeiters“
- 3.3 Der Umgang mit „Gast- oder Fremdarbeitern“
- 3.4 Die Rolle der Gewerkschaften
- 3.5 Anwerbestopp
- 3.6 Die Entwicklung der „Ausländerpolitik“ nach dem „Anwerbestopp“ 1973
- 4. Die „Ausländerpolitik“ unter Bundeskanzler Kohl
- 4.1 „Das Boot ist voll“
- 4.2 Versuche der Zielumsetzung oder die (Endlos)Debatten
- 4.3 Die Asylbewerberproblematik
- 4.4 Ein neues Ausländergesetz
- 4.5 Nach der Wende
- 4.6 Der Wandel in der Zusammensetzung der Ausländerpopulation
- 4.7 Die Asylrechtsänderung oder Abschaffung des Asylrechts
- 5. Wie es heute ist
- 5.1 Das Zuwanderungsgesetz
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die geschichtlichen und politischen Zusammenhänge in Deutschland seit 1945, die den Integrations- oder Nicht-Integrationsprozess von Ausländern beeinflusst haben. Sie beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Kontext und bezieht aktuelle Integrationsdebatten mit ein. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Entwicklungen anhand von Flüchtlingen, Gastarbeitern und Asylbewerbern.
- Integrationsprozesse von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg
- Die Rolle von Gastarbeitern und die damit verbundenen Herausforderungen
- Entwicklung der deutschen Ausländerpolitik
- Der Einfluss von wirtschaftlichen Faktoren auf Integration
- Soziale Diskrepanzen und Unterschiede im Integrationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die persönliche Motivation der Autorin. Kapitel 2 behandelt die Integration von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Fokus auf die Situation der Vertriebenen und die wirtschaftlichen Bedingungen, die den Integrationsprozess beeinflussten. Kapitel 3 analysiert die Massenbeschäftigung von „Gastarbeitern“ und die damit verbundenen sozialen und politischen Probleme. Kapitel 4 befasst sich mit der „Ausländerpolitik“ unter Bundeskanzler Kohl, inkl. der Asylbewerberproblematik und den Veränderungen nach der deutschen Wiedervereinigung.
Schlüsselwörter
Integration, Migration, Flüchtlinge, Gastarbeiter, Asylbewerber, Ausländerpolitik, Soziale Arbeit, Wirtschaftsentwicklung, Integrationsprozess, soziale Diskrepanzen.
Häufig gestellte Fragen
Wie verlief die Integration von Flüchtlingen nach 1945?
Die Integration der Ostvertriebenen war von wirtschaftlicher Not, aber auch von einem hohen Arbeitskräftebedarf geprägt, was den Prozess trotz anfänglicher sozialer Diskrepanzen beschleunigte.
Was war das Problem der „Gastarbeiter-Politik“?
Gastarbeiter wurden als temporäre Arbeitskräfte angesehen. Da man nicht mit einem dauerhaften Aufenthalt rechnete, wurden Integrationsmaßnahmen jahrzehntelang vernachlässigt.
Wie änderte sich die Ausländerpolitik unter Helmut Kohl?
Die Ära war durch Slogans wie „Das Boot ist voll“ und hitzige Debatten über das Asylrecht geprägt, was zu einer Verschärfung der gesetzlichen Rahmenbedingungen führte.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit bei der Integration?
Die Soziale Arbeit bildet die Handlungsbasis, um Migranten bei der Bewältigung von Alltagsherausforderungen zu unterstützen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.
Was regelt das heutige Zuwanderungsgesetz?
Das Zuwanderungsgesetz versucht, Migration zu steuern und legt erstmals gesetzliche Mindeststandards für Integrationskurse und die Förderung von Sprachkenntnissen fest.
- Arbeit zitieren
- Lea Dalldorf (Autor:in), 2007, Die geschichtliche Entwicklung der (Nicht)Integration, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122515