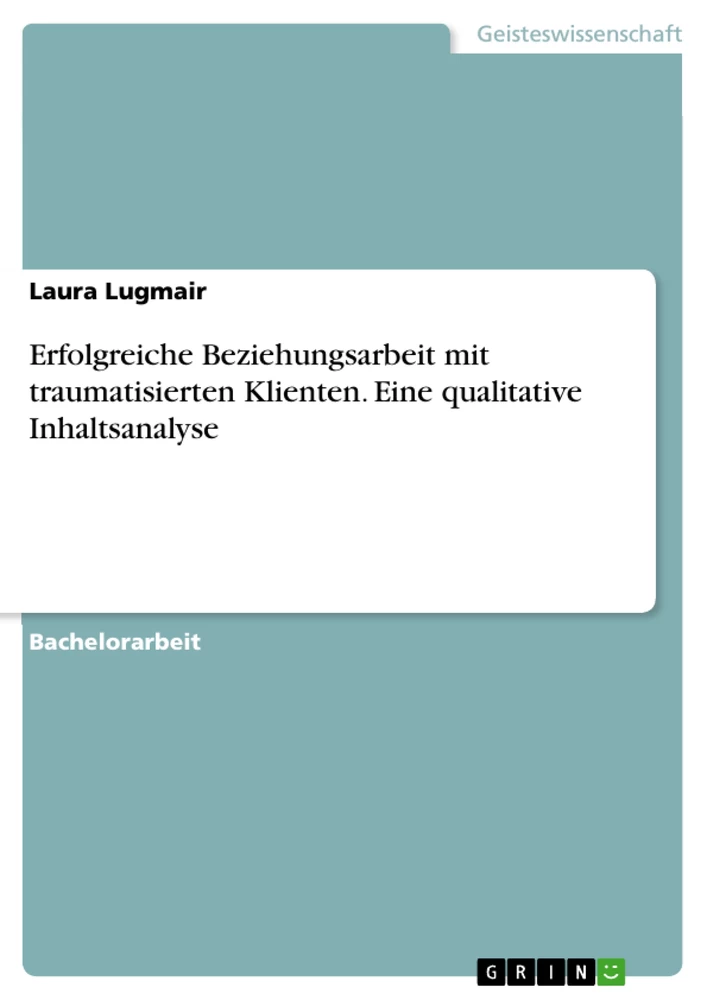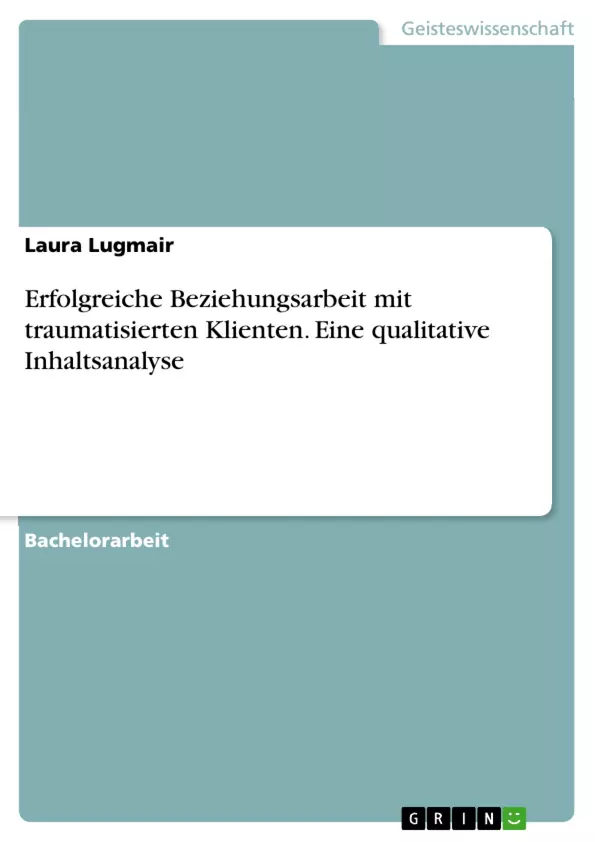Ziel dieser Forschungsarbeit ist es, einen Einblick in die beraterische Praxis von Sozialpsychiatrischen Diensten zu erhalten. Auf dieser Grundlage sollen konkrete Handlungsempfehlungen für die Beratungsarbeit mit traumatisierten Klienten erörtert werden. In der wissenschaftlichen Literatur lassen sich zahlreiche Schriften bezüglich der Beziehungsarbeit mit traumatisierter Klientel finden, sodass eine theoretische Beantwortung der Forschungsfrage durchaus möglich wäre. Das wesentliche Erkenntnisinteresse dieser Arbeit ist allerdings ein anderes, nämlich das reflektierte Wissen, die Expertise und die (langjährigen) persönlichen Erfahrungen von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Derartige Informationen können sehr individuell und subjektiv sein, wodurch ein breites Spektrum an Erkenntnissen erhoben werden kann. Mit deren Hilfe soll die Forschungsfrage anschließend umfassend und vor allem praxisnah beantwortet werden können. Aus diesem Grund werden Experteninterviews mit Mitarbeiterinnen sozialpsychiatrischer Dienste als qualitative Erhebungsmethode angewandt.
Die Arbeit wird in zwei Bereiche gegliedert. Zunächst werden zentrale theoretische Inhalte dargestellt, anschließend erfolgt die Methodik. Im Theorieteil wird untersucht, in welchen Dimensionen Kinder und Säuglinge innerfamiliäre Gewalt erleben können. Dazu zählen Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung sowie das Beobachten interparentaler Gewalt. Das dritte Kapitel widmet sich speziell der Traumatisierung als Folge früher Stress- und Gewalterfahrungen. Es wird dargestellt, inwiefern ein Trauma aufgrund Misshandlung und Vernachlässigung entsteht. In diesem Kontext erfolgt eine diagnostische Einordnung möglicher Traumafolgestörungen. Aufgrund der Relevanz im Zusammenhang mit der Forschungsfrage wird im Speziellen auf Bindungstraumata sowie deren Ursachen und die Bedeutung für die Bindungsfähigkeit eingegangen.
Abschließend werden Risiko- und Schutzfaktoren eines Kindes bezüglich der Entwicklung eines Traumas dargestellt, wobei der Begriff der Resilienz eine wichtige Rolle spielt. Im Zentrum des vierten Kapitels steht die Erläuterung der Methodik. Hierzu zählen die Vorstellung der Interviewpartnerinnen, die Vorgehensweise der Datenerhebung sowie der Datenauswertung. Das letzte Kapitel ist der Darstellung der Untersuchungsergebnisse gewidmet. Abgerundet wird die Arbeit mit einer Schlussbetrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Erleben innerfamiliärer Gewalt in der Kindheit
- 2.1 Formen der Kindesmisshandlung
- 2.1.1 Körperliche Misshandlung an Kindern
- 2.1.2 Emotionale Misshandlung an Kindern
- 2.2 Formen der Kindesvernachlässigung
- 2.2.1 Körperliche Vernachlässigung
- 2.2.2 Emotionale Vernachlässigung
- 2.3 Das Kind als Beobachter interparentaler Gewalt
- 3 Traumatisierung als Folge früher Stress- und Gewalterfahrungen
- 3.1 Entstehung eines Traumas aufgrund Misshandlung und Vernachlässigung
- 3.1.1 Folgen nicht erfolgreich integrierter Traumaerlebnisse
- 3.1.2 Diagnostische Einordnung von Traumafolgestörungen
- 3.2 Bindungstraumata als Folge kindlicher Misshandlung und Vernachlässigung
- 3.2.1 Bindungsqualitäten
- 3.2.2 Entwicklung und Bedeutung der internalen Arbeitsmodelle
- 3.3 Risiko- und Schutzfaktoren eines Kindes bezüglich der Entwicklung eines Traumas
- 3.3.1 Risikofaktoren
- 3.3.2 Resilienz & Schutzfaktoren
- 4 Methodisches Vorgehen
- 4.1 Experteninterviews als qualitative Erhebungsmethode
- 4.2 Gestaltung des Interviewleitfadens
- 4.3 Vorstellung der Interviewpartnerinnen
- 4.3.1 Interview I
- 4.3.2 Interview II
- 4.3.3 Interview III
- 4.3.4 Interview IV
- 4.4 Datenerhebung
- 4.5 Datenauswertung mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse
- 5 Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Traumafolgestörungen
- 5.1.1 Diagnostik
- 5.1.2 PTBS und Dissoziative Identitätsstörung
- 5.1.3 Komorbide Diagnosen
- 5.2 Traumaspezifische Symptome und Verhaltensweisen
- 5.2.1 Erkennen einer Traumatisierung
- 5.2.2 Dissoziation
- 5.2.3 Flashbacks
- 5.3 Umgang mit traumaspezifischen Symptomen und Verhaltensweisen
- 5.3.1 Umgang mit Dissoziation
- 5.3.2 Umgang mit Flashbacks
- 5.3.3 Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung
- 5.4 Beratungstechniken
- 5.4.1 Traumasensibler Umgang
- 5.4.2 Emotionale Abgrenzung
- 5.5 Herstellen einer vertrauensvollen Beziehung
- 5.5.1 Zeit als Faktor
- 5.5.2 Echtheit
- 5.5.3 Präsenz
- 5.5.4 Zuverlässigkeit
- 5.5.5 Ernstnehmen des Klienten
- 5.5.6 Auswirkungen der Beziehungsgestaltung auf den Beratenden
- 5.5.7 Bewahren einer professionellen Beziehungsebene
- 5.6 Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung
- 5.6.1 Bindung als Ressource
- 5.6.2 Berater als Rollenmodell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit zielt darauf ab, einen Einblick in die Beratungsarbeit von Sozialpsychiatrischen Diensten im Umgang mit traumatisierten Klienten zu gewinnen und auf dieser Grundlage konkrete Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Das Hauptinteresse liegt dabei auf der Beziehungsarbeit mit traumatisierten Klienten und deren Besonderheiten.
- Traumatisierung als Folge früher Stress- und Gewalterfahrungen
- Entwicklung und Auswirkungen von Bindungstraumata
- Traumafolgestörungen und deren Symptome
- Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung in der Traumabewältigung
- Beratungstechniken im Umgang mit traumatisierten Klienten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Bedeutung von vertrauensvollen Beziehungen im Kontext der Traumabewältigung beleuchtet und den Forschungsgegenstand einführt. Kapitel 2 beleuchtet verschiedene Formen von innerfamiliärer Gewalt, die Kinder erleben können, darunter Kindesmisshandlung und -vernachlässigung sowie das Erleben interparentaler Gewalt. Kapitel 3 widmet sich der Traumatisierung als Folge früher Stress- und Gewalterfahrungen, beleuchtet die Entstehung von Traumata aufgrund Misshandlung und Vernachlässigung und geht dabei auch auf die diagnostische Einordnung von Traumafolgestörungen sowie die Entwicklung und Bedeutung von Bindungstraumata ein. Die Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung eines Traumas werden ebenfalls erläutert.
Kapitel 4 beschreibt die Methodik der Forschungsarbeit, die auf Experteninterviews als qualitative Erhebungsmethode setzt. Es werden der Aufbau des Interviewleitfadens sowie die Vorstellung der Interviewpartnerinnen und der Ablauf der Datenerhebung und -auswertung erläutert. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, indem es auf Traumafolgestörungen, traumaspezifische Symptome und Verhaltensweisen sowie den Umgang mit diesen in der Beratungspraxis eingeht. Es werden auch Beratungstechniken wie traumasensibler Umgang und emotionale Abgrenzung, die Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung sowie die Herausforderungen der Beziehungsarbeit für die Beratenden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der Traumabewältigung und der Bedeutung einer vertrauensvollen Beziehung in der Arbeit mit traumatisierten Klienten. Dabei stehen verschiedene Formen der innerfamiliären Gewalt, Traumatisierung als Folge früher Stress- und Gewalterfahrungen, Bindungstraumata, Traumafolgestörungen wie die PTBS, Dissoziation, Flashbacks und die Bedeutung von Beratungstechniken im Vordergrund. Die Arbeit untersucht die Praxis sozialpsychiatrischer Dienste im Umgang mit traumatisierten Klienten und liefert Handlungsempfehlungen für die Beratungspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Wie entsteht ein Kindheitstrauma durch innerfamiliäre Gewalt?
Traumata entstehen durch körperliche oder emotionale Misshandlung, Vernachlässigung sowie durch das Beobachten von Gewalt zwischen den Eltern (interparentale Gewalt).
Was sind typische Symptome einer Traumatisierung in der Beratung?
Häufige Symptome sind Dissoziationen (Abspaltung von Erlebnissen), Flashbacks (unkontrolliertes Wiedererleben) sowie Schwierigkeiten in der Bindungsfähigkeit.
Welche Rolle spielt die Beziehung zwischen Berater und Klient?
Eine vertrauensvolle Beziehung ist eine zentrale Ressource. Faktoren wie Zeit, Echtheit, Präsenz und Zuverlässigkeit des Beraters sind entscheidend für den Erfolg der Traumabewältigung.
Was ist ein Bindungstrauma?
Ein Bindungstrauma resultiert aus frühen Erfahrungen mit instabilen oder gewalttätigen Bezugspersonen und beeinflusst massiv die internale Arbeitsmodelle und die spätere Beziehungsfähigkeit.
Wie gehen Fachkräfte mit Dissoziationen ihrer Klienten um?
Die Arbeit beschreibt traumasensible Techniken zur Stabilisierung und den professionellen Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung in der Beratungssituation.
- Arbeit zitieren
- Laura Lugmair (Autor:in), 2018, Erfolgreiche Beziehungsarbeit mit traumatisierten Klienten. Eine qualitative Inhaltsanalyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1225189