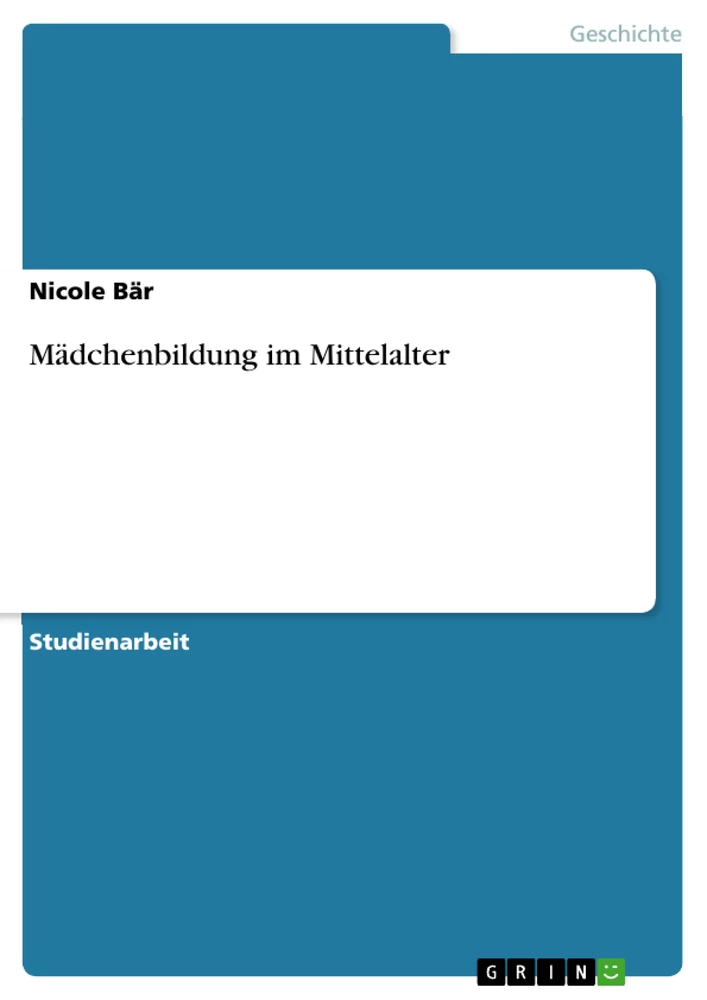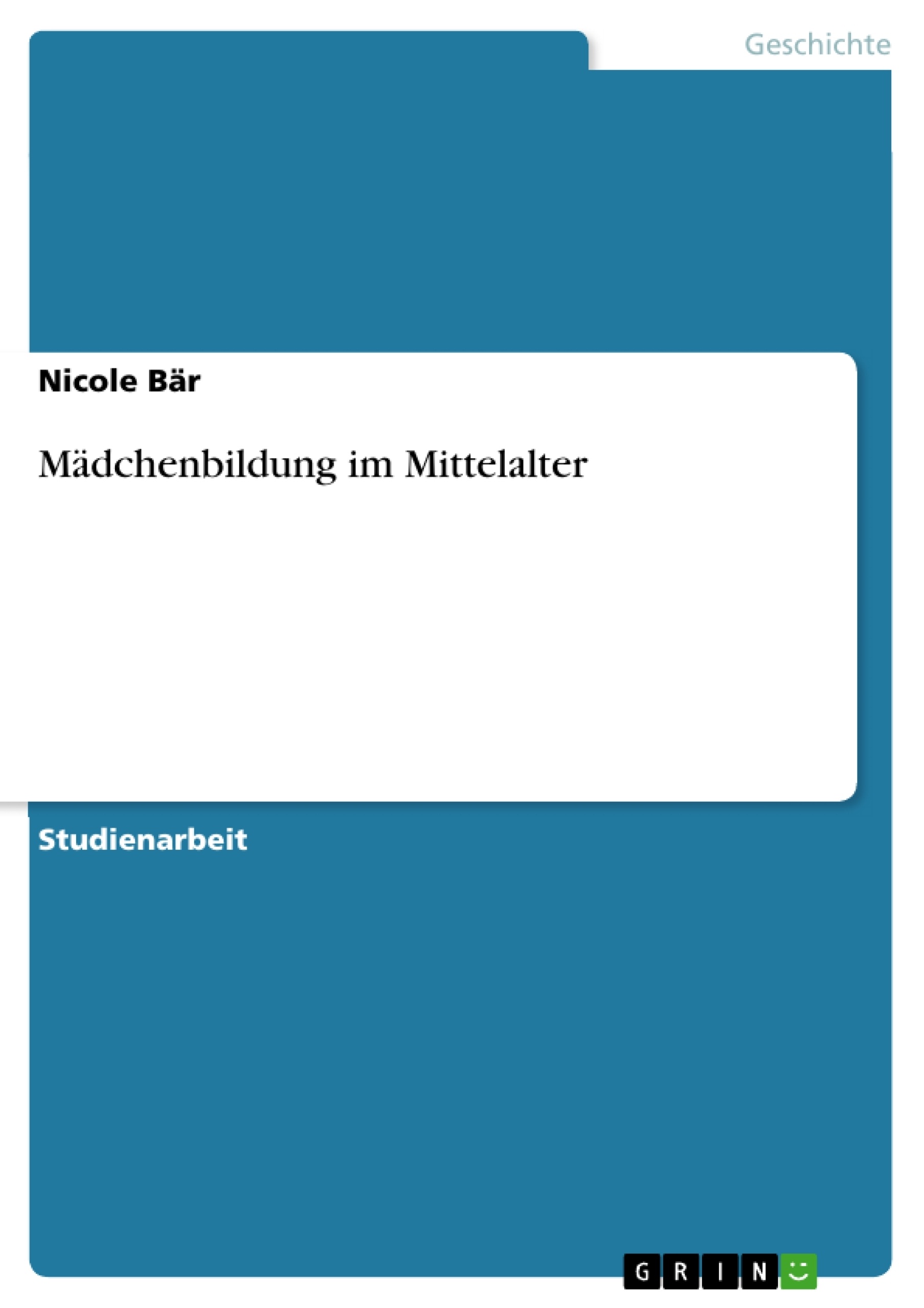Beschäftigt man sich mit der Frauenbildung im Mittelalter, so stößt man zunächst auf das Problem, dass dieses Thema sehr weit gefasst ist. Im Allgemeinen meint man mit dem Mittelalter einen Zeitabschnitt von rund 1.000 Jahren, nämlich ungefähr vom Jahr 500 bis zum Jahr 1500 n.Chr. Hinzu kommt, dass es in dieser Zeit nicht nur einen großen „Staat“, wie etwa in der Antike das Römische Reich, sondern mehrere große und viele kleine Herrschaftsgebiete gab, die in ihrer politischen, geographischen und religiösen Struktur oft sehr verschieden waren. Außerdem war die mittelalterliche Gesellschaft stark hierarchisch geprägt und in Stände unterteilt, die einen sozialen Aufstieg erheblich schwieriger machen als etwa im Römischen Reich.
Dies alles hat zur Folge, dass es die typische Frau des Mittelalters nicht gab, sondern auch hier verschiedene Gruppen zu betrachten sind. Zusammen mit der sehr unterschiedlichen Quellenlage zu den Gruppen wird deutlich, dass in der vorliegenden Arbeit kein detaillierter Blick auf sämtliche Formen der Frauenbildung im Mittelalter, sondern lediglich auf einzelne Aspekte geworfen werden kann. Ich gehe daher vor allem auf den deutschen Sprachraum, Frauen an den Höfen und die Zeit des Spätmittelalters ein. Das Ziel dieser Arbeit ist zu zeigen, dass anhand der behandelten Beispiele trotz aller Probleme doch eine gemeinsame Grundtendenz innerhalb der Frauenbildung des Mittelalters erkennbar ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Frauenbild des Mittelalters
- 3. Rechtliche Stellung der Frauen
- 4. Erziehung und Bildung der Frauen im Mittelalter
- 4.1. Die Frau bei Hofe
- 4.2. Frauen im Kloster
- 4.3. Frauen im städtischen Handel
- 4.4. Frauen im städtischen Handwerk
- 4.5. Frauen auf dem Land
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Aspekte der Frauenbildung im Mittelalter, wobei die Komplexität des Themas aufgrund der zeitlichen und räumlichen Ausdehnung des Mittelalters sowie der sozialen Hierarchien hervorgehoben wird. Der Fokus liegt auf dem deutschen Sprachraum, Frauen an den Höfen und dem Spätmittelalter. Ziel ist es, trotz der Herausforderungen eine gemeinsame Grundtendenz in der Frauenbildung aufzuzeigen.
- Das Frauenbild des Mittelalters und seine Widersprüchlichkeiten
- Die rechtliche Stellung der Frau im Mittelalter und ihre eingeschränkten Möglichkeiten
- Die Erziehung und Bildung von Frauen in verschiedenen sozialen Kontexten (Hof, Kloster, Stadt, Land)
- Der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Erwartungen auf die Lebenswirklichkeit von Frauen
- Die Rolle von Frauen in der höfischen Kultur und Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung betont die Herausforderungen bei der Erforschung der Frauenbildung im Mittelalter aufgrund der zeitlichen und sozialen Vielfalt. Kapitel 2 beleuchtet das widersprüchliche Frauenbild, das sowohl Ideale der Keuschheit und Zurückgezogenheit als auch Beispiele weiblicher Einflussnahme in Politik und Gesellschaft umfasst. Kapitel 3 beschreibt die rechtliche Benachteiligung von Frauen, ihre eingeschränkte Prozessfähigkeit und den Ausschluss von öffentlichen Ämtern, auch im Hinblick auf Lehen. Kapitel 4 gibt einen Überblick über die Erziehung und Bildung von Frauen in verschiedenen sozialen Schichten. Es werden die unterschiedlichen Rollen und Möglichkeiten von Frauen an den Höfen, in Klöstern, im städtischen Handel und Handwerk sowie auf dem Land behandelt.
Schlüsselwörter
Frauenbildung, Mittelalter, Frauenbild, Rechtliche Stellung, Erziehung, Bildung, Hof, Kloster, Stadt, Land, höfische Kultur, soziale Hierarchien, religiöse Einflüsse.
- Arbeit zitieren
- Nicole Bär (Autor:in), 2007, Mädchenbildung im Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122520