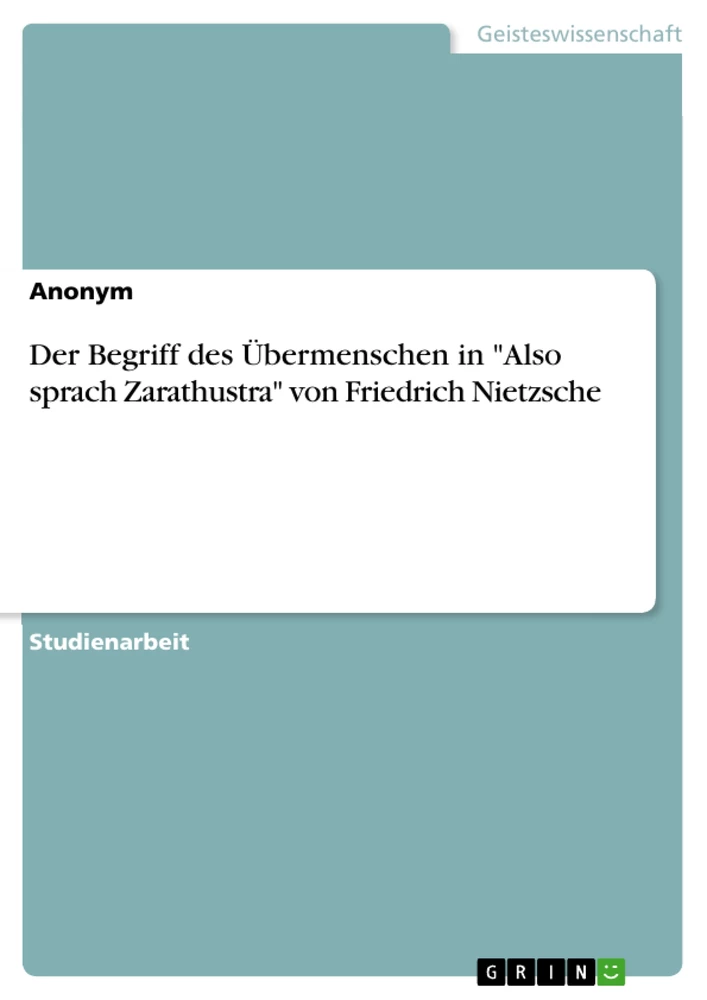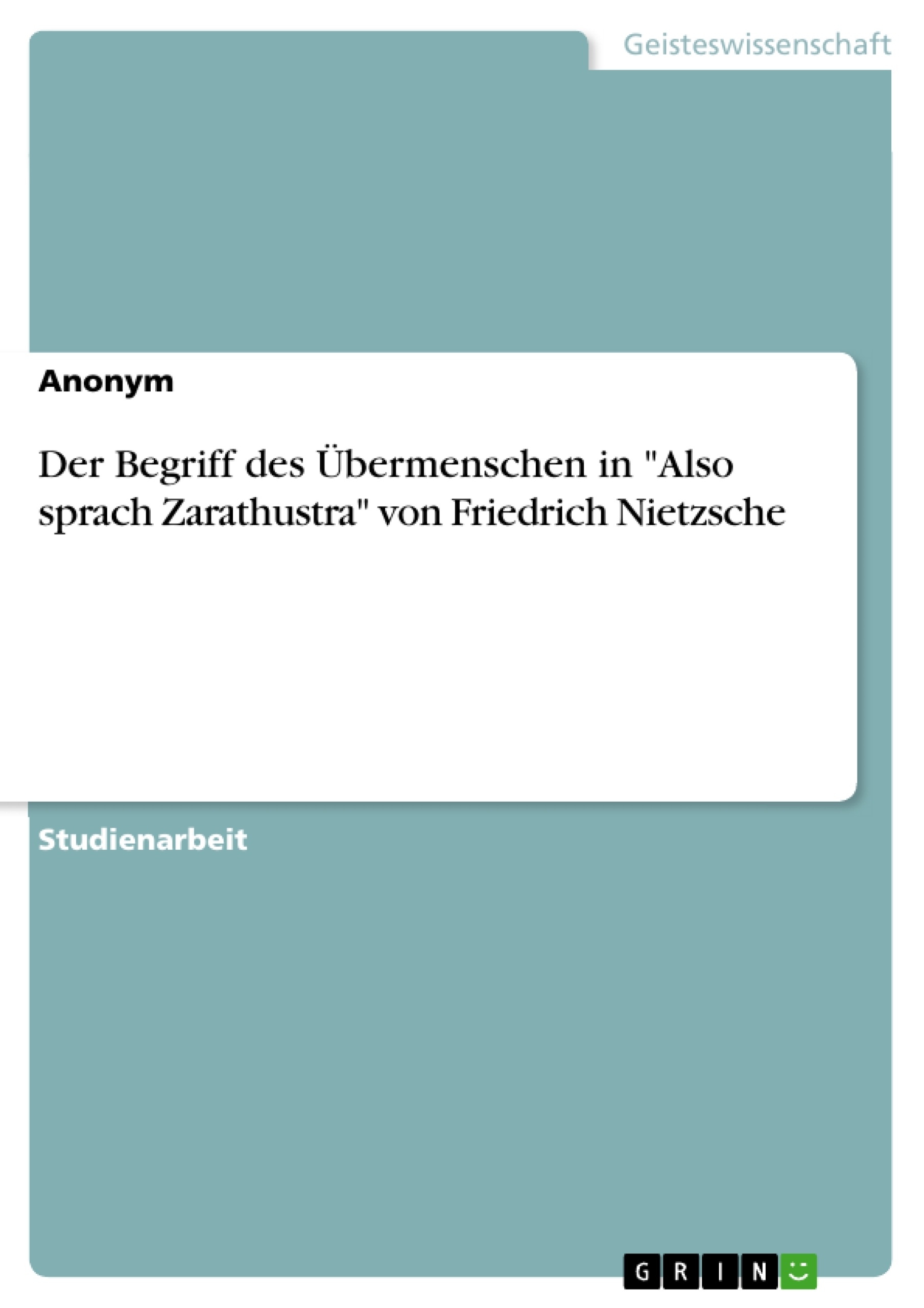In dieser Arbeit wird es um Nietzsches Übermenschen in seinem Werk „Also sprach Zarathustra“ gehen. Es soll der Frage nachgegangen werden: Was meint Nietzsche mit dem Begriff des Übermenschen? Außerdem soll darüber hinaus in verschiedene Bereiche geschaut werden, die mit dem Verständnis des Übermenschen zusammenhängen und verbunden sind. Als erstes in dem Kapitel „Der Übermensch bei Zarathustra“ wird betrachtet, wie Nietzsche seine Gedanken zum Übermenschen in seinem Werk „Also sprach Zarathustra“ bearbeitet. Hierbei wird stark mit dem Originaltext gearbeitet.
Also sprach Zarathustra (Untertitel: Ein Buch für Alle und Keinen“) ist ein Werk Friedrich Nietzsches, das zwischen 1883 und 1885 entstanden ist. Es setzt sich aus vier separaten Büchern zusammen, die zusammen die Phase des späten Nietzsches einläuten. Der „Übermensch“ wird in Nietzsches Zarathustra erstmals entworfen, woraus er die Neubewertung der Moral in seinen späteren Werken Jenseits von Gut und Böse (1886) und Zur Genealogie der Moral (1887) entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Übermensch bei Zarathustra
- Platons Höhlengleichnis in Bezug auf den Übermenschen
- Der Untergang bei Zarathustra
- Von den drei Verwandlungen
- Die ewige Wiederkehr
- Der Raum als Notwendigkeit des Menschen
- Phänomenologische Betrachtungsweise
- Ist das Darwinismus?
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Nietzsches Konzept des Übermenschen, wie es in Also sprach Zarathustra präsentiert wird. Das Hauptziel ist es, Nietzsches Verständnis des Begriffs zu klären und dessen Zusammenhänge mit anderen relevanten Aspekten seines Werks zu beleuchten.
- Nietzsches Definition des Übermenschen und dessen Stellung zum Menschen.
- Der Vergleich zwischen Zarathustras Weg und Platons Höhlengleichnis.
- Die Bedeutung der drei Verwandlungen für die Überwindung des Menschen.
- Die Rolle der ewigen Wiederkehr im Kontext des Übermenschen.
- Die Beziehung zwischen Nietzsches Philosophie und dem Darwinismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Nietzsches Übermenschen ein und beschreibt den Kontext innerhalb von Also sprach Zarathustra und dessen Bedeutung für Nietzsches spätere Werke. Sie skizziert den Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit, der sich auf die Klärung des Begriffs des Übermenschen und die Untersuchung seiner Verbindungen zu anderen relevanten Aspekten konzentriert.
Der Übermensch bei Zarathustra: Dieses Kapitel analysiert Nietzsches Darstellung des Übermenschen in Also sprach Zarathustra. Es untersucht Zarathustras Verkündigung des Übermenschen, die anfängliche Ablehnung durch die Menschen und Zarathustras Suche nach Gleichgesinnten. Die Analyse konzentriert sich auf zentrale Zitate, die Nietzsches Verständnis des Menschen als Zwischenstufe zwischen Tier und Übermensch beleuchten. Die Darstellung des Menschen als "schmutziger Strom" und der Übermensch als "Meer" wird interpretiert und in Bezug auf das Streben nach Überwindung gesetzt. Die Metapher des Seils, gespannt zwischen Tier und Übermensch, wird als symbolische Darstellung des menschlichen Daseins gedeutet. Schließlich wird Zarathustras Rolle als Verkündiger des Übermenschen und die vielschichtige Symbolik des "Blitzes" als kraftvolle Metapher für die Erkenntnis und den Weg zum Übermenschen untersucht.
Schlüsselwörter
Nietzsche, Übermensch, Also sprach Zarathustra, Höhlengleichnis, Platon, drei Verwandlungen, ewige Wiederkehr, Darwinismus, Moral, Selbstüberwindung.
Häufig gestellte Fragen zu "Also sprach Zarathustra" - Eine Aufsatzanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Nietzsches Konzept des Übermenschen, wie es in Also sprach Zarathustra dargestellt wird. Das Hauptziel ist die Klärung des Begriffs und die Untersuchung seiner Zusammenhänge mit anderen Aspekten von Nietzsches Werk.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Nietzsches Definition des Übermenschen und dessen Stellung zum Menschen; den Vergleich zwischen Zarathustras Weg und Platons Höhlengleichnis; die Bedeutung der drei Verwandlungen für die Überwindung des Menschen; die Rolle der ewigen Wiederkehr im Kontext des Übermenschen; und die Beziehung zwischen Nietzsches Philosophie und dem Darwinismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Übermensch bei Zarathustra, Platons Höhlengleichnis in Bezug auf den Übermenschen, Der Untergang bei Zarathustra, Von den drei Verwandlungen, Die ewige Wiederkehr (inkl. Unterkapiteln "Der Raum als Notwendigkeit des Menschen" und "Phänomenologische Betrachtungsweise"), Ist das Darwinismus?, und Resümee.
Wie wird der Übermensch in Zarathustra dargestellt?
Das Kapitel "Der Übermensch bei Zarathustra" analysiert Nietzsches Darstellung des Übermenschen in Also sprach Zarathustra. Es untersucht Zarathustras Verkündigung, die anfängliche Ablehnung und die Suche nach Gleichgesinnten. Zentrale Zitate beleuchten den Menschen als Zwischenstufe zwischen Tier und Übermensch. Metaphern wie "schmutziger Strom" und "Meer" werden interpretiert, ebenso die Metapher des Seils zwischen Tier und Übermensch. Zarathustras Rolle als Verkündiger und die Symbolik des "Blitzes" werden untersucht.
Welche Rolle spielt Platons Höhlengleichnis?
Die Arbeit untersucht den Vergleich zwischen Zarathustras Weg zur Überwindung und Platons Höhlengleichnis. Diese Analyse beleuchtet die Parallelen und Unterschiede in beiden Konzepten der Selbstfindung und des Strebens nach höherer Erkenntnis.
Welche Bedeutung haben die drei Verwandlungen?
Die Bedeutung der drei Verwandlungen für die Überwindung des Menschen wird im entsprechenden Kapitel analysiert. Es wird untersucht, wie diese Verwandlungen den Weg zum Übermenschen ermöglichen und welche Bedeutung sie im Kontext von Nietzsches Philosophie haben.
Welche Rolle spielt die ewige Wiederkehr?
Die Rolle der ewigen Wiederkehr im Kontext des Übermenschen wird untersucht, einschließlich der Unterkapitel "Der Raum als Notwendigkeit des Menschen" und "Phänomenologische Betrachtungsweise". Die Analyse beleuchtet den Einfluss dieses Konzepts auf das Streben nach Selbstüberwindung und die Gestaltung des eigenen Lebens.
Besteht ein Zusammenhang zwischen Nietzsches Philosophie und dem Darwinismus?
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Nietzsches Philosophie und dem Darwinismus. Dieser Vergleich beleuchtet mögliche Einflüsse und Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen beiden Denkansätzen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nietzsche, Übermensch, Also sprach Zarathustra, Höhlengleichnis, Platon, drei Verwandlungen, ewige Wiederkehr, Darwinismus, Moral, Selbstüberwindung.
- Quote paper
- Doreen Klink (Author), 2019, Der Begriff des Übermenschen in "Also sprach Zarathustra" von Friedrich Nietzsche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1225330