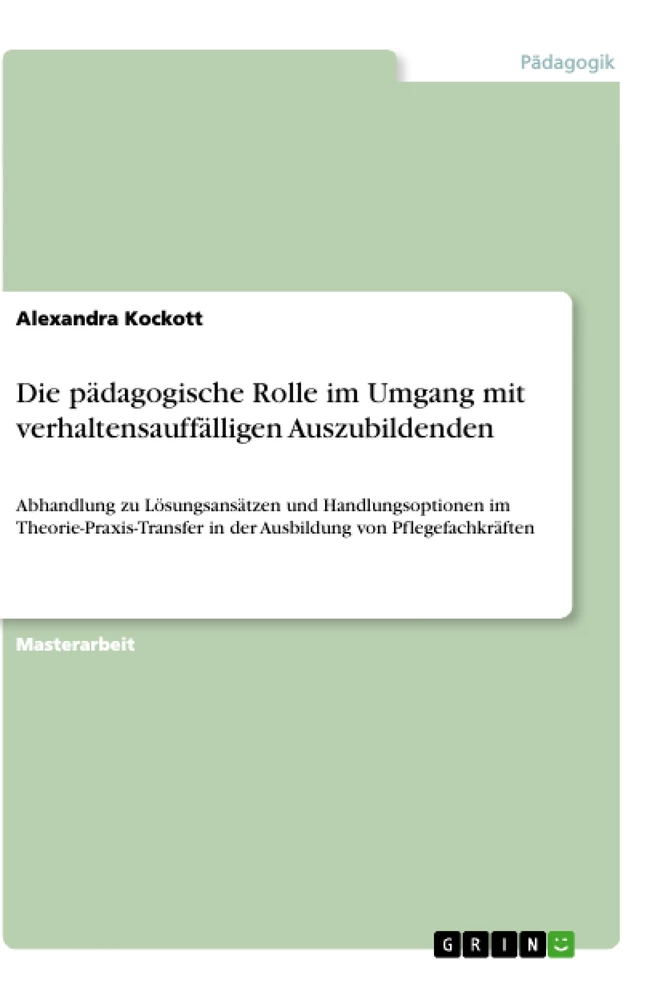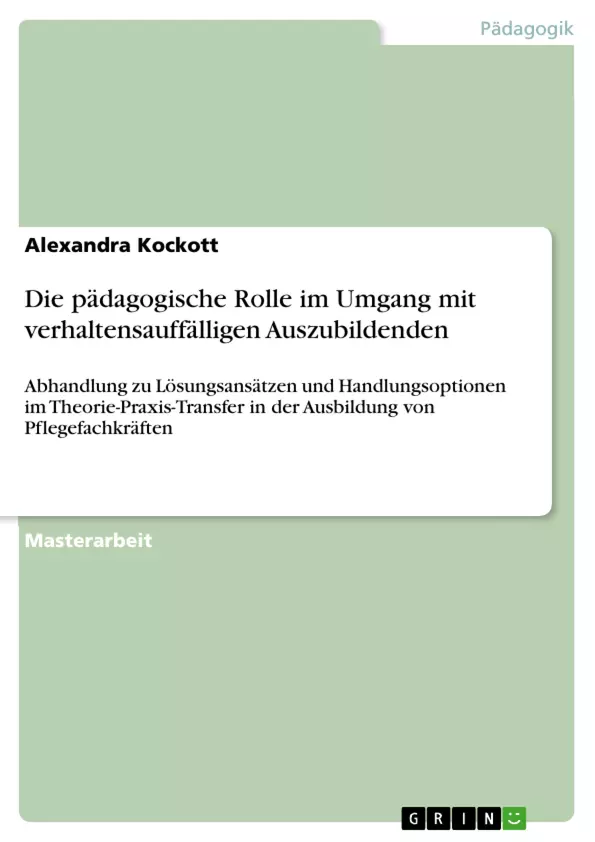Im ersten Teil dieser Arbeit werden Begrifflichkeiten definiert sowie Erklärungsmodelle und die Ätiologie für Verhaltensauffälligkeiten versus Verhaltensstörungen untersucht. Einen weiteren Raum in den Ausführungen nimmt die Vorstellung des Lern- und Arbeitsumfeldes von Auszubildenden ein und macht die Komplexität und den Anspruch in der Pflegeausbildung deutlich. In der weiteren Bearbeitung werden die Rollen der Lehrenden, die in der theoretischen beruflichen Bildung für zukünftige Pflegefachpersonen tätig sind, näher betrachtet. Die verhaltensauffälligen jungen Erwachsenen brauchen sowohl anerkennungs- als auch beziehungsstiftende Interaktionen im Kontext der Ausbildung, um mögliche Unsicherheiten zu verringern und ihre Persönlichkeit zu stärken. Da hier sowohl die Anerkennungstheorie von Wolfgang Müller-Commichau als auch die Theorie der Persönlichkeitsbildung nach Rolf Arnold für die Arbeit der Pflegepädagoginnen und Pflegepädagogen mit betreuungsintensiveren Auszubildenden einen guten Lösungsansatz schaffen könnten, werden beide von der Autorin vorgestellt.
In Fragen der Gestaltung von Beziehungsprozessen spielt auch der Punkt der Emotionalen Kompetenz eine wichtige Rolle, weshalb auch diesem Thema ein Kapitel gewidmet wird. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass bei der folgenden Erarbeitung das erwachsenenpädagogische Handeln im Vordergrund steht und nicht die Therapie, obwohl Enno Schmitz sagt, das das, was ein Therapeut, ein Berater oder ein Erwachsenenpädagoge praktisch tut, in jedem Fall zugleich Elemente therapeutischen, beratenden und erwachsenenpädagogischen Handelns enthält. In der abschließenden Bearbeitung soll ein Bezugsrahmen geschaffen werden, der Gestaltungsmaßnahmen zur Zielerreichung anbietet und somit die Antwort auf die folgende Forschungsfrage liefert:
Welche Handlungsmöglichkeiten stehen den Lehrenden an einer berufsbildenden Schule für Pflegefachberufe innerhalb ihrer pädagogischen Rolle zur Verfügung, um für verhaltensauffällige Auszubildende ein stabiles Lern- und Arbeitsumfeld zu fördern und wo sind die Grenzen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entdeckungszusammenhang des Themas
- Aufbau der Arbeit und die zentrale Forschungsfrage
- Begrifflichkeiten und Definitionen
- Definition Verhalten
- Begriffsbestimmung Verhaltensauffälligkeit versus Verhaltensstörung
- Ätiologie
- Ursache in der Persönlichkeit
- Familiäre Hintergründe
- Das außerfamiliäre Umfeld
- Der Generationenaspekt
- Gesellschaftliche Faktoren
- Lebensereignisse
- Definition pädagogisches Team in der Pflegeausbildung
- Definition Rolle
- Das Lern- und Tätigkeitsumfeld in der Ausbildung von Pflegefachkräften
- Lernort Schule
- Lernort Praxis
- Die Lernenden
- Die Lehrenden
- Das Ausbildungskonzept der Theorie
- Die Rolle der Auszubildenden einer schulischen Lerngemeinschaft
- Das Ausbildungskonzept der Praxis
- Die Auszubildenden in einem kooperationsengen Team einer Krankenstation
- Die Rollen von Lehrkräften in der beruflichen Bildung
- Die Lehrenden an der berufsbildenden Schule für Pflegeberufe
- Der Stellvertreter der Auszubildenden
- Der Anwalt
- Der Wegweisende
- Der Vermittler
- Der soziale Befürworter
- Anerkennende Beziehungsgestaltung, Persönlichkeitsbildung und emotionale Kompetenz in der pädagogischen Arbeit
- Die Theorie der Anerkennungspädagogik
- Persönlichkeitsbildung - auch eine Zielperspektive pädagogischer Arbeit?
- Die Bedeutung von emotionaler Kompetenz
- Handlungsoptionen und Lösungsansätze
- Beziehungsgestaltung als Grundlage für Entwicklungsprozesse
- Werte und Normen
- Anerkennung und Gleichwertigkeit
- Dialoge und Impulse
- Feedback und Bestärkung
- Grenzen im Umgang mit verhaltensauffälligen und betreuungsintensiven Auszubildenden
- „Lehrende sind auch nur Menschen“
- Die eigene Belastbarkeit – erkennen oder ignorieren und die Folgen
- Wege zu mehr Entlastung für die Lehrenden
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der pädagogischen Rolle im Umgang mit verhaltensauffälligen Auszubildenden in der Pflegefachkräfteausbildung. Der Fokus liegt auf der Analyse von Lösungsansätzen und Handlungsoptionen im Theorie-Praxis-Transfer. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Möglichkeiten pädagogischer Arbeit in diesem Kontext zu entwickeln.
- Analyse von Verhaltensauffälligkeiten bei Auszubildenden
- Definition und Einordnung pädagogischer Rollen im Ausbildungsprozess
- Bedeutung von Anerkennung, Persönlichkeitsbildung und emotionaler Kompetenz
- Entwicklung von Handlungsoptionen für die pädagogische Praxis
- Reflexion der eigenen Belastbarkeit und Entlastungsstrategien für Lehrende
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Entdeckungszusammenhang des Themas dar und definiert die Forschungsfrage. Kapitel 2 befasst sich mit Begrifflichkeiten und Definitionen, einschließlich der Definition von Verhalten, Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung. Die Ätiologie von Verhaltensauffälligkeiten wird unter verschiedenen Aspekten wie Persönlichkeit, familiären Hintergründen, außerfamiliärem Umfeld, Generationenaspekt, gesellschaftlichen Faktoren und Lebensereignissen beleuchtet. Kapitel 3 untersucht das Lern- und Tätigkeitsumfeld in der Ausbildung von Pflegefachkräften, einschließlich Lernort Schule, Lernort Praxis, Lernenden, Lehrenden, Ausbildungskonzept der Theorie und Praxis. Die Rollen von Lehrkräften in der beruflichen Bildung werden in Kapitel 4 näher beleuchtet, wobei verschiedene Rollen wie Stellvertreter der Auszubildenden, Anwalt, Wegweisender, Vermittler und sozialer Befürworter betrachtet werden. Kapitel 5 befasst sich mit der Bedeutung von Anerkennung, Persönlichkeitsbildung und emotionaler Kompetenz in der pädagogischen Arbeit, einschließlich der Theorie der Anerkennungspädagogik. In Kapitel 6 werden verschiedene Handlungsoptionen und Lösungsansätze zur Gestaltung von Beziehungen als Grundlage für Entwicklungsprozesse vorgestellt. Kapitel 7 behandelt die Grenzen im Umgang mit verhaltensauffälligen und betreuungsintensiven Auszubildenden. In Kapitel 8 wird die eigene Belastbarkeit von Lehrenden thematisiert und es werden Wege zur Entlastung aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Verhaltensauffällige Auszubildende, Pflegeausbildung, Pädagogische Rolle, Lösungsansätze, Handlungsoptionen, Theorie-Praxis-Transfer, Anerkennungspädagogik, Persönlichkeitsbildung, Emotionale Kompetenz, Beziehungsgestaltung, Belastbarkeit, Entlastung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung?
Die Arbeit untersucht Definitionen und Erklärungsmodelle, um abweichendes Verhalten abzugrenzen, wobei Verhaltensstörungen oft tiefergehende klinische Ursachen haben, während Auffälligkeiten oft situativ oder entwicklungsspezifisch sind.
Welche Rolle spielen Lehrende in der Pflegeausbildung bei verhaltensauffälligen Schülern?
Lehrende agieren in verschiedenen Rollen, etwa als Stellvertreter, Anwalt, Wegweisender, Vermittler oder sozialer Befürworter, um ein stabiles Lernumfeld zu schaffen.
Was besagt die Anerkennungspädagogik nach Müller-Commichau?
Sie betont die Bedeutung von anerkennungs- und beziehungsstiftenden Interaktionen, um Unsicherheiten bei Auszubildenden zu verringern und ihre Persönlichkeit zu stärken.
Warum ist emotionale Kompetenz für Pflegepädagogen wichtig?
Emotionale Kompetenz ermöglicht es Lehrenden, Beziehungs- und Entwicklungsprozesse professionell zu gestalten und auf die Bedürfnisse betreuungsintensiver Auszubildender einzugehen.
Wo liegen die Grenzen der pädagogischen Arbeit mit schwierigen Auszubildenden?
Die Arbeit reflektiert die Belastbarkeit der Lehrenden und betont, dass pädagogisches Handeln zwar therapeutische Elemente enthalten kann, aber keine klinische Therapie ersetzt.
- Quote paper
- Alexandra Kockott (Author), 2021, Die pädagogische Rolle im Umgang mit verhaltensauffälligen Auszubildenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1225436