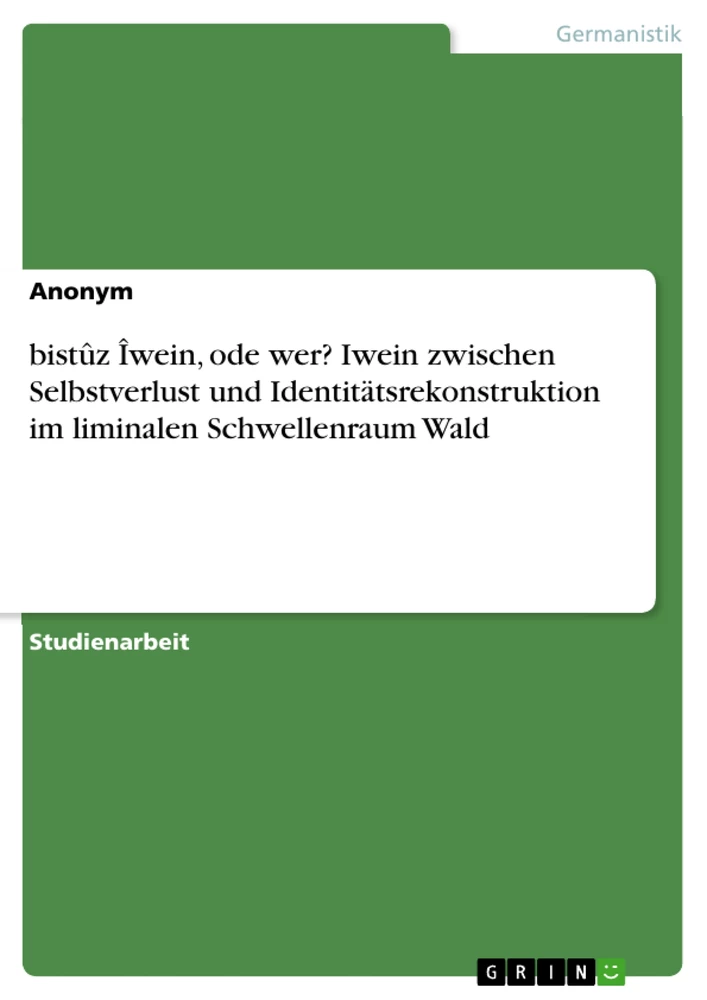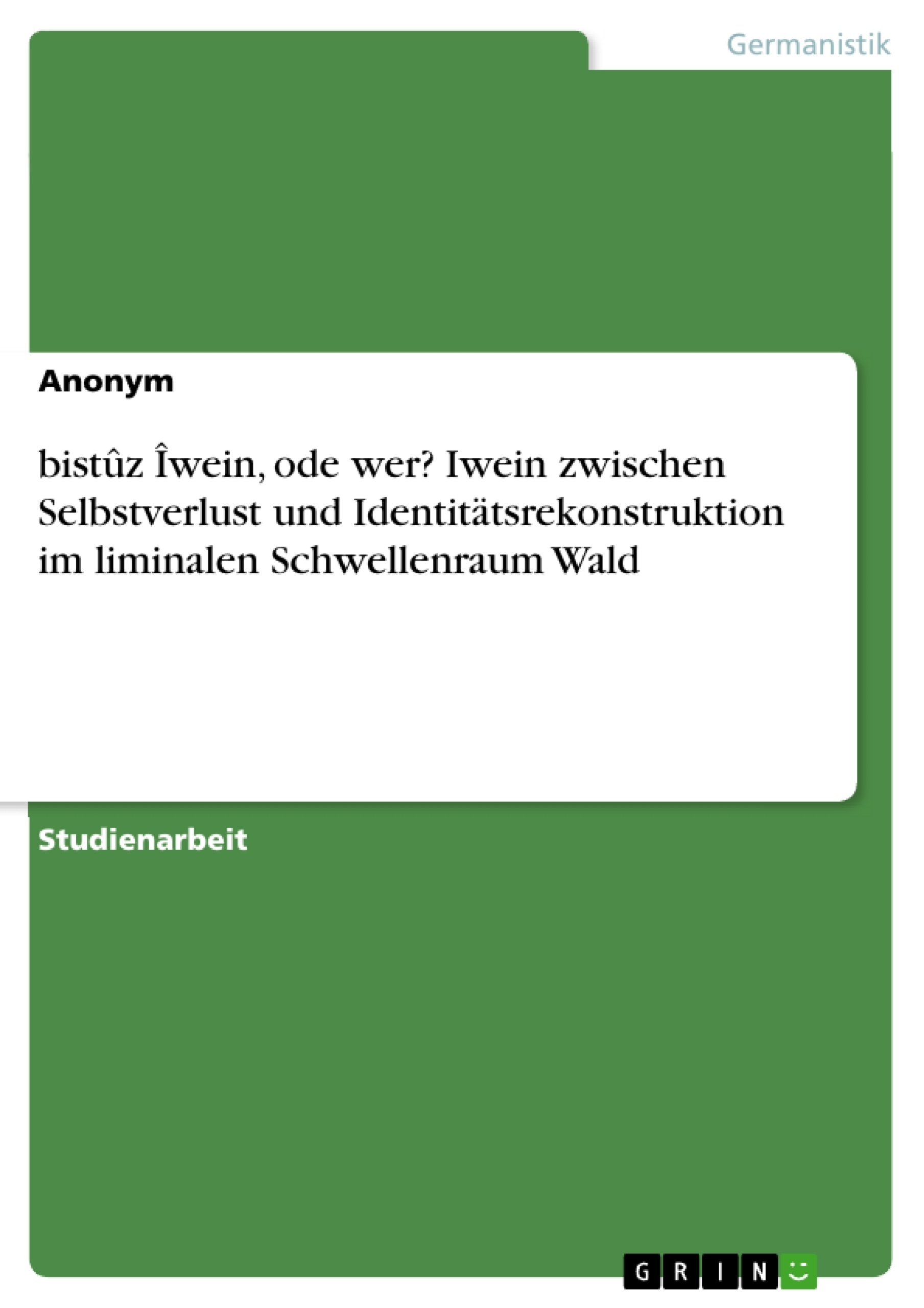Diese Arbeit soll beweisen, dass der Raum des Waldes eine Grundlage für die Auseinandersetzung mit der eigenen Person bietet und unter Einbezug des Wahnsinns den Ausgangspunkt für die weitere Identitätsentwicklung Iweins liefert. Im Verlauf der Untersuchungen wird sich herausstellen, inwiefern der Naturraum Wald in Hartmanns von Aue Iwein als eine Art liminaler Schwellenraum fungiert.
Inhaltsverzeichnis
- Konkretisierung der Fragestellung und des Vorgehens
- Die Bedeutung der Raumstrukturen in Hartmanns von Aue Iwein im besonderen Hinblick auf den Raum Wald
- Zwischen Identitätsverlust und -rekonstruktion - Iwein als edeler tôre im vorkultürlichen Naturraum Wald
- Der Wald als gegensätzliche Konstruktion zur höfischen Zivilisation
- Wildnis und Identitätskrise – Zwischenstation zur Wiedererlangung des Selbst
- bistûz Îwein, ode wer? - Iweins identitäre Rekonstruktion und Wiederaufbau der außerpersonellen Verbindungen
- Der Naturraum Wald als liminaler Schwellenraum in der Identitätsentwicklung Iweins
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verzahnung von Raumstrukturen, insbesondere des Waldes, und Iweins Identitätsentwicklung in Hartmanns von Aue's Roman. Das Hauptziel ist es, die Rolle des Wahnsinns für Iweins Identitätsverlust und -rekonstruktion zu beleuchten und den Wald als liminalen Schwellenraum zu analysieren. Die Arbeit basiert auf bestehenden Forschungsansätzen, insbesondere dem von Ludger Lieb.
- Die Bedeutung von Raumstrukturen in Hartmanns Iwein
- Der Wald als Gegensatz zur höfischen Zivilisation
- Iweins Identitätsverlust und -rekonstruktion im Wald
- Der Wald als liminaler Schwellenraum
- Die Rolle des Wahnsinns in Iweins Identitätsentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Konkretisierung der Fragestellung und des Vorgehens: Dieses Kapitel legt die Forschungsfrage dar: Wie sind die Raumstrukturen, insbesondere der Wald, mit Iweins Identitätsentwicklung verwoben? Es wird der Fokus auf Iweins Wahnsinn und dessen Bedeutung für den Identitätsverlust und die -rekonstruktion gelegt. Die Arbeit basiert auf dem Forschungsansatz von Ludger Lieb und gliedert sich in die Untersuchung des Waldes als Raum der Identitätsfindung und die Gegenüberstellung des Waldes mit dem höfischen Raum. Es wird die These aufgestellt, dass der Wald als liminaler Schwellenraum für Iweins Entwicklung fungiert.
2. Die Bedeutung der Raumstrukturen in Hartmanns von Aue Iwein im besonderen Hinblick auf den Raum Wald: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung von Raumstrukturen in Hartmanns Iwein, basierend auf Ludger Liebs Forschungsansatz. Lieb gliedert die Räume in vier Bereiche: Natur (Wald), Hof Laudines, Artushof und Burgen anderer Herrscher. Der Wald bildet die Grundlage für die anderen Räume und spiegelt Iweins Verbindungen zu sich selbst (ICH), Laudine/Lunete (DU), der Rittergemeinschaft (WIR) und der Gesellschaft (SIE) wider. Der Wald fungiert als Schutzraum und visualisiert Iweins inneren Selbstverlust durch sein chaotisches Dickicht. Seine temporäre Funktion als Übergangsraum zwischen zivilisierter Welt und Chaos wird hervorgehoben.
3. Zwischen Identitätsverlust und -rekonstruktion – Iwein als edeler tôre im vorkultürlichen Naturraum Wald: Dieses Kapitel untersucht den Wald als zentralen Ort für Iweins Identitätsentwicklung. Es wird die Opposition zwischen dem Wald als vorkultürlichem Raum und der höfischen Welt herausgearbeitet. Der Wald wird als Ort des Selbstverlustes, aber auch der Selbstfindung beschrieben. Iweins Entwicklung im Wald und die Bedingungen seiner Rückkehr in die Gesellschaft werden analysiert. Die Kapitel unterstreichen, wie der Wald als Gegenpol zur höfischen Gesellschaft die Möglichkeit zu einer intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Identität bietet.
Schlüsselwörter
Hartmann von Aue, Iwein, Identitätsentwicklung, Raumstrukturen, Wald, Liminaler Schwellenraum, Identitätsverlust, Identitätsrekonstruktion, höfische Gesellschaft, Wahnsinn, Ludger Lieb.
Häufig gestellte Fragen zu: Raumstrukturen und Identitätsentwicklung in Hartmanns von Aue Iwein
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die enge Verbindung zwischen Raumstrukturen, insbesondere dem Wald, und der Identitätsentwicklung des Protagonisten Iwein in Hartmanns von Aue's epischem Roman. Im Fokus steht dabei die Rolle des Wahnsinns für Iweins Identitätsverlust und seine anschließende Rekonstruktion. Der Wald wird als ein liminaler Schwellenraum analysiert, der Iweins Entwicklung maßgeblich prägt.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf bestehende Forschungsansätze, insbesondere die von Ludger Lieb, der Räume in verschiedene Kategorien unterteilt. Die Analyse konzentriert sich auf die Gegenüberstellung des Waldes als vorkultürlichen Naturraums und der höfischen Zivilisation. Es wird untersucht, wie diese gegensätzlichen Räume Iweins Identität beeinflussen.
Welche Rolle spielt der Wald in Iweins Identitätsentwicklung?
Der Wald wird als zentraler Ort für Iweins Identitätsfindung und -verlust dargestellt. Er fungiert als Gegenpol zur höfischen Gesellschaft und bietet Iwein die Möglichkeit, sich intensiv mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen. Das chaotische Dickicht des Waldes spiegelt Iweins inneren Zustand des Selbstverlustes wider, während er gleichzeitig einen Schutzraum und einen Übergangsraum zwischen Ordnung und Chaos darstellt.
Wie wird der Wald in der Arbeit charakterisiert?
Der Wald wird als liminaler Schwellenraum interpretiert, der die Übergänge zwischen verschiedenen Phasen von Iweins Identitätsentwicklung markiert. Er steht im Gegensatz zur höfischen Zivilisation und repräsentiert Wildnis, Chaos und die Konfrontation mit dem eigenen Selbst. Durch die Auseinandersetzung mit dem Wald vollzieht Iwein seine Identitätsrekonstruktion.
Welche weiteren Raumstrukturen werden berücksichtigt?
Neben dem Wald werden auch der Hof Laudines, der Artushof und die Burgen anderer Herrscher als relevante Raumstrukturen betrachtet. Diese Räume werden im Kontext ihrer Beziehung zum Wald und zu Iweins Identitätsentwicklung analysiert. Die räumliche Struktur des Romans spiegelt Iweins Beziehungen zu sich selbst, Laudine/Lunete, der Rittergemeinschaft und der Gesellschaft wider.
Welche Bedeutung hat der Wahnsinn in der Arbeit?
Der Wahnsinn Iweins wird als entscheidender Faktor für seinen Identitätsverlust betrachtet. Die Arbeit beleuchtet, wie der Wahnsinn durch die räumliche Umgebung (insbesondere den Wald) beeinflusst wird und umgekehrt, wie die räumlichen Erfahrungen Iweins Wahnsinn und dessen Überwindung prägen.
Welche These wird in der Arbeit aufgestellt?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass der Wald als liminaler Schwellenraum eine entscheidende Rolle in Iweins Identitätsentwicklung spielt. Der Wald fungiert als Ort des Selbstverlustes und gleichzeitig als Raum der Selbstfindung und Rekonstruktion.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Konkretisierung der Fragestellung und des Vorgehens; Die Bedeutung der Raumstrukturen in Hartmanns von Aue Iwein im besonderen Hinblick auf den Raum Wald; Zwischen Identitätsverlust und -rekonstruktion – Iwein als edeler tôre im vorkultürlichen Naturraum Wald; Der Naturraum Wald als liminaler Schwellenraum in der Identitätsentwicklung Iweins.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hartmann von Aue, Iwein, Identitätsentwicklung, Raumstrukturen, Wald, Liminaler Schwellenraum, Identitätsverlust, Identitätsrekonstruktion, höfische Gesellschaft, Wahnsinn, Ludger Lieb.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2022, bistûz Îwein, ode wer? Iwein zwischen Selbstverlust und Identitätsrekonstruktion im liminalen Schwellenraum Wald, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1225478