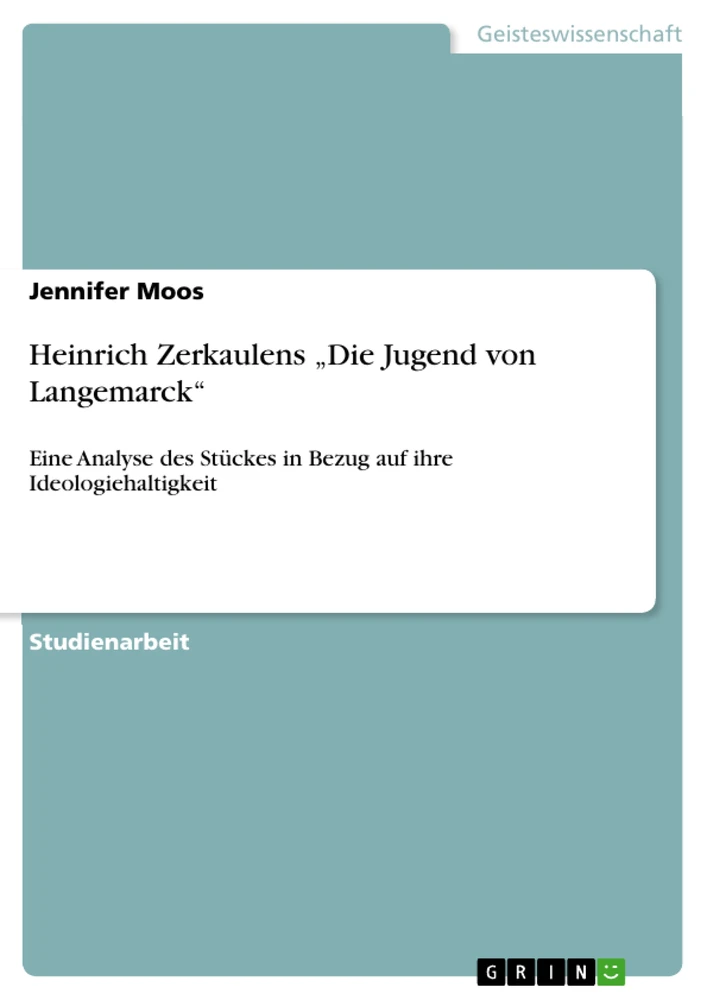In den 20er Jahren wurden die Eindrücke aus dem zeitlich noch sehr nahen ersten
Weltkrieg von vielen Literaten in ihren Werken verarbeitet.
Hierbei ging es nicht nur darum ganz persönliche Erlebnisse von der Front oder die
Atmosphäre im Volk wiederzugeben, sondern auch darum, einen Sinn für diesen Krieg zu
finden. Unter den Autoren gab es demnach nicht nur patriotische, sondern auch viele
pazifistische und kriegsgegnerische.
Mit der „Notverordnung zum Schutze von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 ließ
Hitler jegliche dieser Stimmen verstummen, indem er alle Personen, die für die
Kriegsdienstverweigerung und die Auffassung von einer Mitschuld Deutschlands am ersten
Weltkrieg eintraten, mit dem Tode bestrafen ließ.
Dem Krieg und den vielen Todesopfern einen Sinn zu geben, das war das Ziel der neuen
Dramatik, für die im Nationalsozialismus das Schlagwort „Dramatik aus dem
Fronterlebnis“ geprägt wurde. Die Aussage der Stücke lautete allgemein: „Die heroischen
Kämpfer des ersten Weltkriegs starben, den Sieg des Nationalsozialismus vorahnend, für
die anbrechende neue Zeit.“
Das wiederbeschworene „Herz der Front“: das ist die erfahrene Kameradschaft, das
vereinigende Erlebnis durchgestandener Gefahr und gegenseitigen Helfens, das Gefühl,
eine Gemeinschaft auf Leben und Tod für ein gemeinsames Ziel gegen einen gemeinsamen
Gegner gewesen zu sein, auch das Erlebnis der „Pflicht und der Ehre“, wie Ernst Jünger es
formuliert; das ist aber auch die Erfahrung vom Ende der Kastengesellschaft des
Kaiserreiches als Grundlegung für einen neuen, von Kameradschaft geprägten
Sozialismus
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Inhaltliche Zusammenfassung des Stückes
- I.1 Der erste Akt
- I.2 Der zweite Akt
- I.3 Der dritte Akt
- I.4 Das Nachspiel
- II. Analyse des Stückes auf seine Ideologiehaltigkeit
- II.1 Die Volksgemeinschaft
- II.2 Die heroische Opferbereitschaft
- II.3 Die Pflicht
- II.4 Die Jugend
- III. Zum Autor und der Entwicklung des Stückes
- Literaturangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Heinrich Zerkaulens Stück „Die Jugend von Langemarck“ hinsichtlich seiner Ideologiehaltigkeit im Kontext des Nationalsozialismus. Das Stück wurde im Nationalsozialismus als Ausdruck der „Dramatik aus dem Fronterlebnis“ verstanden, die den Krieg und seine Opfer im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie glorifizierte.
- Die Konstruktion der Volksgemeinschaft und ihrer Bedeutung im Kontext des Krieges
- Die Inszenierung heroischer Opferbereitschaft und ihre Verbindung zur nationalsozialistischen Ideologie
- Die Rolle der Pflicht und des Dienstes für das Vaterland im Stück
- Die Darstellung der Jugend als tragende Säule der nationalsozialistischen Bewegung
- Die Verbindung zwischen der Kriegshandlung und der neuen Zeit des Nationalsozialismus
Zusammenfassung der Kapitel
I. Inhaltliche Zusammenfassung des Stückes
I.1 Der erste Akt
Der erste Akt spielt im Haus der Fabrikbesitzerin Gärtner, die mit ihrer Nichte Christa und drei leitenden Angestellten auf den Sohn Franz wartet. Franz verkündet stolz, dass er sich und seine Burschenschaft als Freiwillige zum Kriegsdienst gemeldet haben. Die Fabrikarbeiter, darunter Karl Stanz, folgen diesem Beispiel. Luise Gärtner setzt jedoch das Testament ihres verstorbenen Mannes durch, das Franz im Falle eines Krieges die Leitung der Fabrik übernehmen lässt. Franz verlässt gegen den Willen seiner Mutter und Christa das Haus, um zu seinem Regiment zu fahren.
I.2 Der zweite Akt
Der zweite Akt spielt in einem Notquartier eines flandrischen Dorfes. Franz Gärtner und Karl Stanz befinden sich in derselben Kompanie. Sie lesen sich Briefe ihrer Mütter vor und sprechen über ihre Ängste, Kameradschaft und den Krieg. Am Ende des Aktes wird Franz Gärtner nach Hause beordert, doch er überzeugt den Hauptmann, ihn in der Kompanie zu behalten.
I.3 Der dritte Akt
Der dritte Akt spielt in der Hügelbefestigung der Engländer westlich von Langemarck am 10. November 1914. Die Lage der Deutschen erscheint aussichtslos, doch sie haben die Telefonleitungen der Engländer zerstört. Karl Stanz wird als Gefangener genommen und schwer verwundet. Er schweigt beim Verhör und singt mit den anderen Deutschen das Deutschlandlied, bevor der Akt im Maschinengewehrfeuer endet.
I.4 Das Nachspiel
Das Nachspiel spielt im Haus der Gärtners. Alle erwarten die wenigen zurückkehrenden Soldaten. Franz Gärtner und die anderen Jungen aus dem Regiment sind gefallen. Nur Karl Stanz hat überlebt. Frau Gärtner bietet ihm ein Studium am Technikum an, damit er die Position ihres Sohnes in der Firma übernehmen kann. Zunächst lehnt Karl Stanz das Angebot ab, doch schließlich nimmt er es an, mit der Erkenntnis: „Sie starben für Langemarck, wir leben für Langemarck.“
Schlüsselwörter
Das Stück „Die Jugend von Langemarck“ behandelt die Themen Krieg, Volksgemeinschaft, Opferbereitschaft, Pflicht, Jugend und Nationalsozialismus. Die Analyse konzentriert sich auf die ideologische Aufladung des Stückes und die Inszenierung dieser Schlüsselbegriffe im Kontext der nationalsozialistischen Propaganda. Das Stück dient als Beispiel für die „Dramatik aus dem Fronterlebnis“ und die Konstruktion einer heroischen Opferbereitschaft im Dienste des Vaterlandes.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Heinrich Zerkaulens Stück „Die Jugend von Langemarck“?
Das Stück thematisiert den Einsatz von Kriegsfreiwilligen im Ersten Weltkrieg und glorifiziert deren Opferbereitschaft im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie.
Was bedeutet der Begriff „Dramatik aus dem Fronterlebnis“?
Dies war ein Schlagwort der NS-Zeit für Literatur, die den Krieg als heroisches Gemeinschaftserlebnis darstellte und den Tod an der Front als sinnvollen Dienst für die „neue Zeit“ umdeutete.
Wie wird die „Volksgemeinschaft“ im Stück dargestellt?
Das Stück inszeniert die Aufhebung von Klassenschranken (z. B. zwischen Fabrikantensohn und Arbeiter) durch die gemeinsame Kameradschaft und das gemeinsame Opfer im Krieg.
Welche Rolle spielt die Figur des Karl Stanz?
Karl Stanz überlebt als Einziger und verkörpert die Brücke zwischen den Gefallenen und den Überlebenden, die das Erbe von Langemarck in der Heimat weiterführen sollen.
Warum wurde das Stück im Nationalsozialismus so stark gefördert?
Es diente der Propaganda, um Tugenden wie Pflichtbewusstsein, heroische Opferbereitschaft und bedingungslose Treue zum Vaterland bei der Jugend zu verankern.
- Quote paper
- Magister Artium Jennifer Moos (Author), 2002, Heinrich Zerkaulens „Die Jugend von Langemarck“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122580