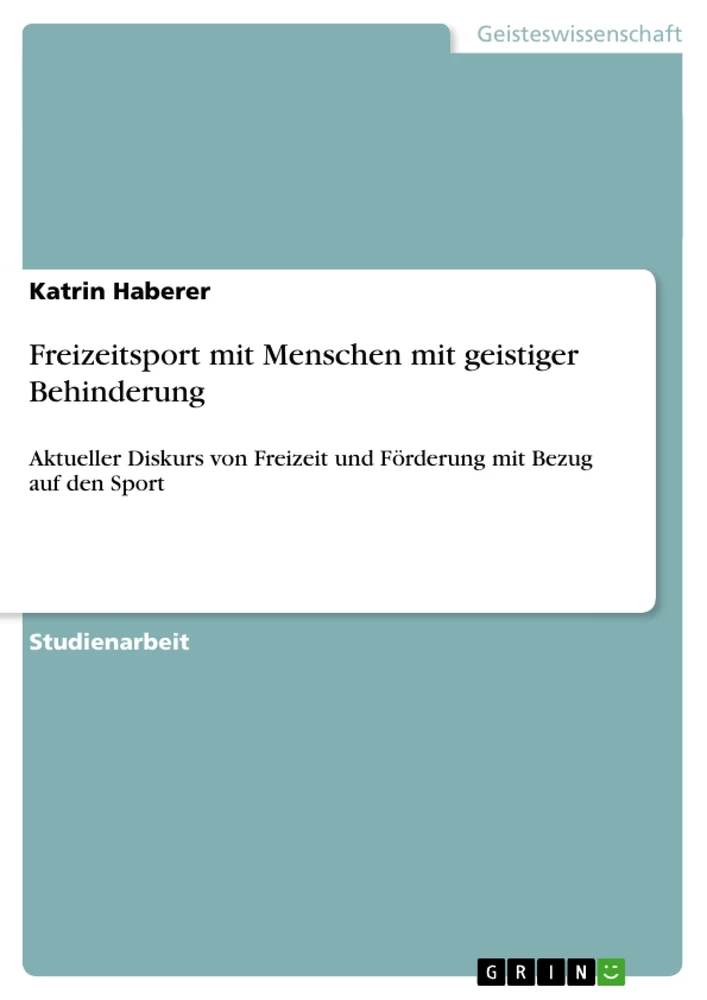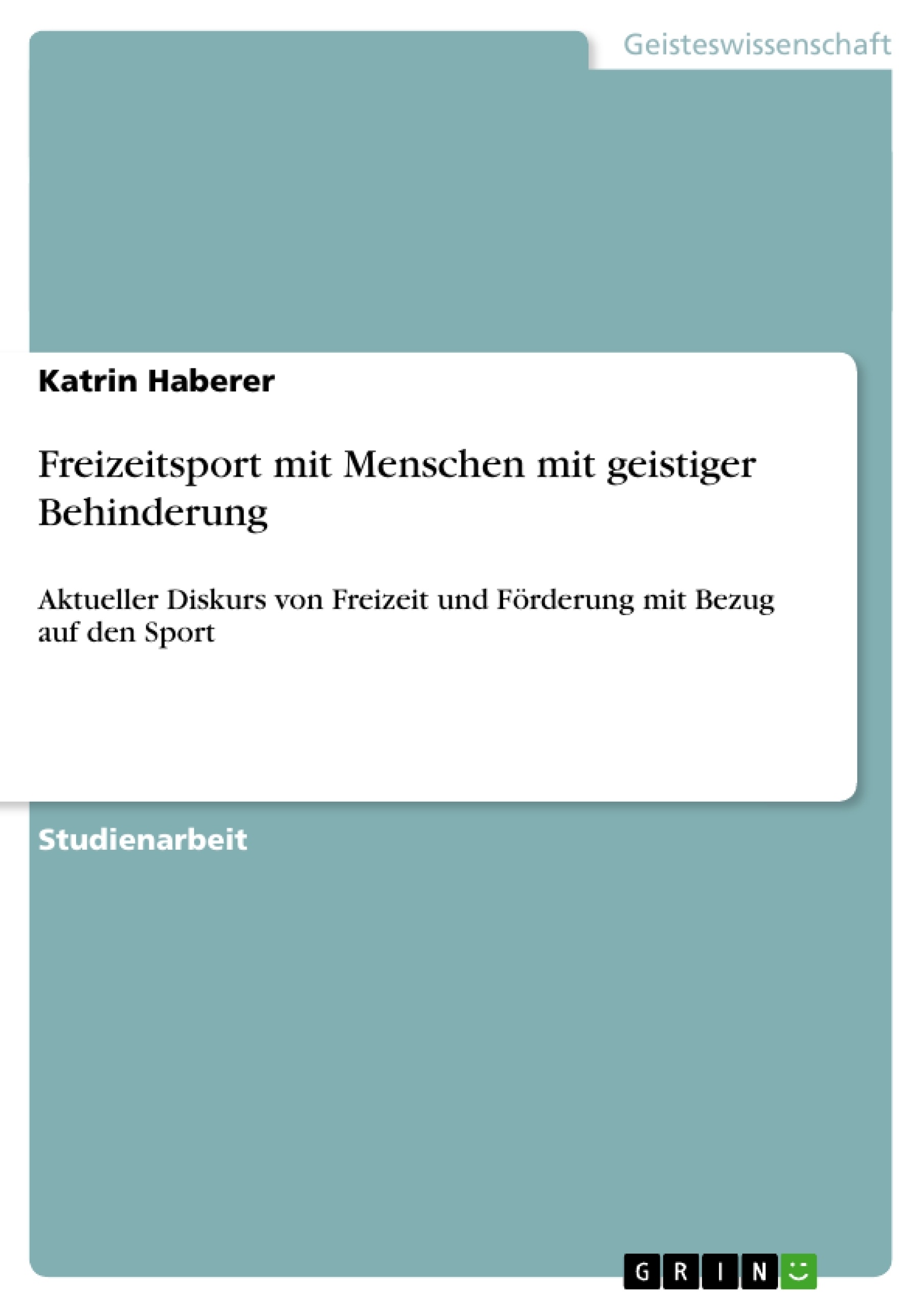Der Freizeitbereich hat sich in den letzten Jahrzehnten und auch in der
fortlaufenden Entwicklung als ein zunehmend großes Bedeutungsfeld
herausgestellt.1 Sportliche Aktivitäten (Bewegung, Spiel und Sport) haben sich
dabei als beliebter sowie pädagogisch und medizinisch als förderlich empfohlener
Sektor der Freizeitbetätigung erwiesen und erfreut sich eines großen Spektrums an
aktiven Vertretern in allen Gesellschaftsgruppen – besonders auch bei Menschen
mit geistiger Behinderung.2
In der folgenden Arbeit möchte ich zu Beginn der Frage nachgehen, welche
Bedeutung Freizeit an sich für Menschen mit einer geistigen Behinderung hat
bzw. haben kann. Aus der hier vorweg genommenen Hypothese heraus, dass
Freizeit ein förderungsfreies Feld sein sollte, soll anschließend die Untersuchung
geführt werden, ob und wenn ja welche Wirkung ein nicht therapeutisch
konzeptionierter Freizeitsport für Menschen mit einer geistigen Behinderung
haben kann. Zum einen von der Voraussetzung auszugehen, dass Freizeit nicht
pädagogisiert werden sollte, zum anderen jedoch die impliziten positiven
Auswirkungen von Bewegung zu untersuchen, scheint hier zwar vorerst paradox;
doch möchte ich damit veranschaulichen, dass Freizeitaktivitäten nicht immer ein
pädagogisches Konzept haben müssen, um trotzdem aus der Motivation „Spaß“
heraus positive Wirkungen bei den Teilnehmern zu entfalten. Dabei muss
allerdings von vorne herein klar sein, dass die Wirkung nicht im Vordergrund
steht, sondern in einem bewusst förderungsfreien Raum als positiver Nebeneffekt
gesehen werden muss.
Im weiteren Verlauf und der Inbezugsetzung von Freizeit und Sport werde ich
nicht weiter auf die verschiedenen Rahmen eingehen, in denen Sport statt finden
kann (Sportvereine, integrative Sportfeste etc.) oder verschiedene Sportarten
spezifisch auf ihre Wirkung untersuchen; stattdessen werde ich mich an die
Grundfrage halten, ob und wie Bewegung in Form von freizeitorientiertem Sport
und Spiel sich auswirken kann.
[...]
Inhalt
A: Hausarbeit
1. Einleitung
2. Geistige Behinderung, Freizeit und Sport – Begriffsklärungen
2.1 Verständnis von „geistiger Behinderung“
2.2 Der Freizeitbegriff allgemein
2.3 Freizeitsport (Bewegung, Spiel und Sport in der Freizeit)
3. Spielerische Förderung vs. Recht auf förderungsfreien Raum - Aspekte von Freizeit für Menschen mit einer geistigen Behinderung
3.1 Selbstbestimmte Freizeitgestaltung
3.2 Subjektives Verständnis von Freizeit
3.3 Entpädagogisierung der Freizeit
3.4 Zur Freizeitsituation von Menschen mit einer geistigen Behinderung
4. Freizeitsport als entpädagogisierte Fördermöglichkeit?
4.1 Einführung
4.2 Gesundheitswissenschaftliche Aspekte von Bewegung
4.2 1 Physische Effekte
4.2.2 Persönlichkeitsentwicklung: Selbstkonzept und Verhalten
4.2.3 Freiheitskompetenz
4.2.4 Selbstaktivierung
4.2.5 Zusammenfassung und Kritik
4.3 Soziale Perspektiven von Sport und Spiel
4.3.1 Bewegung als Mitteilungsmöglichkeit
4.3.2 Das persönliche Selbstkonzept als Basis für Interaktionsprozesse
4.3.3 Soziale Kontakte durch Spiel und Sport
4.3.4 Integration durch Sport
4.3.5 Zusammenfassung und Kritik
5. Fazit und Ausblick
6. Literaturverzeichnis
A: Hausarbeit
1. Einleitung
Der Freizeitbereich hat sich in den letzten Jahrzehnten und auch in der fortlaufenden Entwicklung als ein zunehmend großes Bedeutungsfeld herausgestellt.[1] Sportliche Aktivitäten (Bewegung, Spiel und Sport) haben sich dabei als beliebter sowie pädagogisch und medizinisch als förderlich empfohlener Sektor der Freizeitbetätigung erwiesen und erfreut sich eines großen Spektrums an aktiven Vertretern in allen Gesellschaftsgruppen – besonders auch bei Menschen mit geistiger Behinderung.[2]
In der folgenden Arbeit möchte ich zu Beginn der Frage nachgehen, welche Bedeutung Freizeit an sich für Menschen mit einer geistigen Behinderung hat bzw. haben kann. Aus der hier vorweg genommenen Hypothese heraus, dass Freizeit ein förderungsfreies Feld sein sollte, soll anschließend die Untersuchung geführt werden, ob und wenn ja welche Wirkung ein nicht therapeutisch konzeptionierter Freizeitsport für Menschen mit einer geistigen Behinderung haben kann. Zum einen von der Voraussetzung auszugehen, dass Freizeit nicht pädagogisiert werden sollte, zum anderen jedoch die impliziten positiven Auswirkungen von Bewegung zu untersuchen, scheint hier zwar vorerst paradox; doch möchte ich damit veranschaulichen, dass Freizeitaktivitäten nicht immer ein pädagogisches Konzept haben müssen, um trotzdem aus der Motivation „Spaß“ heraus positive Wirkungen bei den Teilnehmern zu entfalten. Dabei muss allerdings von vorne herein klar sein, dass die Wirkung nicht im Vordergrund steht, sondern in einem bewusst förderungsfreien Raum als positiver Nebeneffekt gesehen werden muss.
Im weiteren Verlauf und der Inbezugsetzung von Freizeit und Sport werde ich nicht weiter auf die verschiedenen Rahmen eingehen, in denen Sport statt finden kann (Sportvereine, integrative Sportfeste etc.) oder verschiedene Sportarten spezifisch auf ihre Wirkung untersuchen; stattdessen werde ich mich an die Grundfrage halten, ob und wie Bewegung in Form von freizeitorientiertem Sport und Spiel sich auswirken kann.
2. Geistige Behinderung, Freizeit und Sport – Begriffsklärungen
2.1 Verständnis von „geistiger Behinderung“
Die Definitionen von Behinderung variieren je nach Disziplin (Recht, Pädagogik, Medizin, etc.) teilweise sehr stark, da jede unterschiedliche Gesichtspunkte der Behinderung besonders ins Augenmerk nimmt. In der Folge werde ich lediglich die medizinische sowie die sozialwissenschaftliche Definition anführen, da durch ihre Abgrenzung voneinander die Besonderheit des sozialen Aspekts von Behinderung deutlich wird.
In der medizinischen Begriffsklärung liegt der Schwerpunkt auf der physikalisch vorliegenden, dauerhaften Beeinträchtigung der geistigen Funktion, über welche der Bezug zu der Beeinträchtigung von Aktivitäten und schließlich zu mangelnder Partizipation in der Gesellschaft hergestellt wird.[3] Es dominiert der Blick auf das Defizit, welches die Person im Vergleich mit Menschen ohne Behinderung hat.
Anders in den Definitionen der Sozialwissenschaften; hier wird in erster Linie die Folge der medizinischen Schädigung in den Fokus genommen, welche sich behindernd auf die interaktionistische und soziale Ebene auswirkt. Der Schwerpunkt liegt damit auf der negativen Reaktion der Umgebung auf die funktionale Schädigung, nicht auf der beeinträchtigten geistigen Funktion der Person selbst.[4]
Da durch Bewegung, Spiel und Sport immer auch physische und gesundheitliche Aspekte angesprochen werden, gleichzeitig aber der Freizeitbereich von Menschen mit Behinderung zu einem großen Teil von sozialen Einrichtungen gestaltet wird, werden in der Folge beide Definitionen zum grundlegenden Verständnis relevant sein.
Des weiteren werde ich keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen und Graden der geistigen Behinderung treffen. Gleichwohl die Ausprägungen der medizinisch vorliegenden Funktionsbeeinträchtigung eine starke Auswirkung auf die Art und Möglichkeit der Lebensführung, Freizeitgestaltung und damit auch sportliche Betätigung haben,[5] soll es sich hier um eine generalisierte Diskussion von freizeitsportlichen und sozialpädagogischen Bezügen handeln, deren Ergebnisse im Einzelfall immer differenziert betrachtet und auf die Person und ihre individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse bezogen werden müssen.
2.2 Der Freizeitbegriff allgemein
Wie bereits in der Einleitung erwähnt ist die Freizeit in ihrer Abgrenzung zur effektiven Arbeitszeit heutzutage ein wichtiger und viel Raum einnehmender Lebensbereich.[6] Wie genau Freizeit nun zu definieren ist, ob sie über die Arbeit bestimmt ist, ob sie als ein eigener Lebensbereich anzusehen ist oder ob sie durch ein komplexes Gemisch aus vielerlei Abgrenzungs- und Bezugsfaktoren zu definieren ist, darüber sind sich Fachpersonen uneinig.[7] Im Folgenden zwei Lehrmeinungen, um exemplarisch den Bedeutungsrahmen im Diskurs um die Freizeitdefinition zu verdeutlichen:
Opaschowski als einer der renommiertesten Freizeittheoretiker sieht Arbeit und Freizeit nicht mehr als voneinander abzugrenzende Komplexe, sondern teilt die gesamte Lebenszeit in drei Sektoren ein, die jeweils durch ihren unterschiedlichen Grad an Selbstbestimmung der Tätigkeit gekennzeichnet sind: Determinationszeit (fremdbestimmt), Obligationszeit (gebundene Zeit) und Dispositionszeit (selbstbestimmbar).[8] Letzt genannte „freie Zeit“ definiert er als „durch freie Wahlmöglichkeiten, bewusste Entscheidung und soziales Handeln charakterisiert“.[9] Damit stellt Opaschowski den Freiheitsaspekt von Freizeit, der sich hier durch Selbstbestimmung und Interaktivität auszeichnet, in den Mittelpunkt.
Nach Habermas, der als Sozialphilosoph ebenfalls Beiträge zur Freizeittheorie verfasst hat, lässt sich Freizeit in zwei Kategorien einordnen: zum einen in die „bloße“ Freizeit, welche sich allein durch ihre Freiheit von Arbeit und anderen strukturellen Sektoren der Gesellschaft sowie ihre Möglichkeit der Individualdisponibilität auszeichnet. Und zum anderen in die „gestaltete“ Freizeit, in welcher die Freiheit zugunsten der Teilnahme an einer Beschäftigung wieder ein Stück weit aufgegeben bzw. gebunden wird.[10]
Beiden Theorien ist gemein, dass sie – unabhängig von ihren unterschiedlichen Ansichten zur Einteilung von Lebenszeit in Arbeit und Freizeit – freie Zeit eng mit Freiheit zur Selbstbestimmung verknüpfen. Dieses zentrale Verständnis von Freizeit als frei zur eigenen Entfaltung bestimmbare Zeit zieht sich durch die gesamte Literatur zum Thema[11] und wird daher als Grundlage zur weiteren Diskussion in dieser Arbeit gelten.
2.3 Freizeitsport (Bewegung, Spiel und Sport in der Freizeit)
Der Freizeitsport grenzt sich in der sportwissenschaftlichen Literatur klar vom Leistungs- bzw. Wettkampfsport ab. Idealtypische Merkmale der Abgrenzung sind dabei in allen Bereichen gegeben; nachfolgend einige Beispiele: Ziel und Motivation sind im Freizeitsport die Suche nach Freude, Spaß, Kommunikation oder Gesundheit, während im Leistungssport das Streben nach Rekorden, (öffentlicher) Anerkennung und Geldverdienst im Vordergrund stehen. Gleichzeitig steht einer Leistungs-, Geschlechts- und Altersunabhängigkeit und der betonten Vielseitigkeit im Freizeitsport eine biologische Einschränkung kombiniert mit Leistungszwang und Einseitigkeit im Wettkampfsport entgegen.[12] Interessenslage, Voraussetzungen sowie nicht im Einzelnen aufgeführte Faktoren, wie z.B. Betriebsweise und Ausübung, haben im Freizeitsport also bestimmte, an den oben beschriebenen Kriterien der Freizeit orientierte, Attribute. Kurz und prägnant lässt sich Freizeitsport als freie Entfaltung von persönlichen Bewegungsbedürfnissen definieren, die ebenfalls dem Freizeitprinzip der Selbstbestimmtheit unterliegt.
Da Sport und die nicht immer klar abzugrenzende Form der Sportspiele letztendlich Ausübungsmöglichkeiten von Bewegung sind, werde ich die drei Begriffe „Bewegung, Spiel und Sport“ nicht voneinander abgrenzen, sondern aufgrund der Gleichrangigkeit in ihrer Bedeutung für die Freizeitgestaltung von Menschen mit Behinderung paritätisch verwenden.
[...]
[1] Vgl. Cloerkes (2007), S. 314 u. 330
[2] Vgl. Wegner (2001), S. 97; Vgl. Huber (1996), S. 93 ff.; Vgl. Sander-Beuermann (1985), S. 70
[3] Vgl. ICF (2005), S. 51 ff. , 97 ff.
[4] Vgl. Cloerkes (2007), S. 5 ff.
[5] Vgl. Ebert (2000), S. 38
[6] Vgl. Opaschowski (1994), S. 15 ff.
[7] Vgl. Cloerkes (2007), S. 310
[8] Vgl. Markowetz (2007); In: Cloerkes (2007), S. 311
[9] Opaschowski (1990), S. 85; In: Cloerkes (2007), S. 310
[10] Vgl. Sander-Beuermann (1985), S. 81
[11] Vgl. Markowetz (2007); In: Cloerkes (2007), S. 309
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung von Freizeit für Menschen mit geistiger Behinderung und die potenziellen Auswirkungen von nicht-therapeutisch konzipiertem Freizeitsport. Sie argumentiert, dass Freizeit ein förderungsfreies Feld sein sollte, untersucht aber gleichzeitig die positiven Auswirkungen von Bewegung und Spiel auf die Teilnehmer.
Wie wird "geistige Behinderung" definiert?
Es werden sowohl medizinische als auch sozialwissenschaftliche Definitionen von geistiger Behinderung betrachtet. Die medizinische Definition konzentriert sich auf die dauerhafte Beeinträchtigung der geistigen Funktion, während die sozialwissenschaftliche Definition die Folgen dieser Beeinträchtigung auf die interaktionistische und soziale Ebene betont.
Was ist "Freizeit" im Kontext dieser Arbeit?
Freizeit wird eng mit Selbstbestimmung und der Freiheit zur eigenen Entfaltung verknüpft. Es werden verschiedene Theorien zur Definition von Freizeit vorgestellt, wobei die Betonung auf der Wahlfreiheit und der Möglichkeit zur bewussten Entscheidung liegt.
Was versteht man unter Freizeitsport?
Freizeitsport wird vom Leistungs- und Wettkampfsport abgegrenzt. Merkmale des Freizeitsports sind die Suche nach Freude, Spaß, Kommunikation oder Gesundheit, während der Leistungsgedanke in den Hintergrund tritt. Es geht um die freie Entfaltung von persönlichen Bewegungsbedürfnissen.
Welche Bereiche werden im Rahmen des Freizeitsports betrachtet?
Die Begriffe "Bewegung", "Spiel" und "Sport" werden synonym verwendet, da sie alle als Ausübungsmöglichkeiten von Bewegung und somit als potenzielle Aktivitäten der Freizeitgestaltung für Menschen mit Behinderung angesehen werden.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt u.a. die selbstbestimmte Freizeitgestaltung, das subjektive Verständnis von Freizeit, die Entpädagogisierung der Freizeit, die Freizeitsituation von Menschen mit einer geistigen Behinderung, gesundheitswissenschaftliche Aspekte von Bewegung, Persönlichkeitsentwicklung durch Sport und Spiel, soziale Perspektiven von Sport und Spiel sowie Integration durch Sport.
- Quote paper
- Katrin Haberer (Author), 2008, Freizeitsport mit Menschen mit geistiger Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122592