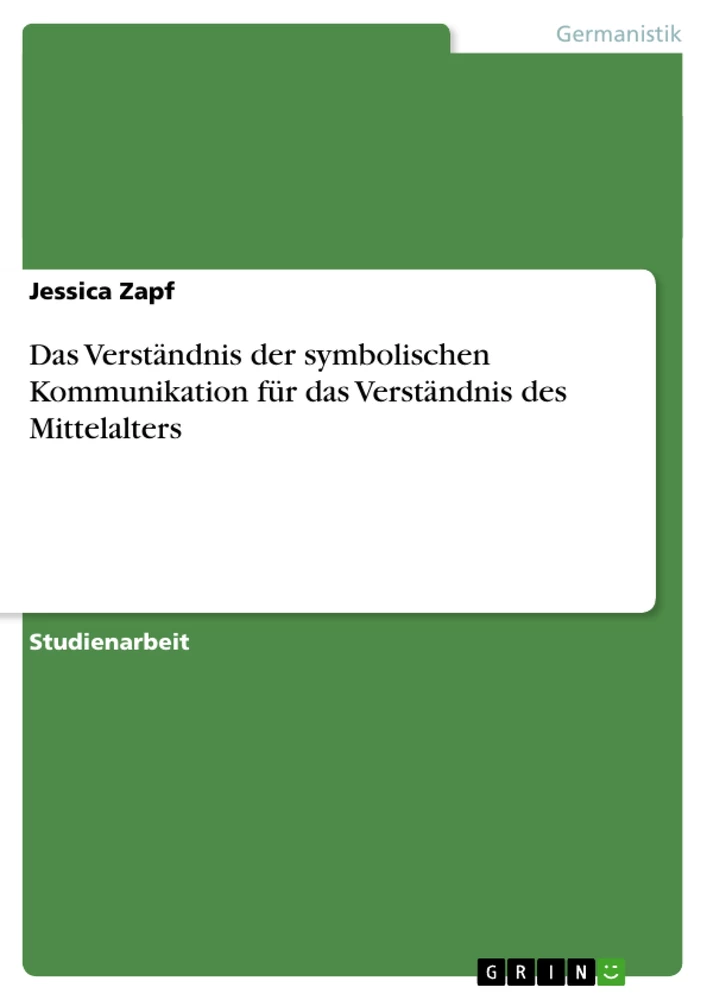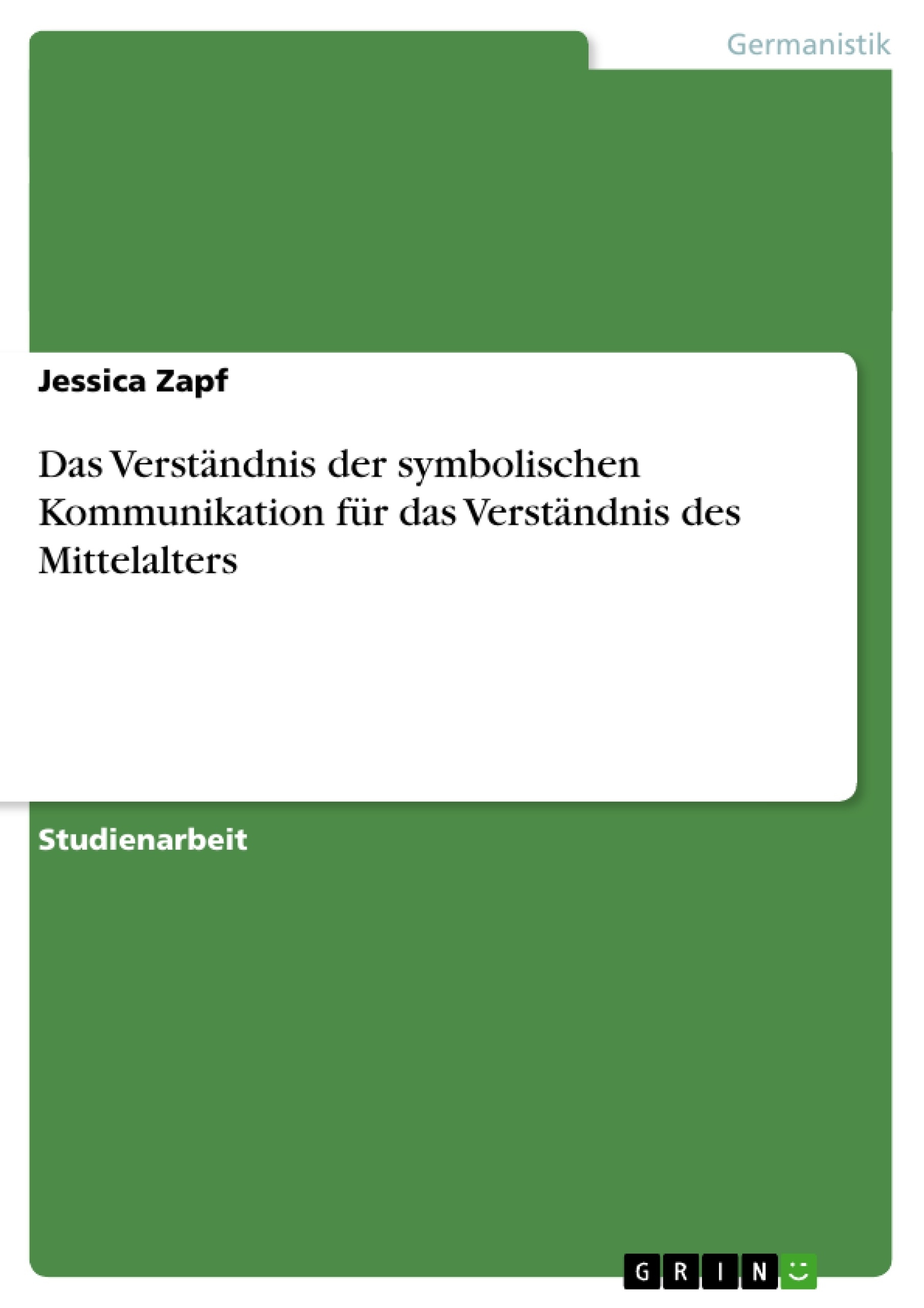„Kommunikation“ beschreibt die Übermittlung einer Nachricht von einem Sender zu einem Empfänger. Diese Nachricht wird vom Sender verschlüsselt und muss vom Empfänger entschlüsselt werden. Dieser Vorgang kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn den beiden Kommunikationspartnern die Regeln des Zeichensystems bekannt sind. Während in unserer Gesellschaft vor allem die verbale und schriftliche Kommunikation als vorherrschende Kommunikationsform gilt, kommt der nonverbalen, symbolischen Kommunikation im Mittelalter eine besondere Rolle zu. Natürlich findet diese Form auch heute noch Anwendung, jedoch war sie im Mittelalter die führende Form der öffentlichen Kommunikation und als solche ganz bestimmten Regelsystemen unterworfen.
1. Die symbolische Kommunikation
Symbolische Kommunikation beschreibt eine nonverbale Kommunikationsform, bei der Bedeutungen und Informationen mit Hilfe von Gestik, Mimik und rituellen Handlungen übermittelt werden sollen.
Im Mittelalter war der Zweck dieser Handlungen, dem Gegenüber deutlich zu machen, dass herrschende Zustände und gültige Regelsysteme akzeptiert und befolgt wurden.
„Dem Menschen stand ein differenziertes System von Zeichen, Symbolen und Verhaltensmustern zur Verfügung, mit dem er nonverbal Stand, Stellung und Rang, sein Verhältnis zum jeweiligen Gegenüber, Freundschaft und Freude, Feindschaft und Unwillen ausdrücken konnte.“
Den Menschen im Mittelalter waren diese Formen der Kommunikation so geläufig, dass ein Nicht-Einhalten dieser Gepflogenheiten deutlichen einen Konflikt anzeigte oder eine bewusste Provokation darstellte.
Die festgelegten Konventionen erleichterten die Verständigung und Konsensfindung der Herrschenden. Aktion und Reaktion wurden vorher verabredet und durch die öffentliche Ausübung legitimiert.
„Auf diese Weise konnte man Frieden und Freundschaft für die Zukunft ebenso versprechen, wie Unter- und Überordnung, Huld oder auch Dienstbereitschaft zum Ausdruck bringen.“
Im Folgenden sollen nun verschiedene Formen und Funktionen der symbolischen Kommunikation in der Öffentlichkeit des Mittelalters betrachtet und an Beispielen aus Heinrich von Veldekes Eneasroman aufgezeigt werden.
Gliederung
1. Die symbolische Kommunikation
2. Die öffentliche Bitte
Eneas Bitte an Dido
Eneas Bitte an Latinus
3. Das öffentliche Scherzen
4. Das Schenken als Zeichen der Macht und Sympathiebekundung
Eneas Geschenke für Dido
Eneas Geschenke für Latinus
Eneas beschenkt die Spielleute
5. Der öffentliche Unterwerfungsakt
Die öffentliche Unterwerfung von Turnus
6. Schlussbetrachtung
Literatur
„Kommunikation“ beschreibt die Übermittlung einer Nachricht von einem Sender zu einem Empfänger. Diese Nachricht wird vom Sender verschlüsselt und muss vom Empfänger entschlüsselt werden. Dieser Vorgang kann aber nur dann erfolgreich sein, wenn den beiden Kommunikationspartnern die Regeln des Zeichensystems bekannt sind. Während in unserer Gesellschaft vor allem die verbale und schriftliche Kommunikation als vorherrschende Kommunikationsform gilt, kommt der nonverbalen, symbolischen Kommunikation im Mittelalter eine besondere Rolle zu. Natürlich findet diese Form auch heute noch Anwendung, jedoch war sie im Mittelalter die führende Form der öffentlichen Kommunikation und als solche ganz bestimmten Regelsystemen unterworfen.
1. Die symbolische Kommunikation
Symbolische Kommunikation beschreibt eine nonverbale Kommunikationsform, bei der Bedeutungen und Informationen mit Hilfe von Gestik, Mimik und rituellen Handlungen übermittelt werden sollen.
Im Mittelalter war der Zweck dieser Handlungen, dem Gegenüber deutlich zu machen, dass herrschende Zustände und gültige Regelsysteme akzeptiert und befolgt wurden.
„Dem Menschen stand ein differenziertes System von Zeichen, Symbolen und Verhaltensmustern zur Verfügung, mit dem er nonverbal Stand, Stellung und Rang, sein Verhältnis zum jeweiligen Gegenüber, Freundschaft und Freude, Feindschaft und Unwillen ausdrücken konnte.“[1]
Den Menschen im Mittelalter waren diese Formen der Kommunikation so geläufig, dass ein Nicht-Einhalten dieser Gepflogenheiten deutlichen einen Konflikt anzeigte oder eine bewusste Provokation darstellte.
Die festgelegten Konventionen erleichterten die Verständigung und Konsensfindung der Herrschenden. Aktion und Reaktion wurden vorher verabredet und durch die öffentliche Ausübung legitimiert.
„Auf diese Weise konnte man Frieden und Freundschaft für die Zukunft ebenso versprechen, wie Unter- und Überordnung, Huld oder auch Dienstbereitschaft zum Ausdruck bringen.“[2]
Im Folgenden sollen nun verschiedene Formen und Funktionen der symbolischen Kommunikation in der Öffentlichkeit des Mittelalters betrachtet und an Beispielen aus Heinrich von Veldekes Eneasroman aufgezeigt werden.
2. Die öffentliche Bitte
Im Mittelalter galt die demütige Bitte als einzige angemessene Form, Ranghöheren Wünsche und Forderungen nahe zu bringen. Mit Hilfe eines angesehen Fürsprechers musste zunächst angefragt werden, ob eine Bitte überhaupt gestellt werden darf. Daraufhin erfolgt dann die Gewährung oder auch Ablehnung der Bittstellung. Wurde eine Bittstellung gewährt kam das meist schon mit der Willigung der Bitte gleich.
Das Vorbringen der Bitte lief nach festgelegten Handlungsabläufen statt. Der Vortrag der Bitte wurde von einer demütigen Körperhaltung, einer Verbeugung oder einem Kniefall unterstützt.
Dieser demütigen Bitte stand die gnädige Gewährung gegenüber: Man half dem Bittsteller vom Boden auf, geleitete ihn zu einem Ehrenplatz und gab ihm die Erlaubnis, die Bitte vorzutragen.
Im Mittelalter war es gängige Praxis politische Verhandlungen nach dem Schema des Bittens und Gewährens zu führen. Dadurch, dass eine Bitte normgerecht in der Öffentlichkeit vorgetragen wurde, konnte man sein Gegenüber jedoch manchmal zu Zugeständnissen zwingen, die nicht verabredet gewesen waren.
Eneas Bitte an Dido
Nachdem die Trojaner aus Troja geflohen und mehrere Jahre auf See umhergeirrt sind, finden sie endlich Land. Eneas schickt boten in diu lant[3] um in Erfahrung zu bringen, wer der Herrscher in diesem Land sei und ihn um Unterstützung zu bitten.
Dô gnâdeten sie der frouwen
der minnen und der trouwen,
die si an ir funden.
so si aller beste kunden,
sô sprâchen sir ze holden
und sageten daz si wolden
helfe rât und frede.[4]
Eneas hält also die Form des Bittens ein, indem er zunächst einen Boten, Ilioneus, zu Dido schickt, der seine Bitte vorbringt
mîn hêre hât uns her gesant,
daz ir im wellet gnâdich wesen
und in hie lât bî û genesen
und weteres irbeiten
und sîniu schif bereiten.
Ob ez û gevalle
her dient û und wir alle,
swie sô ir gebietet.[5]
Ilioneus bittet also in Eneas Auftrag nicht nur um Hilfe und Unterstützung, sondern bietet Dido auch seine und die Unterstützung seines gesamten Heeres an. Diese Bitte wird von Dido gewährt und sie sichert den Gestrandeten Hilfe zu und heißt sie in Karthago willkommen. Eneas erhält also Mittel, seine Boote zu reparieren und seine Männer zu versorgen und im Gegenzug erhält Dido, zumindest vorübergehend, einen neuen Verbündeten mit einem großen Heer.
[...]
[1] Althoff, Gerd: Demonstration und Inszenierung S. 232
[2] Althoff, Gerd: Zur Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis des Mittelalters S. 374
[3] von Veldeke, Heinrich: Eneasroman, V24,2
[4] ebd V 28, 35ff.
[5] ebd V 30,2ff.
Häufig gestellte Fragen
Was ist symbolische Kommunikation im Mittelalter?
Es handelt sich um eine nonverbale Kommunikationsform, bei der Rang, Status und Absichten durch Gesten, Mimik und rituelle Handlungen öffentlich demonstriert werden.
Warum war die öffentliche Bitte so bedeutend?
Die Bitte war die einzige legitime Form für Untergeordnete, Wünsche an Ranghöhere heranzutragen. Sie folgte festen Regeln wie Kniefall oder Verbeugung, um Demut zu zeigen.
Welche Funktion hatten Geschenke im Mittelalter?
Schenken war ein Zeichen von Macht, Huld und Sympathiebekundung. Es diente der Festigung von Bündnissen und der Demonstration von Reichtum und Großzügigkeit.
Was passierte, wenn Kommunikationsregeln nicht eingehalten wurden?
Ein Bruch der Konventionen galt als bewusste Provokation oder deutliches Signal für einen Konflikt, da die Regeln des Zeichensystems allgemein bekannt und akzeptiert waren.
Wie wird symbolische Kommunikation in Heinrich von Veldekes Eneasroman gezeigt?
Der Roman illustriert dies durch Eneas' Boten, die demütige Bitten an Dido und Latinus überbringen, sowie durch öffentliche Unterwerfungsakte und das Überreichen von Geschenken.
- Arbeit zitieren
- Jessica Zapf (Autor:in), 2008, Das Verständnis der symbolischen Kommunikation für das Verständnis des Mittelalters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122659