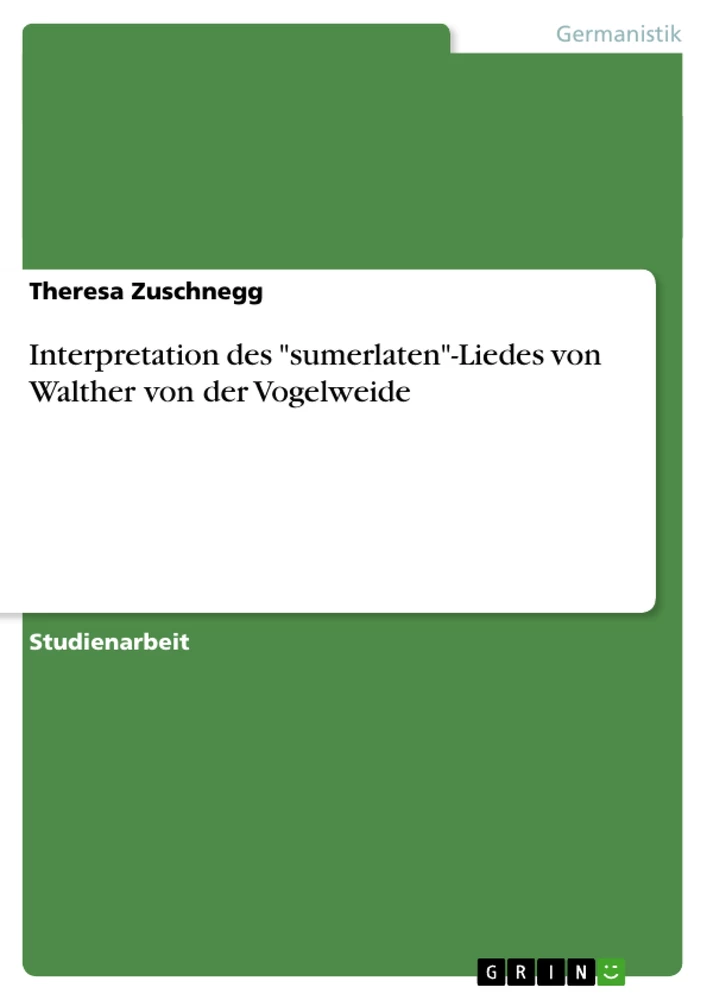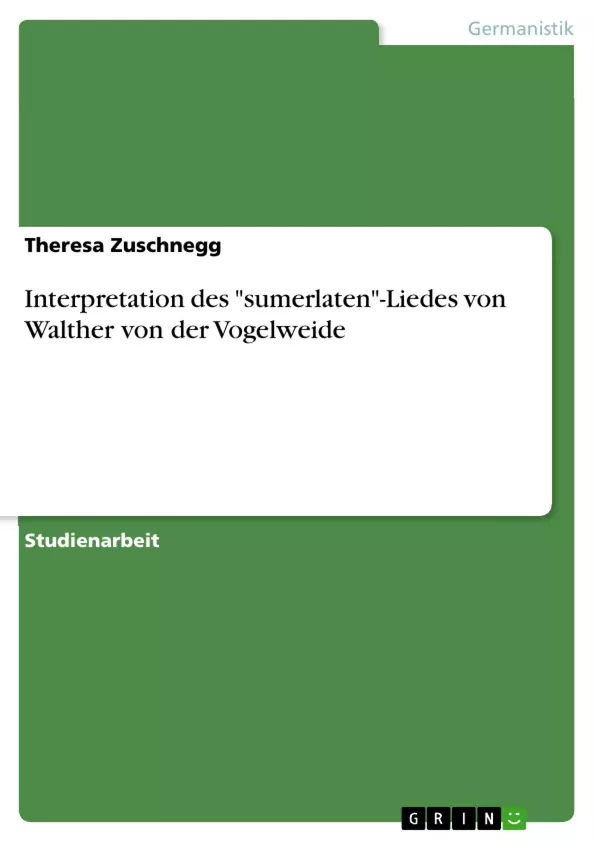Das „sumerlaten“-Lied ist sicherlich eines der umstrittensten Werke Walthers von der Vogelweide. Obwohl es zahlreiche Überlieferungen des Liedes gibt, ist noch immer nicht geklärt, ob die ursprüngliche Version des Liedes auf ein Gedicht Reinmars dem Alten zurückgeht. In der Arbeit wird kurz auf solche Theorien eingegangen. Hauptaugenmerk liegt dennoch auf der herkömmlichen Gedichtsanalyse wie Metrik, stilistische Analyse, Gattungszuordnung und Interpretation, die sich allein auf die Textedition von Lachmann/ Cormeau bezieht. Besonders wichtig erschien mir der Vergleich der Texteditionen Lachmann/ Cormeau, Lachmann/ Kuhn, Kasten und Schweikle, sowie die unübliche Häufigkeit der Überlieferungen in vier Handschriften.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Überlieferung und Edition
- 2.1 Überlieferung des „sumerlaten“-Lieds
- 2.1.1 Vergleich der Überlieferungen in den Handschriften A, C und E
- 2.1.2 Die Handschrift b und Theorien bezüglich Reinmars dem Alten
- 2.2 Vergleich der Edition von Lachmann/Cormeau mit den Editionen von Lachmann/Kuhn, Kasten und Schweikle
- 3 Metrum und Strophenschema der Textausgabe von Lachmann/Cormeau
- 3.1 Metrische Transkription der ersten Strophe
- 3.2 Aufbau der Kanzonenstrophe
- 4 Inhalt und Aufbau
- 5 Rhetorische und stilistische Analyse
- 6 Gattungszuordnung
- 7 Interpretation
- 8 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Walther von der Vogelweides „sumerlaten“-Lied. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der unterschiedlichen Überlieferungen des Liedes in verschiedenen Handschriften, insbesondere dem Vergleich der Versionen in den Handschriften A, C und E mit der dreistrophigen Variante in Handschrift B. Die Arbeit befasst sich mit metrik, stilistischen Aspekten und der Gattungszuordnung des Gedichtes. Die Interpretation konzentriert sich auf die Textausgabe von Lachmann/Cormeau.
- Analyse der verschiedenen Überlieferungen des „sumerlaten“-Lieds
- Vergleich der Texteditionen von Lachmann/Cormeau, Lachmann/Kuhn, Kasten und Schweikle
- Metrische und stilistische Analyse des Gedichtes
- Untersuchung der Gattungszuordnung
- Theorien zur möglichen Urheberschaft von Reinmar dem Alten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Bedeutung und die Herausforderungen bei der Interpretation des „sumerlaten“-Liedes. Das Kapitel „Überlieferung und Edition“ analysiert die verschiedenen Versionen des Liedes in den Handschriften A, C, E und B, beleuchtet die Unterschiede in der Strophenanordnung und Formulierungen und diskutiert Schweikles Theorie zur möglichen Urheberschaft Reinmars des Alten. Das Kapitel „Metrum und Strophenschema“ beschreibt die metrischen Besonderheiten des Liedes nach Lachmann/Cormeau.
Schlüsselwörter
Walther von der Vogelweide, sumerlaten-Lied, Minnesang, Handschriften A, C, E, B, Reinmar der Alte, Metrik, Stilistik, Gattungszuordnung, Texteditionen, Lachmann/Cormeau, Überlieferung, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im „sumerlaten“-Lied von Walther von der Vogelweide?
Es ist ein Werk des Minnesangs, das Naturmotive (Sommerlatten) nutzt, um über Liebe und gesellschaftliche Zustände zu reflektieren.
Welche Rolle spielt Reinmar der Alte bei diesem Lied?
Es gibt Theorien, dass die ursprüngliche Version des Liedes auf Reinmar zurückgeht oder eine Antwort auf ein Werk von ihm darstellt, was auf die literarische Fehde zwischen den beiden Dichtern hindeutet.
In welchen Handschriften ist das Lied überliefert?
Das Lied findet sich in den bedeutenden Handschriften A (Kleine Heidelberger Liederhandschrift), C (Manesse) und E sowie in Handschrift B.
Was ist eine Kanzonenstrophe?
Eine typische Strophenform des Minnesangs, bestehend aus zwei metrisch gleichen Stollen (Aufgesang) und einem davon abweichenden Abgesang.
Warum gibt es verschiedene Texteditionen?
Da die Handschriften variieren, versuchen Editoren wie Lachmann, Cormeau oder Schweikle durch unterschiedliche Gewichtung der Quellen die „ursprüngliche“ Fassung zu rekonstruieren.
- Arbeit zitieren
- Theresa Zuschnegg (Autor:in), 2007, Interpretation des "sumerlaten"-Liedes von Walther von der Vogelweide, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122691