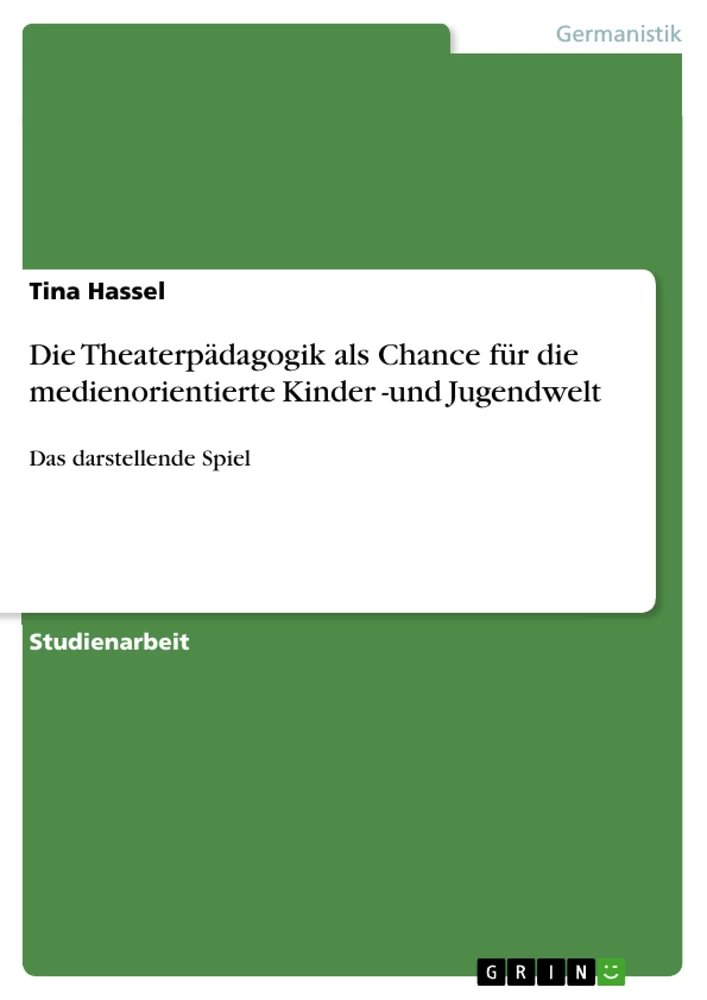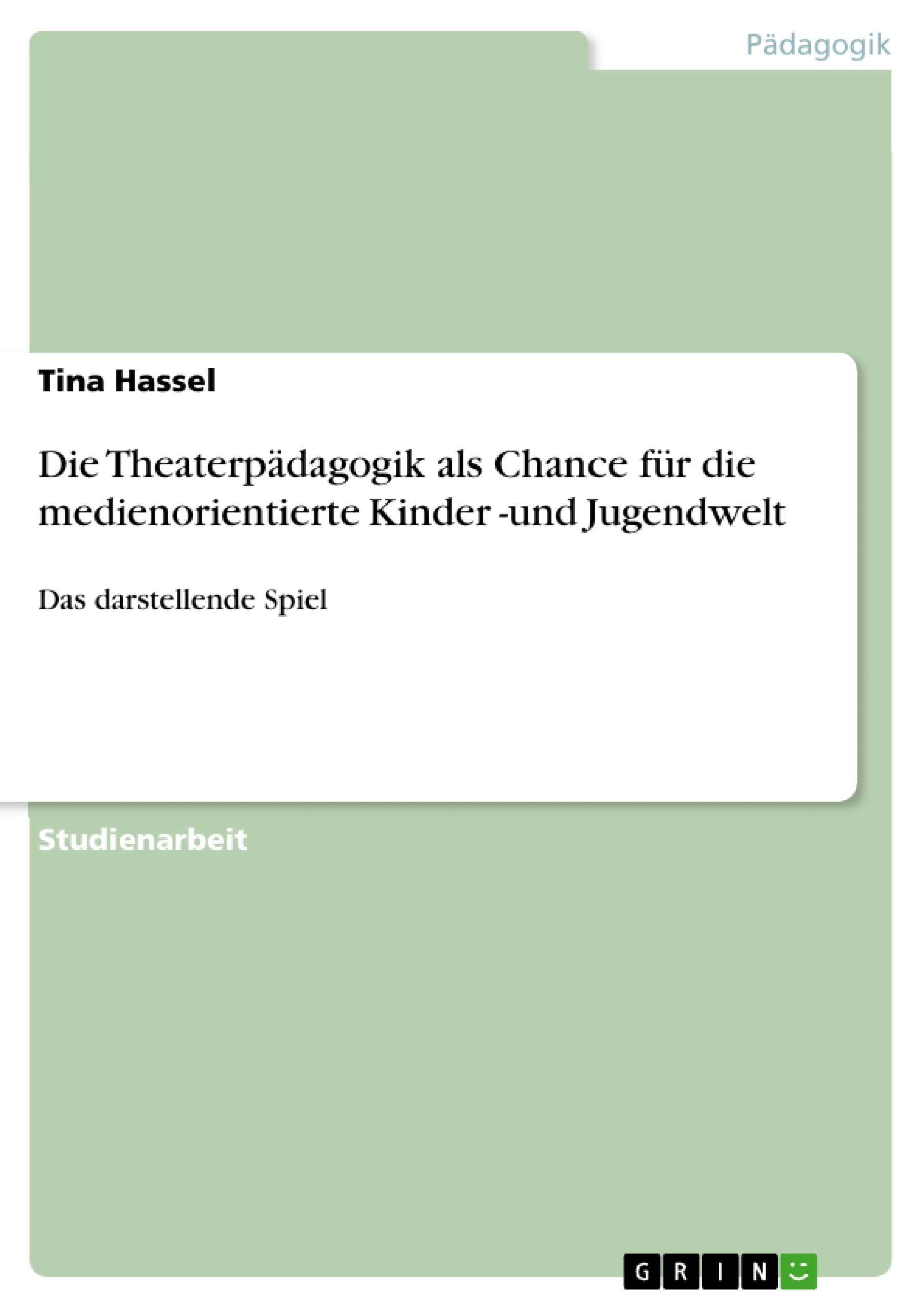1. Einleitung
„Als vor etwa einem halben Jahrhundert das Fernsehen eingeführt wurde, waren die Menschen euphorisch: Endlich wären Theater und Konzerte nicht mehr der Oberschicht vorbehalten, käme Wissen und Bildung in alle Haushalte.“ Doch das Fernsehen scheint auf die Menschen zu wirken wie ein Droge. Wir sitzen mehr vor dem Fernseher als dass wir uns draußen an der frischen Luft bewegen. Pädagogen und Soziologen gehen sogar davon aus, dass das fernsehen dumm mache und schon gar nicht bilde.
Fakt ist: wir wachsen mit dem Fernsehen auf und können uns diesem Medium auch nur schwer entziehen. Bereits als Babys und Kleinkinder sitzen wir vor dem Fernseher. Und der Fernsehkonsum nimmt stetig zu. Kinder und Jugendliche geben heute Fernsehschauen und Computerspielen als ihre Lieblingsbeschäftigung an.
Studien aus der USA und aus Kanada haben bewiesen, dass es zur Beeinträchtigung kognitiver Fähigkeiten, sprich der Konzentration, der Lesefähigkeit, des Sprachverständnisses und der mathematischen Fähigkeit kommt.
„Durch die Priorität des bildlichen Eindrucks erfährt die Sprache notwendigerweise eine Vernachlässigung,...“ beschreibt auch Barbara Fülgraff in ihrem Buch Fernsehen und Familie.
Schwächen in der Lesekompetenz werden so erläutert: „Unser Gehirn ist für das Lesen nicht gemacht. Wenn wir es dennoch zum Lesen verwenden, dann ist das etwa so, als würden wir mit dem Traktor ein Formel-1-Rennen fahren. Es geht, aber eben nicht so gut. Weil dies so ist, haben viele Kinder Schwierigkeiten mit dem Lesen. Das Fernsehen macht diese Situation nicht besser, sondern verschlimmert sie. Dies ist nachgewiesen: Wer viel fernsieht, liest nicht gut, liest nicht viel und sieht wiederum mehr fern.“ Ein Teufelskreis, ganz eindeutig.
Hinzu kommen noch Konzentrationsschwäche, Aufmerksamkeitsstörung, fördernde Gewaltbereitschaft, steigende Jugendkriminalität, Vereinsamung; Passivität. Zudem wissen die Kinder und Jugendlichen nicht mehr, ihre Freizeit zu gestalten. Ein Verlust an Kreativität und Phantasielosigkeit stellt sich heraus. „Die schöpferische Eigenleistung wird dadurch beträchtlich gekürzt, was einen Verlust der Vorstellungs- -und Phantasiekräfte bedeutet.“
Manfred Spitzer stellt in seinem Artikel: „Vorsicht Bildschirm“ in der Berliner Zeitung fest, dass „Fernsehkonsum ... ungünstige Auswirkungen auf die schulischen Leistungen hat.“
Ob diese Probleme mit Hilfe des Theater spielen behoben werden können, werde ich versuchen in meiner Hausarbeit zu erläutern.
Zunächst stelle ich fest, warum das Theater spielen an sich eine fördernde Tätigkeit ist. Dann werde ich näher auf eine bestimmte Richtung des Theater spielen eingehen, das Darstellende Spiel. Das Darstellende Spiel (DS) erläutere ich in seiner Begrifflichkeit und stelle es als Schulfach in Hamburg vor.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theater als Chance - Theater in der Schule
- Theaterspielen - wozu? Kulturpädagogische Aspekte des Theaterspielens
- Das Darstellende Spiel
- Zum Begriff: Darstellendes Spiel
- Das Darstellende Spiel als Unterrichtsfach: Ein Überblick
- Darstellendes Spiel in Hamburg
- Inhalt und Organisation
- Gegenstand und Ziele
- Didaktische Grundsätze
- Ist das Darstellende Spiel Fächer übergreifend?
- Das Darstellende Spiel im Deutschunterricht
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theaterpädagogik, insbesondere das darstellende Spiel, als mögliche Antwort auf die negativen Auswirkungen des Medienkonsums auf Kinder und Jugendliche. Es wird beleuchtet, inwiefern Theater als Gegenpol zu passiven Mediennutzung fungieren und kognitive Fähigkeiten, Kreativität und soziale Kompetenzen fördern kann.
- Negative Auswirkungen von Medienkonsum auf Kinder und Jugendliche
- Kulturpädagogische Aspekte des Theaterspielens
- Das darstellende Spiel als Unterrichtsmethode
- Darstellendes Spiel in Hamburg: Konzept und Umsetzung
- Fächerübergreifende Anwendung des darstellenden Spiels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den steigenden Medienkonsum und dessen negative Folgen für die kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Im Kapitel "Theater als Chance - Theater in der Schule" werden die kulturpädagogischen Vorteile des Theaterspielens im Allgemeinen erörtert, wobei der ganzheitliche Ansatz hervorgehoben wird. Das Kapitel über das "Darstellende Spiel" definiert den Begriff und gibt einen Überblick über seine Implementierung als Schulfach, insbesondere in Hamburg, einschließlich seiner didaktischen Grundsätze und möglichen fächerübergreifenden Anwendung. Es wird die Frage beleuchtet, ob und wie das darstellende Spiel im Deutschunterricht eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Theaterpädagogik, darstellendes Spiel, Medienkonsum, Kinder und Jugendliche, kognitive Fähigkeiten, Kreativität, soziale Kompetenz, Deutschunterricht, Kulturpädagogik, Hamburg.
Häufig gestellte Fragen
Welche negativen Auswirkungen hat übermäßiger Fernsehkonsum laut der Arbeit?
Es kann zu Beeinträchtigungen der Konzentration, Lesefähigkeit, des Sprachverständnisses und zu einem Verlust an Kreativität führen.
Warum wird Theaterspielen als Chance für Kinder gesehen?
Theaterspielen ist eine schöpferische Eigenleistung, die Phantasiekräfte weckt und kognitive sowie soziale Kompetenzen fördert.
Was ist „Darstellendes Spiel“ (DS)?
Es ist eine pädagogische Form des Theaterspielens, die oft als eigenständiges Schulfach unterrichtet wird, um die Ausdrucksfähigkeit und Persönlichkeitsentwicklung zu stärken.
Welche Ziele verfolgt das Fach Darstellendes Spiel in Hamburg?
Ziele sind unter anderem die Förderung der ästhetischen Bildung, Teamfähigkeit und die Entwicklung einer reflektierten Körper- und Sprachpräsenz.
Kann Theaterspielen die Lesekompetenz verbessern?
Die Arbeit untersucht, ob die aktive Auseinandersetzung mit Texten und Rollen im Theater einen positiven Gegenpol zur passiven Mediennutzung bildet.
Ist Darstellendes Spiel ein fächerübergreifendes Fach?
Ja, es gibt viele Anknüpfungspunkte, insbesondere zum Deutschunterricht, wo literarische Inhalte szenisch erarbeitet werden können.
- Citation du texte
- Tina Hassel (Auteur), 2007, Die Theaterpädagogik als Chance für die medienorientierte Kinder -und Jugendwelt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122721