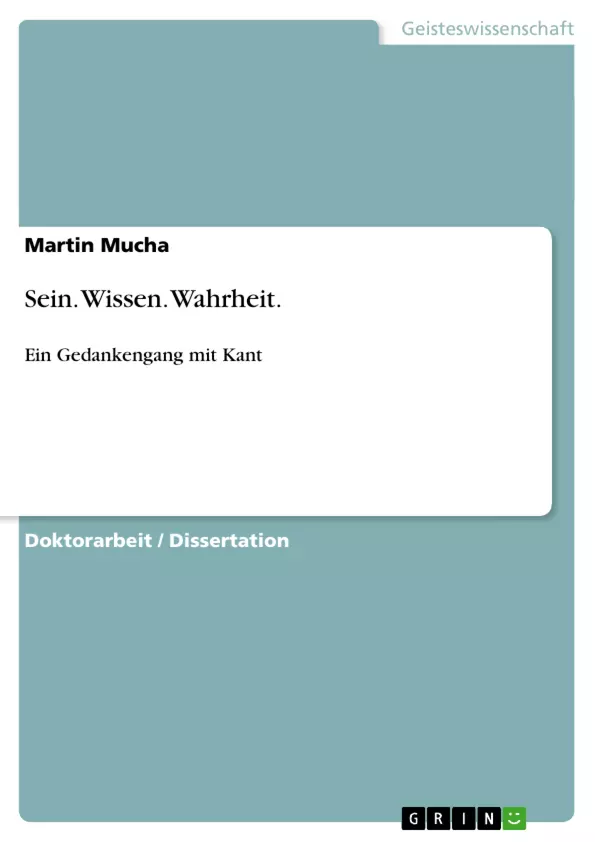In his „System of Transcendental Idealism“ Schelling poses a question: „how can we think both of Presentations as conforming to objects, and objects as conforming to presentations?“(Schelling, System of Transcendental Idealism (1800) §3. C, translated by Peter Heath. Charlottesville 1978). This antinomy is part of the innermost heart of his thoughts: If there is any philosophy at all, it has to be able to solve this problem.
In Kants major works this antinomy plays a vital role as well. The connection between these two gets clearer if another statement of Schelling is quoted: „In a word, for certainty in theory we lose it in practice, and for certainty in practice we lose it in theory; it is impossible both that our knowledge should contain truth and our volition reality.“ (Schelling, System of Transcendental Idealism (1800) §3. C, translated by Peter Heath. Charlottesville 1978).
To solve this problem, stated by those two philosophers, it is necessary to investigate the key elements of Kants theory of knowledge and practice. This investigation leads to a new approach to the most basic logical tool Kant uses: the proposition. Every proposition is posed in the fully developed difference of subject and object, therefor it is quite unable to shed light on this difference itself.
This has to be done by an alternative approach towards principal theory. This path leads to positions developed by thinkers like Platon and Hegel, conceived as proponents of classical philosophy, and thinkers like Brandom, Peirce and Cassirer, representing modern positions in this old debate.
As a result the value of inference, understood as a tool of knowledge, has to be altered. This inquiry will shed new light on the main convepts involved in the constitution of the differences between subject-object and knowledge-practice.
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Einleitung
1. Schellings Antinomie
1.1 Erste Orientierung am Text – der Begriff der Transzendentalphilosophie – Verhältnis von Theorie und Praxis
1.2 Schellings Antinomie – zwei Ebenen des Widerspruchs
1.3 Momente der Antinomie
1.4 Die Auflösung des Problems bei Schelling - der Weg zum Wissen
2. Kant
2.1 Rekapitulation
2.2 Kants Überlegungen zur Wahrheitsdefinition
2.3 Vorläufige Lösung der Antinomie
3. Subjekt, Objekt, Wissen
3.1 Drei Seiten der Einheit
3.2 Einheit und Regelverfasstheit als Begriff
3.3 Der Begriff als Funktion
3.4 Urteil und Objekt
3.5 Objektivität, Wahrheitsanspruch und Schluss
3.6 Zweite Dimension der Vernunft
3.7 Primat des Schlusses
3.8 Sinn und Bedeutung, normativ und deskriptiv
3.9 Einheit und Differenz von Korrespondenz- und Kohärenztheorie der Wahrheit
4. Sein, Wissen, Wahrheit
4.1 Einheit des Selbstbewusstseins
4.2 Die Kategorie
4.3 Zusammenhang Erfahrung-Logik
4.4 Die doppelte Struktur des Wenn–Dann, Verhältnis Schluss-Kausalität
4.4.1 Einleitende Bemerkungen
4.4.2 Sein und Vermittlung
4.4.3 Vermittlung und Kausalität
4.5 Kausalität bei Ernst Cassirer
4.6 Kausalität und Wissen
Literatur
Vorred
Am Ende des Vorworts zur Kritik der politschen Ökonomie entlässt Marx den Leser mit den Worten: „Bei dem Eingang in die Wissenschaft aber, wie beim Eingang in die Hölle, muß die Forderung gestellt werden:
„Qui si convien lasciare ogni sospetto
Ogni viltà convien che qui sia morta “[1]
Diese Zitat stammt aus der göttlichen Komödie, die Worte sind die des Ovid, der dem zweifelnden Dante den Sinn der Inschrift des Höllentores offenbart. Die Hölle ist der Ort, nach den Worten Ovids, der für diejenigen geschaffen wurde, die der Erkenntnis Gut verloren. Die Sicherheit des Wissens ist den Insassen der Hölle verloren gegangen, oder sie wurde ihnen sogar geraubt. Im Leiden wird ihnen nun eine Sicherheit geboten, welche durch ihre Faktizität allein, absolut, gilt, eine Sicherheit, die keiner Rechtfertigung mehr bedarf, keinen Zweifel mehr zulässt. Da sie die Sicherheit Gottes verloren, haben sie nun an ihrer Statt die des Schmerzes und der Leiden ewiglich. Ovid schärft dem zaudernden Dante ein, keinesfalls Zweifel aufkommen zu lassen, er solle vielmehr seinen ganzen Mut zusammennehmen und den Gang durch dieses Reich des Schreckens wagen.
Dieses Reich des Schreckens, die Hölle, wird nun von Marx mit der Wissenschaft gleichgesetzt, diejenigen, welche die Sicherheit des Glaubens verloren haben, zweifeln und fehlgehen, ihnen ist nur eine Sicherheit geblieben: die Sicherheit, die sie selbst mitbringen, das Vertrauen auf das eigene Urteil und die eigene Reflexion. Wer den Gang bestehen will, wer sich getraut, die Sicherheit und Geborgenheit der vertrauten Welt hinter sich zu lassen, der solle eintreten, freudig und freiwillig.
Wir stehen also hier am Tor zur Wissenschaft, noch ist Zeit umzukehren, denn anders als Ovid den Dante hineinführt, werden wir nicht nur als Zuschauer eintreten, als unbeteiligte Beobachter, die vielleicht sich einer gewissen Empathie mit den Insassen hingeben, sondern wir werden das Verdikt am eigenen Leib spüren, eine Rückkehr ins Gewohnte wird dann nicht mehr möglich sein. In diesem Sinne: Ihr, die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren.
Einleitung
Die vorliegende Untersuchung steht mit Kant ganz in der Tradition der Aufklärung. Die Beantwortung der drei Fragen mit dem Zweck der Humanteleologie, der Frage nach der Übereinstimmung der Vernunft mit ihrem letzten Zweck, als Sinn der Philosophie überhaupt, gibt der ursprünglichen Fragestellung ein Leitbild.
Der Mensch enstammt einerseits der Natur als Naturwesen, andererseits steht er ihr als Kulturwesen entgegen. In dieser Disjunktion ist auch schon die grundlegende Spaltung entwickelt, in welcher der Mensch, und mit ihm das Denken, steht: Natur und Kultur. In der Sphäre der Kultur selbst wiederholt sich diese Spaltung und wird greifbar. Nennen wir diese, der Kultur immanente Komponente, die der Natur nahe steht, implizit. Ihr entgegen steht die der individuellen Reflexion des Individuums, eine explizite Komponente.
Historisch gesehen organisierten sich menschliche Gesellschaften implizit, den Gegebenheiten, die ihr Gedeihen bestimmten, sich anpassend. In relativer Isolation waren die tradierten Normen und Wissensformen stabil. Mit der zunehmenden Interaktion der diversen menschlichen Gesellschaften gerieten die verwendeten Rechtfertigungsstrategien aber zunehmend in Zweifel, da Alternativen sichtbar wurden. Eine diese Entwicklungen tritt uns in der Genese der griechischen Philosophie entgegen. Der Relativismus der Sophisten ist durchaus auch als eine Reaktion auf die plötzlich verfügbaren Alternativen gesellschaftlicher Organisation zu interpretatieren. Das bisher implizit Regulierte sollte explizit reguliert werden, womit die Gesellschaft und ihre Organisation umfassendes Thema der Reflexion wird. In den Künsten, in der Wissenschaft, den Handwerken, in der Rechtsverfassung kommen sie zum Tragen. Die Philosophie ist die Basis der expliziten Entwicklung der Gesellschaft, Religion Handwerksgilden etc implizite. Der Argumentation, als wesentlicher Modus der expliziten Organisation von Wissen im Bereich der Philosophie, steht die Tradition als hauptsächliche Organisationsform im Bereich der impliziten Institutionen gegenüber. Die Kritik an der Tradition ist im Wesentlichen philosophische Aufklärung, die impliziten Dynamiken gesellschaftlicher Entwicklung werden expliziert. Dieser Vorgang der kritischen Reflexion führt zu einem Phänomen in denjenigen Gesellschaften, in welchen der Anspruch des traditierten Sinnangebots in Zweifel gezogen wird. Damit zusammenhängende Phänomene lassen sich sowohl im Athen des fünften vorchristlichen Jahrhundert, wie in den westlichen Industriegesellschaften beobachten.
In unserer Zeit, und wohl auch schon früher, wird über den Mangel an Eindeutigkeit der Sinngebung geklagt. In der modernen Gesellschaft herrscht eine Pluralität von Sinnangeboten, was bei manchem zur Verzweiflung führt. Mit der fortschreitenden Technisierung, und den damit verbundenen Risiken, entstehen Bedürfnisse nach Geborgenheit und Eindeutigkeit[2]. Die Zeit, als die Welt noch traditionell erklärbar war erscheint rückblickend als verlorenes Paradies. Geborgenheit in tradierten Normen- und Wissenssystemen schließen Freiheit und Selbstständigkeit aus. Der aus dieser Freiheit resultierende Anspruch auf Mündigkeit des Einzelnen, der für sich selbst die Verantwortung trägt, wird als Last empfunden. Dem historischen Prozess, der zu dieser Situation führte, zur Selbstverantwortung des Menschen vor sich selbst, wird von mancher Seite der Vorwurf gemacht, sein Gegenteil auszulösen und hervorzubringen. Dies daher, weil entweder aus reaktionären Motiven oder aus positivistischer Konzeption, Bestimmung nur als Fremdbestimmung gedacht werden kann. Gott oder die Naturwissenschaft sollen dem Menschen Sinn geben. Eine Frage, die sich stellt, ist die nach den Bedingungen und Formen von Sinngebung überhaupt. Das Thema der vorliegenden Arbeit ist prinzipientheoretisch. Die Prinzipientheorie ist die Theorie über die grundlegenden Momente der Vermittlung der Motivationen in dieser dynamischen Struktur der Sinnkonstitution im Rahmen der individuellen Reflexion, womit auch die Frage nach dem Sinn Gegenstand der Prinzipienreflexion ist.
Eine radikale Fremdbestimmung, etwa durch die organisierte Religion, scheidet von Vornherein als Kandidat für eine Sinngebung aus, denn Sklaverei als Sinninstanz scheint konsensual abgelehnt zu werden. Es bleibt also im Wesentlichen nur die Alternative, entweder den Versuch zu unternehmen, der Genese von Sinn überhaupt nachzuspüren, oder den Anspruch auf Sinnhaftigkeit vollständig aufzugeben. Etwa in einer rein empirisch-naturalisierten Betrachtung der Geschichte und damit dem Eindruck einer beliebigen Abfolge von Meinungen und Glaubenssystemen zu erliegen. Die Vielheit an Orientierung kann in einer solchen empirischen Betrachtung nur als Ausdruck der Kontingenz, der Beliebigkeit verstanden werden, womit aber zugleich aller Sinn verloren ginge.
Die wesentlichen Momente der Wirklichkeit herauszustellen ist der Sinn dessen, was oben Prinzipientheorie genannt wurde, die wesentlichen Momente der Wirklichkeit sind dann aber auch die wesentlichen Momente der Geschichte und damit der Vielzahl der in ihr zugänglichen alternativen Sinngebungen. Die Frage nach dem Verhältnis von Einheit und Vielheit, denn auf diese Frage ist zurückzugehen, ist somit nicht nur theoretische Spielerei, sondern unverzichtbares Moment vernünftiger Selbstverständigung, denn die im ersten Teil der Einleitung gestellte Problematik der vernünftigen Selbstorganisation der menschlichen Gesellschaften, nicht traditionell, sondern explizit durch Diskussion und Rationalität, ist nur so denkbar.
Die Frage nach der speziellen Ausformulierung eines solchen Systems der wesentlichen Formen stelle ich nun nicht, meine Arbeit beabsichtigt kein Kategoriensystem zu sein, sondern nur eine Voruntersuchung zu demselben.
Der Weg, den die Arbeit selbst nehmen wird, ist etwa dieser:
Schelling schreibt im System des Transzendentalen Idealismus: „Wie können die Vorstellungen zugleich als sich richtend nach den Gegenständen, und die Gegenstände als sich richtend nach den Vorstellungen gedacht werden.“[3] Schelling platziert diese Antiomie im Zentrum seines Denkens: Wenn überhaupt Philosophie möglich sein soll, dann muss sie diese Problemstellung aufzulösen im Stande sein.
Kant hat in seinen Hauptwerken, cum grano salis, diese Antinomie ständig im Auge. Obwohl Antinomien in allen seinen Kritiken auftauchen, und in unterschiedlichsten Formulierungen vorkommen, lässt sich ein Problemkern einkreisen, wenn man Schellings Erläuterungen heranzieht: "... über der theoretischen Gewißheit geht uns die praktische, über der praktischen die theoretische verloren; es ist unmöglich, daß zugleich in unserer Erkenntnis Wahrheit, und in unserem Wollen Realität sei.“[4]
Eine fruchtlose philologisch-philosophiehistorische Diskussion des Antinomiebegriffes bei Kant ist nicht Gegenstand der Untersuchung, Ziel der Einstiegsreflexion ist es, einen möglichen Anschluss an Kants Denken zu finden. Schellings Formulierung der Antinomie hat den Vorteil, weswegen sie Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass in ihr Begriffe fokussiert sind, die wesentlich scheinen: Subjekt, Objekt, Wissen, Handeln. Es geht in der Arbeit, das zeigen die verwendeten Begriffe, somit um den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, in dessen Einflussbereich Begriffe wie Wahrheit und Realität zu explizieren sein werden.
In einem ersten Schritt wird Schellings Gedankengang, der zur Antinomie führt, dargestellt, kurz die Antinomie beleuchtet, um dann Schellings Lösungsversuch kritisch zu hinterfragen. Dabei wird sich vor allem Schellings Lösungsversuch im Begriff einer intellektuellen Anschauung als Problem erweisen.
Mit einem ständigen Blick auf Kant wird dann der Versuch unternommen, eine alternative Lösung vorzubereiten. Schellings Antinomie weist zwei Dimensionen auf, eine der theoretischen Philosophie und eine der praktischen.
Zuerst wird der Wahrheitsbegriff, Zentrum einer jeden Problemstellung der theoretischen Philosophie, hinterfragt. Eine kurze Analyse von Teilen des Leitfadenkapitels in der Kritik der reinen Vernunft und der ersten Fassung der transzendentalen Deduktion wird uns zur Frage führen, ob der traditionelle Begriff der Wahrheit, als einer adequatio rei et intellectus, der Problemstellung gerecht zu werden vermag.
Dann wird der Versuch unternommen, Überlegungen bei Kant plausibel zu machen, die nicht auf eine einfache Verabschiedung dieses Wahrheitsbegriffes drängen, sondern einerseits den Objektivitätsanspruch erhalten wollen, andererseits aber einen kohärenztheoretischen Wahrheitsanspruch favorisieren. In einem nächsten Schritt wird die logische Dimension dieses Problems in den Vordergrund treten, da sich der Begriff der Funktion als der, in der Fragestellung von Kants prinzipientheoretischen Texten, maßgebliche erweisen wird.
Bei Gottlob Frege, in einem explizit sprachphilosophisch-logischen Rahmen und bei Ernst Cassirer, in einer wissenschaftstheoretischen Fragestellung, werden die bei Kant angefangenen Reflexionen fortgesetzt. Die klassischen Themen der Logik: Begriff und Urteil, werden damit zu ihrem Recht kommen.
Das Urteil spielt, vor allem bei Kant, eine große Rolle in der Frage nach der Objektkonstitution. In einem zweiten Gedankengang zur transzendentalen Deduktion, diesmal in der Fassung der zweiten Auflage, wird sich zeigen, dass Kant zugunsten der Verständlichkeit eine Verschiebung des Schwerpunktes der Objektkonstitution durchführt: Das Urteil allein soll die Hauptlast der Argumentation tragen.
Indem dann wieder Bezug auf die A-Fassung der Deduktion genommen wird, zeigt sich im Kontrast von A und B Fassung der Deduktion, dass der Zusammenhang von Urteilen in Kants Konzeption der Objektkonstitution eine wesentliche Rolle spielt. Dieser Standpunkt führt uns direkt zur Annahme des Schlusses, als des wesentlichen Trägers, sowohl der Frage nach der Objektkonstitution als auch nach den verschiedenen Bedingungen der Einheit und Verschiedenheit von Subjekt und Objekt.
An diesem Punkt der Untersuchung, angelehnt an Robert Brandom, wird die zweite Dimension der Schellingschen Antinomie thematisch, die Frage nach der Realität unseres Wollens. Der Zusammenhang von Realität und Wahrheit, um in der Formulierung von Schelling zu bleiben, erweist sich als die doppelte Struktur, in der Kant die Kausalität fasst. Schluss und Kausalität, in einem neuerlichen Rekurs auf Ernst Cassirer, werden zueinander in Bezug gesetzt, um das Problem von Schelling zu überwinden.
1. Schellings Antinomie
1.1 Erste Orientierung am Text – der Begriff der Transzendentalphilosophie – Verhältnis von Theorie und Praxis
Um 1800, im ersten Paragraphen des „System des transzendentalen Idealismus“, formuliert Schelling als sein Ziel bzw. das letzte Ziel der Philosophie überhaupt: die Erkenntnis der ursprünglichen Identität von Subjekt und Objekt oder, anders formuliert, die Erkenntnis der Einheit von Natur und Ich.
Laut Schelling lässt sich diese ursprüngliche Einheit von beiden Seiten her in den Blick rücken. Vom Subjekt her gedacht, nähert sich die Philosophie der ursprünglichen Einheit als Transzendentalphilosophie, vom Objekt her gedacht als Naturphilosophie. In diesem doppelten Erkenntnisgang erweisen die beiden Wissenschaften jeweils das ihnen Andere. Die Transzendentalphilosophie erweist vom Subjekt ausgehend, das Subjekt thematisierend, das Objektive; die Naturphilosophie, vom Objekt ausgehend, das Subjektive. In der vollständigen Durchführung dieses Projektes würde sich das gegenseitige Verhältnis von wechselseitiger Exklusion und Implikation der beiden Pole der Subjekt-Objekt Differenz zeigen: Der notwendige Zusammenhang beider wäre letztendlich erwiesen und dargestellt. Schelling setzt bei diesem Projekt voraus, dass die genaue Analyse und Explikation der beiden Begriffe Subjekt und Objekt immer in deren kontradiktorisches Gegenteil umschlägt. Die transzendentalphilosophische Analyse des Subjekts soll das Objektive (die Natur) erweisen, während die naturphilosophische Untersuchung des Objekts das Subjekt erweisen soll, denn die beiden unreduzierbaren Pole einer jeden Erkenntniskritik lassen sich nie intentione recta, gleichsam in ihrem „An-sich“ Sein betrachten, sondern immer nur als Teile einer Relation. Einer Relation, die ein mehrgliedriges Gefüge notwendig aufeinander bezogener Begriffe umfasst. Die Rede von dem speziellen Verhältnis von Subjekt und Objekt als dem Verhältnis einer wechselseitigen Implikation und Exklusion greift auf prinzipientheoretische Überlegungen zurück, die Urs Richli mit Bezug auf die Hegelsche Kategorienlehre anstellt.[5] Vorweg und noch ganz allgemein gesprochen, im Verlauf der Arbeit wird sich Genaueres ergeben, handelt es sich um ein in der Philosophie altbekanntes Phänomen: Bei bestimmten Begriffen ergibt sich der eigentümliche Sachverhalt, dass man in der Untersuchung, je näher man dem Kern der Sache zu kommen vermeint, immer stärker auf den Begriff zurückgeworfen wird, der zum Gesuchten im kontradiktorischen Gegensatz steht. Verschiedene Kategorienlehren, wie die Platons, Hegels oder Fichtes, haben ihre bestimmte Form und Gestalt gerade durch die Konzentration auf diese Eigentümlichkeit gewonnen.
Gleich zu Beginn, im ersten Paragraphen des Textes, exponiert Schelling eine Trias: Subjekt, Objekt, Wissen. Diesem Gefüge stellt er noch den Begriff der Wahrheit, als eine Substitutform des Wissens zur Seite, ohne genauer auf die Zusammenhänge dieser Begriffe einzugehen:
„Alles Wissen beruht auf der Übereinstimmung eines Subjektiven mit einem Objektiven. Denn man weiß nur das Wahre; die Wahrheit wird aber allgemein in die Übereinstimmung der Vorstellungen mit ihren Gegenständen gesetzt.“[6]
Diese triadische Relation ist eine der wechselseitigen Voraussetzung und Exklusion. Notwendigkeit entsteht in diesem Begriffsgefüge dadurch, dass die Relate der Relation einander bedingen, eines alleine ist undenkbar. Denn wenn man das eine bestimmt, so ergibt sich die Bestimmung seines Relates im selben Prozess. Nur insofern und weil das Subjekt nicht das Objekt ist, hat es überhaupt Bestimmung, gleiches gilt für das Objekt. Die Übereinstimmung von Subjektivem und Objektivem soll Wahrheit, respektive Wissen sein. Das heißt, dass die Relation, deren Relate Subjekt und Objekt sind, Wahrheit genannt wird. Einiges spricht intuitiv für diese Fassung des Verhältnisses von Subjekt und Objekt, aber es ergibt sich auch direkt ein Problem daraus. Wenn die grundsätzliche Relation von Subjekt und Objekt immer schon Wahrheit ist, so steht man sofort vor dem Problem, mit dem sich auch Platon konfrontiert sah: Wie können Sätze überhaupt falsch sein?[7] Die Möglichkeit des Irrtums muss ein wesentliches Moment einer jeden Überlegung zum Thema Wahrheit sein, sinnvolles, eigenverantwortliches Sprechen erfordert ein vermittelndes Drittes zwischen Kontradiktion und Tautologie, den Grenzbegriffen der Rationalität.
Hier ergeben sich auf Anhieb zwei Lösungsmöglichkeiten, entweder es wird darauf verzichtet die Relation als „Wahrheit“ zu benennen, oder es findet sich für den Begriff „Wahrheit“ ein anderer Sinn. Etwa so, dass „Wahrheit“ im eigentlichen Sinn kontradiktorisch der Falschheit gegenüberstellt wird, wobei die beide verbindende Gattung aber, also das „in Beziehung stehen überhaupt“, ebenso mit dem Gattungsnamen als Wahrheit bezeichnet. Die Diremtion der Gattung in Arten, deren eine die Gattung selbst ist, stellt eine grundlegende Technik dessen dar, was allgemein Spekulation genannt wird. In diesem Begriffsverhältnis ist, wie wir sehen werden, auch der im Zitat von Schelling verwendete Begriff „Wissen“ zu verstehen.
Im Verlauf der Rekonstruktion dieser unmittelbaren, immer schon vorausgesetzten Einheit[8] geht es um die Explikation dessen, was immer schon gemeint, vorausgesetzt und mitgedacht werden muss, wenn man im, mit und durch das Wissen lebt. Das naive, alltagssprachlich verfasste Wissen gilt es aufzuklären, das Implizite zu explizieren. Schellings Untersuchung der Bedingungen der Objektkonstitution ist, zumindest dem Sinn nach, eine breit angelegte Untersuchung des Themas Wahrheit.
Die Untersuchung vom Subjekt aus, die Transzendentalphilosophie, und nur sie interessiert uns hier, thematisiert nun die ihr zugänglichen Möglichkeiten für die zu explizierende Identität von Subjekt und Objekt. Nach Schelling ist die erste Frage, die sich dem Subjekt in dem Projekt der Transzendentalphilosophie stellt,[9] die nach dem ihm anderen überhaupt. Diese erste Frage ist nun auf keine andere rückführbar, kein Grund und kein Schluss lässt sich angeben, auf den sie ihren Anspruch stützt. So gesehen ist diese erste Setzung, der Gegenstand der ersten Frage eine Frage vor allem Fragen, eine Frage vor allem Urteilen. So gesehen ist sie ein Vorurteil. Nur eben nicht irgendein beliebiges, sondern das Vorurteil schlechthin: Es gibt Dinge außer uns. Vorurteil kann hier in einem cartesianischen Sinn genommen werden. Ein Urteil, würde Descartes an dieser Stelle sagen, das man noch aus einer Zeit übernommen hat, als man gar nicht fähig war zu urteilen, ist ein Vor-Urteil. Ein Urteil, das angenommen wurde, noch bevor man im Stande war, es kritisch zu überprüfen, und das so unhinterfragt den Horizont mitbestimmt, aus dem heraus bewusst die Frage nach Wahrheit und Falschheit gestellt wird. Die rationale Entscheidung beruht somit immer auf ungeprüften Voraussetzungen. Diese ungeprüften Voraussetzungen tragen mehrere Namen. Jeder Mensch ist ein Kind seiner Zeit und der Kultur, in der er aufgewachsen ist, weswegen man in diesem Zusammenhang auch von kulturellen Vorurteilen spricht. Descartes hehres Ziel war es, alle diese Vorurteile zu überwinden und so einen Boden für wirkliche Rationalität zu legen. Dieser Gestus der Aufklärung des Ungeklärten, des Trüben, ist für die neuzeitliche Philosophie maßgebend geblieben. In diesem Sinne spricht auch Kant von „selbstverschuldeter Unmündigkeit“,[10] der er die erste Maxime des gemeinen Menschenverstandes gegenüberstellt, die Forderung nach dem „Selbst denken“.[11]
In dieser zutiefst theoretischen Fragestellung, am Ort der Frage nach dem Objekt und seiner Genese, taucht also unversehens die praktische Dimension der Reflexion auf. „Was kann ich wissen? Was soll ich thun? Was darf ich hoffen?“[12] Der Geist dieser Fragestellung atmet radikale Luft, das Subjekt begibt sich in eine kritische Distanz zu der Gesellschaft und den Normen und Traditionen, aus denen es erwachsen ist. Das hergebrachte, über die Folge der Generationen gleichsam naturwüchsig im Lebensprozess vermittelte Wissen wird hinterfragt. Nicht, um es rundweg abzulehnen, was genauso unzureichend wäre, wie es einfach naiv anzunehmen, sondern um es eingehender Prüfung zu unterwerfen und dann nur das anzunehmen, was der rationalen Kritik standhält.
Transzendentalphilosophie ist also ihrem ureigensten Wesen nach nicht konservativ-erhaltend, sondern aufklärend-progressiv. Das reflektierende Individuum verlässt, indem es Fragen stellt, den Rahmen, in dem ihm die Gesellschaft Schutz bieten kann, ihre kollektive Sinngebung wird hinterfragt. In genau diesem Sinn spricht Sokrates in Platons Dialogen von seiner Methode der Maieutik, der Geburtshilfe der Hebamme. Wenn man dieses Bild weiterdenken will, dann liegt in dieser Analogie der Überwindung der Vorurteile mit dem Geburtsakt viel Treffendes. Nicht nur sind beides einschneidende und mitunter gefährliche Phasen im Leben, sondern ebenso wichtige wie einschneidende Veränderungen der Stellung des Individuums. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung sind nur in einem Prozess der Emanzipation zu erlangen. Transzendentalphilosophie ist sowohl Reflexion als auch Risiko. Ulrich Claesges sieht das ganze Wesen der Transzendentalphilosophie im Sinne seiner Interpretation der kopernikanischen Wende darin, den Schein als das Mittlere von Wahrheit und Irrtum in seiner Genese zu explizieren:
„Durch die Selbstunterscheidung der Transzendentalphilosophie vom natürlichen Bewusstsein ist das letztere als solches und als Ganzes erklärungsbedürftig geworden.“[13]
Das natürliche Bewusstsein, der common sense, ist die Sinngebung der Gesellschaft, das Implizite des Wissens. Die unhinterfragte Sinnstiftung durch die Tradition. Die Tradition oder, anders bezeichnet, der gesunde Menschenverstand[14] und deren Aufklärung stehen naturgemäß immer in einem Spannungsverhältnis. Die traditionellen Normen und Überzeugungen einer Gesellschaft sind die kohäsiven Kräfte, die Einheit und Stabilität garantieren. Werden die historisch-sozialen Weisen in dieser Kohäsion fragwürdig, so wird auch der gesellschaftliche Zusammenhalt fragwürdig. Es ist nun wenig originell hier den Namen „ Sokrates“ zu verwenden, aber genauso wie am Beispiel Descartes, Galileis und vieler anderer sehen wir durch ihre Fragen die konservativen Kräfte einer Gesellschaft zur Reaktion herausgefordert. Wie die Geschichte zeigt, ist ein Menschenleben ein geringer Preis, die Einheit und Stabilität der Gesellschaft zu sichern.
Der Begriff einer wie auch immer gearteten Transzendentalphilosophie ist also ohne den korrespondierenden einer Vernunftkritik nicht denkbar. Nachdem der hier nur angerissenen Fragestellung für den Moment genug Aufmerksamkeit widerfahren ist, zurück zum Hauptstrang der Überlegung.
„Das eine Grundvorurteil auf welches alle anderen sich reduzieren, ist kein anderes, als dass es Dinge außer uns gebe“.[15]
Dieser Satz ist laut Schelling problematisch, da er noch ungeprüft ist und doch von allen als begründet angesehen wird. Daher muss die Transzendentalphilosophie vor allem, eben darin besteht das ihr eigentümliche Geschäft, dieses Vorurteil als solches aufzeigen und explizieren. Nebenbei bemerkt Schelling auch noch, dass alle anderen Vorurteile sich auf dieses eine zurückführen lassen und, sobald man dieses eine auflöse, alle anderen, wenn sie sich schon nicht vollständig verflüchtigten, so doch auf den ersten Blick als problematisch zu erkennen wären.
Schelling führt das Vorurteil, „dass es Dinge außer uns gebe“,[16] ohne dass wir jetzt näher auf die Gründe dafür eingehen, auf ein unmittelbar Gewisses zurück. Als dieses unmittelbar Gewisse setzt Schelling das Ich. Anders formuliert, Schelling sucht Gründe für die In-eins-Setzung von „ich bin“ und „es existieren Gegenstände außer mir“, da die Bedingung der Möglichkeit von Objektivität allein durch das Ich selbst gegeben sein soll. Es geht ihm also darum, eine strikte Implikation zwischen den beiden Sätzen aufzuweisen. In der Folge werden dann beide Sätze voneinander isoliert betrachtet, um so den ihnen eigentümlichen Zusammenhang aufzeigen zu können. Durch diese Trennung und Isolierung soll sich zeigen, dass die genaue Betrachtung und Analyse eines der beiden Glieder immer zu seinem Anderen hinführt. Dieses kategoriale Gefüge mit seinem spezifischen Gehalt der wechselseitigen Implikation und Explikation seiner Glieder ist grundlegend.
Wichtig ist es, sich in diesem Zusammenhang klar zu machen, dass dieser Ansatz zu einer transzendentalen Deduktion, denn darauf zielen Schellings Überlegungen, auf einer anderen Ebene liegt als bei Kant oder später bei Hegel. Allen dreien ist es gemeinsam, dass sie die grundlegenden Formen des Denkens, besonders die des gegenständlichen Denkens, analysieren und konstruieren wollen. Kant thematisiert die Notwendigkeit der Formen der Gegenständlichkeit überhaupt, wobei er sich stark auf die von ihm „metaphysisch“ genannte Seite der Fragestellung konzentriert. Die Frage nach Anzahl und Bestimmung der Formen des gegenständlichen Denkens ist bei ihm enorm wichtig. Schelling streicht diese Ebene der Kategorialität aus seinem Programm, er konzentriert sich vielmehr auf die Problematik der Gegenständlichkeit überhaupt, unter Vernachlässigung der Frage nach einem speziellen Kategoriensystem. In Kants Diktion setzt Schelling die transzendentale Deduktion über die metaphysische. Hegel findet später eine Synthese beider, die Kategorie als Form von Gegenständlichkeit wird selbst zum Gegenstand überhaupt[17], sodass die Trennung der Prinzipientheorie in die metaphysische Deduktion als Frage nach Art und Anzahl der Kategorien und die transzendentale Deduktion als Frage nach der Rechtfertigung von Kategorialität überhaupt überwunden ist.
Insofern sich aus der Analyse des Grundvorurteils die wechselseitige Abhängigkeit von Objekts- vom Subjektsbegriff erwiesen hatte, stellt Schelling nun das Subjekt selbst einseitig ins Zentrum seiner Überlegungen. Das Subjektive, gefasst als das, welches gerade nicht im Objekt liegt und daher verborgen, implizit bleibt, wird von der Transzendentalphilosophie thematisiert. Verborgen bleibt es, weil im natürlichen, naiven, gegenständlichen Bewusstsein nur das, was Objekt ist, vorkommt. Das Subjektive ist quasi die Rückseite des Spiegels. Die Leistung des Subjekts verschwindet im fertigen Objekt. Gerade diese Leistung, die uns im Alltag immer schon durch ihr Resultat verstellt ist, wird zum Thema. Somit wird das Subjekt selbst zum Objekt, indem es Gegenstand des Denkens wird. In Schellings eigenen Worten:
„Die Natur der transzendentalen Betrachtungsart muß also überhaupt darin bestehen, daß in ihr auch das, was in allem anderen Denken, Wissen oder Handeln das Bewusstsein flieht und absolut nicht-objektiv ist, zum Bewusstsein gebracht und objektiv wird, kurz: in einem beständigen Sich-selbst-Objekt-Werden des Subjektiven.“[18]
Zweierlei muss hier auseinander gehalten werden, die Bedeutungsdichte des Begriffs Objekt, die mit dieser Textstelle ihren Höhepunkt erreicht einerseits, und der Bezug auf die Leistung des Subjekts, die, vorläufig, in drei Dimensionen aufgegriffen, der ursprünglichen Trias von Subjekt, Objekt und Wissen[19] korrespondiert andererseits.
Den ganzen Text hindurch war der Begriff des Objekts ein Thema, Schelling verwendet ihn konsequent mehrdeutig. Einerseits das Objekt, als in Raum und Zeit sinnlich Gegebenes, dessen Allverband die Natur ist, als der „Inbegriff der Gegenstände der Sinne“[20]. Andererseits als Gegenstand für das Bewusstsein, das heißt – ungeachtet einer möglicherweise auch nicht sinnlich wahrnehmbaren Natur – als geregelter Bewusstseinsinhalt überhaupt, als Vorstellung. In diesem zweiten Sinne kann auch das Subjekt zum Objekt werden, insofern es Thema eines Bewusstseins überhaupt werden kann. Diese beiden Seiten des Begriffs der Objektivität haben nun gemeinsam, dass es ihnen darum zu tun ist, geregelte Inhalte des Bewusstseins, also solche, die Gesetzen unterworfen sind, begrifflich zusammenzufassen und damit von ungeregelten abzugrenzen. Was die beiden allerdings unterscheidet, ist, dass es sich hier um zwei unterschiedlich starke Fassungen der Objektivität handelt.
Wenn Objektivität einfach nur als Inbegriff dessen verstanden wird, von dem es Sinn macht, in einer Diskussion einen Wahrheitsanspruch zu vertreten, so hat Objektivität einen starken Zusammenhang mit den Kriterien, die zur Wahrheitsentscheidung herangezogen werden können. Wenn man nur sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen Objektivität zugesteht, allen anderen Bewusstseinsinhalten hingegen nur die Rolle eines bloßen Spiels der Einbildungskraft, so verlegt man die Kriterien der wahrheitsrelevanten Entscheidung vom Subjekt ins Objekt. Die Gesamtheit der Kriterien, die in wahrheitsrelevanten Entscheidungen zum Tragen kommen, bezeichnet man als Rationalität: das Vertreten, Abwägen und Bewerten von Gründen und Argumenten. Sinnliche Wahrnehmbarkeit als alleiniges Kriterium der wahrheitsrelevanten Entscheidbarkeit könnte als schwache Fassung des Rationalitätsbegriffs bezeichnet werden. Eine starke Fassung wäre es, Bewusstseinsinhalte als objektiv zu bezeichnen, und zwar auch dann, wenn nicht alle Kriterien der Wahrheitsentscheidung an sinnlich Wahrnehmbares zurückgebunden werden. Diese starke Fassung des Rationalitätsbegriffs fordert eine weitergehende philosophische Reflexion heraus, da dem Subjekt dann qua Subjekt der Rationalität die konstitutive Rolle im Erkenntnisprozess zukommt, während die Fragestellung im Fall einer schwachen Rationalitätskonzeption auf empirische (soziologische und psychologische) Wege gelenkt wird, die schlussendlich im Konzept einer naturalisierten Erkenntnis münden muss.
Das erkenntnistheoretische Verhältnis lässt sich auch noch von einer zweiten Seite her bestimmen. Einerseits kann man die Gegenständlichkeit als die Gattung denken, deren eine Art die Objektivität ist. Die Formen, in denen dem Subjekt ein Inhalt werden kann, stehen hier im erkenntnistheoretischen Primat. Beispiele wären Konstanz der Bezugnahme als Identität, Widerspruchsfreiheit etc. Der Wahrheitsanspruch aufgrund angebbarer Kriterien, anhand derer entschieden werden kann, also das, was oben Objektivität genannt wurde, ist nicht allein an sinnlich gegebene Objekte gebunden, diese starke Fassung der Rationalität kann als erkenntnistheoretischer Primat des Subjekts bezeichnet werden.
Der Primat ließe sich aber auch anders denken, vom Objekt her. Das wäre wieder die schwache Fassung der Rationalität. Wahrheitswertbezogene Entscheidbarkei t, die allein auf dem sinnlich wahrnehmbaren Objekt beruht. Beide Positionen wären in ihrem Gegensatz begriffen, insofern die Relation von Gegenständlichkeit und Objektivität erkannt wäre. Das meint die vollständige Explikation der Bedingungen, unter denen Wahrheitsansprüche entscheidbar sind. Diese Überlegung wird zu einem späteren Zeitpunkt ins Zentrum der Untersuchung rücken.
Da nun bei Schelling das Subjekt thematisch wird, steht explizit das Gegenständliche überhaupt im Fokus der Aufmerksamkeit, weil das Subjekt in Schellings Fassung die Einheit von „Denken, Wissen oder Handeln“[21], also vornehmlich Leistung, besser gesagt, Funktion ist:
„Wenn es also eine Transzendental-Philosophie gibt, so bleibt ihr nur die entgegengesetzte Richtung übrig, vom Subjektiven als vom Ersten und Absoluten auszugehen und das Objektive aus ihm entstehen zu lassen.“
Also zeigt die Transzendentalphilosophie, wie aus der reinen Leistung, oder aus der reinen Funktion, die reine Gegenständlichkeit überhaupt entspringt. Das Netz der Relationen von Subjekt und Objekt soll expliziert werden, wobei das in diesen Relationen Notwendige herausgeschält werden, die wechselseitige Implikation und Exklusion aufgezeigt werden soll. Die so begriffene, reine Gegenständlichkeit kann auch als die Form der Gegenständlichkeit überhaupt gefasst werden. Das Objekt wäre also als die Form der Gegenständlichkeit überhaupt bezeichnet. Die Form wird solcherart selbst zum Inhalt.
Hier ist eine wichtige Weichenstellung im Auge zu behalten, eine strategische Frage muss gelöst sein: In welchem Sinn ist hier vom Objekt die Rede? Meint man die Formen der Objektivität, der Gegenständlichkeit oder die Formen der Vorstellung überhaupt? Diese Frage hat gewichtige Konsequenzen, denn insofern das Subjekt sich selbst zum Objekt wird, wird es Gegenstand. Wie ist aber das Verhältnis Gegenstand-Objekt zu bestimmen, und welche Art von Folgen ergeben sich aus der Bestimmung dessen, was Objekt heißen soll, für das Subjekt selbst?
„Denken, Wissen und Handeln“[22] sind Momente, in denen sich die Leistungen des Subjekts verbergen, unthematisch wirken, implizit bleiben. Denken kann hier als das Medium begriffen werden, welches die beiden grundsätzlichen Formen der Wechselwirkung, Wissen und Handeln, beinhaltet und ermöglicht.[23]
In der Transzendentalphilosophie, als der Explikationsform der Funktionen des Subjekts, kann man also in diesen Funktionen des Subjekts noch eine Differenzierung durchführen. Zwischen den Funktionen des Subjekts, welche ihm ein Gegenüber konstituieren, und denjenigen Funktionen, welche am konstituierten Objekt manipulativ wirken. Normalerweise werden hier die Terme theoretische und praktische Philosophie verwendet, um die Reflexion auf die beiden Funktionen des Subjekts zu differenzieren und diese Differenzierung auch auseinander zu halten.
Die theoretische Philosophie soll klären, wie wir Dinge außer uns erkennen können. Das ist die Erkenntnis der Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände der Erkenntnis. Diese Festlegung gilt unter der Voraussetzung, dass wir Erkenntnis mit einem Set an Regeln in Verbindung bringen, das uns die Kriterien für wahrheitsrelevante Entscheidung zur Verfügung stellt. Historisch betrachtet gewinnt diese Fragestellung erst explizit bei Kant die Bedeutung, die wir hier verwenden. Die transzendentale Wende kann durchaus auch als ein Verschieben des Schwerpunkts der Fragestellung verstanden werden, die nun nicht mehr einfach das Objekt als Gegebenes vorstellt, sondern es als Leistung begreift. Erst in dieser Fragestellung kann klar werden, wie wichtig diese Kriterien für einen gerechtfertigten Wahrheitsanspruch sind.
Der theoretischen Philosophie entgegengesetzt, darum aber auch notwendig mit ihr zusammenhängend, ist die Veränderung der Gegenstände durch unseren Willen, durch unsere Zwecksetzung. Das ist Thema der praktischen Philosophie, die genau die Bedingungen dieser Fragestellungen untersuchen und explizieren soll, wie das Objektive (jetzt nur als „Willens-Unabhängiges“ gemeint) als durch unseren Willen veränderlich zu denken sei.
Schon in diesen ersten Versuchen, die Differenz von praktischer und theoretischer Philosophie, die sich an ihrem Gegenstand insofern spiegelt, als man von einer theoretischen und einer praktischen Vernunft sprechen kann, zu bestimmen, zeigen sich Gewitterwolken am Horizont. Ein Hauptaugenmerk der Fragestellung in dieser Untersuchung wird somit dem Verhältnis Praxis und Theorie gewidmet werden müssen.
1.2 Schellings Antinomie – zwei Ebenen des Widerspruchs
Die Explikation der notwendigen Verhältnisse des triadischen Gefüges von Subjekt, Wissen, und Objekt verdichtet sich auf Seite 17 des 'Systems des transzendentalen Idealismus' zu einer Kardinalfrage. Schelling schreibt:
„... wie können die Vorstellungen zugleich als sich richtend nach den Gegenständen, und die Gegenstände zugleich als sich richtend nach den Vorstellungen gedacht werden?.“[24]
Diese Frage kommt zwar ohne den Gestus einer kantischen Antinomie aus, Schelling kennzeichnet sie einfach nur als Widerspruch, faktisch ist sie aber als eine Antinomie zu betrachten. Bei Kant gibt es zwar eine Vielzahl an Formulierungen, die Antinomie der Vernunft ist jedoch immer nur eine, wie ja Kant auch immer von "der Antinomie der Vernunft“ spricht. In der "Kritik der reinen Vernunft" erscheint die Antinomie in vierfacher Formulierung. Die Problematik des Anfangs in der Zeit, der unendlichen Teilbarkeit und der Existenz Gottes bleibt auf die reine theoretische Vernunft beschränkt. Die dritte Formulierung der Antinomie kehrt aber, in leicht veränderter Gestalt, als Ausdruck der gleichen Problematik in den folgenden beiden Kritiken wieder.[25] Das Kernstück ist dabei immer das Verhältnis von Theorie und Praxis. Jahre später, in der "Kritik der Urteilskraft", entsteht die Antinomie der Vernunft durch die Differenz der beiden Dimensionen des Denkens:
„Satz: Alle Erzeugung materieller Dinge ist nach bloß mechanischen Gesetzen möglich.
Gegensatz: Einige Erzeugung derselben ist nach bloß mechanischen Gesetzen nicht möglich.“[26]
Die Explikation dieser Antinomie gibt Kant vor allem in den Paragraphen 76 und 77. Michael Benedikt hat ganz Recht, wenn er über die Verbindung zwischen Kant und Schelling und den Zusammenhang der KdU und des 'System des transzendentalen Idealismus' sagt: „Die Auflösung eines Teilaspektes der darin behandelten Fragenkomplexes hat Schelling zu seinem 'System des transzendentalen Idealismus' geführt“[27].
In den Begriffen Denken, Wissen und Handeln konstatiert Schelling hier auf mehreren Ebenen ein grundlegendes Problem. Auf einer ersten, unmittelbaren Ebene stellt sich hier die Frage, inwieweit Wissen und Handeln einander nicht ausschließen. Um zu wissen, so sagt Schelling schon im ersten Satz der Schrift[28], ist eine bestimmte Relation zwischen dem Subjekt und dem Objekt nötig und gefordert. Diese geforderte Übereinstimmung ruft aber eine Unverträglichkeit hervor. Wenn Wahrheit in der Übereinstimmung des Subjektiven mit dem Objektiven liegen soll, dann wird dem Objekt der erkenntnistheoretische Primat zuerkannt. Die Vorstellungen, als der allgemeinste Modus der Einheit von Subjekt und Objekt, werden hauptsächlich durch die Objektseite generiert. Das willensunabhängige Objekt soll das Kriterium darstellen, anhand dessen die wahrheitsrelevante Entscheidung vollzogen wird, im Sinne eines unbestechlichen, objektiven Prüfsteins der Wahrheit, der als solcher vom subjektiven, je einzelnen Interesse unabhängig sein soll und in der Zeit als unveränderlich gedacht wird.
Auf der anderen Seite der Dichotomie von Subjekt und Objekt erweist sich das genaue Gegenteil der theoretischen Forderung nach Unabhängigkeit des Objekts: Der Gegenstand muss sich durch Handeln verändern und manipulieren lassen. Der Primat steht in dieser Hinsicht eindeutig auf Seiten des Subjekts, da die Realisation der Intention zur Handlung gewahrt bleiben muss. Wie kann aber gerade dasjenige, das als der bestimmende Leitfaden des theoretischen Denkens anerkannt wird, zugleich, oder besser gesagt, indem es das ist, als veränderbar gedacht werden? Das Bestimmende soll, insofern es Bestimmendes ist und weil es Bestimmendes ist, als zu Bestimmendes gedacht werden. Aus dieser Kontradiktion ergeben sich zwei Folgerungen.
Einerseits fällt das Kriterium der Wahrheit haltlos in sich zusammen, wenn das Bestimmende manipulierbar gedacht wird. Der starke Objektbegriff verliert dadurch gerade seinen größten Vorteil, um dessentwillen er ja überhaupt erst eingesetzt wurde. Die Geschichte der Erkenntnistheorie ist auch eine der beiden Parteien, die das Objekt als bewusstseinsunabhängig bzw. als willensunabhängig bestimmten. Der größte Vorteil der ersteren Position besteht gerade in der unmittelbar intuitiv einleuchtenden Bedeutung der Unabhängigkeit der Dinge vom Subjekt, die dem Objekt seinen Stellenwert verleiht.
Andererseits bricht jeder Subjektbegriff angesichts der unüberwindlichen Dominanz des Objekts in sich zusammen. Die für einen Subjektbegriff notwendige Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie oder Unabhängigkeit gegenüber den Objekten kann nicht mehr aufrechterhalten werden, wenn schon der allererste Anspruch einer solchen Autonomie, sich selbst zum Handeln zu bestimmen, rückhaltlos kollabiert. Das Selbst soll sich gerade durch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber dem Faktischen auszeichnen, die ihm aber durch die übermächtige Objektivität vollständig verstellt wird. Der solcherart zwischen Skylla und Charybdis stehende Schelling schreibt:
„Mit einem Wort, über der theoretischen Gewißheit geht uns die praktische, über der praktischen die theoretische verloren; es ist unmöglich, daß zugleich in unserer Erkenntnis Wahrheit, und in unserem Wollen Realität sei.“[29]
Auf einer höheren Ebene betrachtet, etwas weiter vom Text selbst entfernt, der wahren Bedeutung der Reflexion allerdings näher, entsteht eine andere Fragerichtung. Wie ist denn das Verhältnis von Subjekt, Objekt und deren Identität, Wissen, das Schelling hier präsentiert, zu verstehen? Indem die grundlegende Trias auf diese Problemstellung angewendet wird, ergibt sich, dass das in Frage Stehende der Begriff des Wissens ist. Wissen verstanden als der ausgezeichnete Modus des beiderseitigen Einander-zugeordnet-Seins der beiden Pole.
Zu Beginn wurde klar herausgestellt, dass die Aufklärung der Vorurteile des naiven Bewußtseins das Hauptziel und der Zweck des transzendentalen Idealismus sei. Das Ganze der einzelnen Vorurteile, das zeigt sich jetzt, ist die ursprüngliche Einheit von Subjekt und Objekt, das unmittelbare Wissen. Dieses Wissen, in dem sich die beiden Pole noch nicht differenziert haben. In diesem Sinne ist das obige Zitat kein neues Resultat, sondern nur der erste Punkt, das erste Ergebnis der durchgeführten Untersuchung, nur eben rein betrachtet. Man könnte sagen, dass der Gegenstand der Untersuchung nun, nach einer erfolgten Vorbehandlung, erst den für die folgende Analyse notwendigen Reinheits- und Klarheitsgrad erreicht hat.
1.3 Momente der Antinomie
Schellings Gedankengang im „System des transzendentalen Idealismus“ ist rasend schnell, voller Esprit und genialischer Einfälle. Bei diesem Tempo bleiben aber terminologische Unklarheiten zurück, worauf schon hingewiesen wurde, vor allem die verschiedenen Modi der Bewusstseinsinhalte stehen unerklärt nebeneinander. Ebenso ist der Zusammenhang der beiden Triaden, Subjekt, Objekt, Wissen einerseits und Denken, Wis sen und Handeln andererseits, ungeklärt. Die beiden Triaden gelten zunächst als Ausgangspunkt der Reflexion, dann in Folge als Resultate der Formulierung des Programms einer Transzendentalphilosophie und damit auch implizit des Widerspruches selbst. Der innere Zusammenhang, die grundlegende Gesetzlichkeit, an der sich die Reflexion entlangdenkt, bleibt von Schellings Seite aus im Dunkeln. Es wird jetzt sicher auch kein System in das Ganze hineingebracht werden, nur einzelne Punkte sollen herausgegriffen werden.
Zwei Herangehensweisen stehen uns nun zur Verfügung, um Licht in die oben dargestellte Problematik zu bringen. Der zweite dieser möglichen Zugänge liegt im Text selbst, zunächst aber soll eine andere Perspektive der besprochenen Problemlage aufgezeigt werden. Zu diesem Ende werden wir erkenntnistheoretische Positionen bemühen, angelehnt an die Positionen Ernst Cassirers in „Substanz und Funktionsbegriff“.
Cassirer geht darin davon aus, dass Logik und Metaphysik sich einander wechselseitig bedingen. Die revolutionären Umwälzungen in der formalen Logik durch Boole und Frege führen Cassirer zur Einsicht, dass diese Veränderungen auch in die Reflexion der Erkenntniskritik aufgenommen werden müssen. Die aristotelischen Positionen kennzeichnet er als die der Substanzmetaphysik und - logik,
„... die Aristotelische Logik ist in ihrem allgemeinen Prinzipien der getreue Ausdruck und Spiegel der Aristotelischen Metaphysik.“[30]
Ein weiterer wichtiger Punkt in Cassirers Überlegungen ist, dass sich der neuzeitliche Begriff der Natur, und damit auch der Naturwissenschaft, immer schon am mathematischen Funktionsbegriff orientiert hat, der Funktionsbegriff steht also nicht nur im Zentrum der Logik und Metaphysik, sondern auch im Zentrum der Naturwissenschaft.
Vor dem Hintergrund der eben angestrengten Überlegungen zur Differenz von Subjekt und Funktionslogik bzw -metaphysik, lassen sich zwei Wege aufzeigen um Schellings Antinomie von Theorie und Praxis zu interpretieren. Die substanzmetaphysische Fassung des Objektbegriffs setzt das Objekt außerhalb des Bewusstseins als vollständig Bestimmtes voraus. Der Akt der Bestimmung ist so nur sekundär gegenüber dem Objekt, er ist nichts anderes als ein passives Aufgreifen eines Gegebenen. Ein Abbilden des Wahrgenommenen. Erkenntnis wird so nicht als aktive Leistung, sondern als passive Rezeptivität gedacht. Dieser erkenntnistheoretische Primat des Objekts führt unvermeidlich in die von Schelling konstatierte Antinomie.
Die Subjekt-Metaphysik oder besser diejenige, welche den Begriff der Funktion und Relationen ins Zentrum ihrer Untersuchungen stellt, weiß, dass Gegenstände selbst unerkennbar sind, nur ihre Wirkungen lassen sich bestimmen. Der Gegenstand ist nicht etwas außerhalb der Prädikate, welche ihn bestimmen, sondern er ist die Funktion ihrer Einheit. Die Was-Frage tritt so hinter die Wie-Frage zurück. Mathematisch gesprochen, f(x,y) = kx +d, der allgemeine Ausdruck für die Funktion. Eine Funktion selbst ist nichts außer dem Zusammenhang der Werte, die in sie einfließen. Die Erkenntnis ist so gedacht eine aktive, spontane Leistung. Mit dem Schlagwort des deutschen Idealismus, wonach aus der Substanz Subjekt werden solle, war unter anderem auch dieser Übergang von der Ding- zur Funktionsmetaphysik gemeint.
Gegenstände, als das sinnlich wahrnehmbare, einzelne, kontingente, richten sich durchaus nach unserem Willen, allein die Relationen und Funktionen selbst lassen sich nicht manipulieren. Diesem Standpunkt zufolge können wir zwar frei wählen, welche Werte wir einsetzen und damit auch indirekt beabsichtigte Wirkungen hervorrufen, die Funktion selbst liegt aber außerhalb unserer Möglichkeiten der Manipulation. Das was dieser Position gemäß eigentlich den Gegenstand ausmacht, ist nicht das Einzelne, sinnlich Wahrnehmbare, sondern die dahinterstehende Funktion.
Aber gerade in diesem Verstande sind die Funktionen das, was es uns überhaupt erst erlaubt, Gegenstände zu manipulieren. Denn Gegenstände sind selbst als durch den dynamischen, praktischen Vernunftraum konstituiert anzusehen, die Relationen und Funktionen aber als durch den theoretischen, mathematischen. Nur auf diesem Weg ist es möglich, Gegenständlichkeit einerseits als das geforderte Kriterium für wahrheitsrelevante Entscheidungen zu bestimmen, andererseits aber nicht einem naiven Objektbegriff zu verfallen, der dann seinerseits nie mehr mit einem vollständigen Subjektbegriff zusammengedacht werden kann. Schelling selbst, wie wir später sehen werden, kann dieses Problem nur in einer Harmonie auflösen, und fällt, somit wieder hinter Kant, von dem Cassirers Differenz von Substanz- und Funktionsmetaphysik eigentlich herrührt, zurück.
Es gibt noch eine andere Variante, auf Schellings Widerspruch einzugehen. Die erste Variante geht von der Differenz von Substanz- und Subjekt-Metaphysik aus, diese Differenz ist dem Text selbst fremd. Schellings Überlegungen, die am Text selbst auszuweisen sind, orientieren sich an einem anderen Problembereich. Wie schon gezeigt, orientiert sich der Argumentationsgang vornehmlich an den beiden Triaden. Subjekt, Objekt und Wissen einerseits, andererseits Denken, Wissen und Handeln. Der zentrale Begriff, über den die beiden Geltungsbereiche vermittelt sind, ist der des Wissens. Man kann somit auch die formale Definition von Wahrheit verwenden, von der Schelling selbst am Anfang das Projekts ausgeht, um zu analysieren. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, den ideengeschichtlichen Zusammenhang in der philosophischen Entwicklung der Problemstellung von Kant in den deutschen Idealismus hinein besser hervorheben zu können[31]. Schelling verwendet zur Konstruktion seiner Antinomie die formale Wahrheitsdefinition. Die Übereinstimmung von Gegenstand und Vorstellung wurde seit der klassischen griechischen Philosophie als Wahrheitsdefinition tradiert. Den klassischen Ausdruck erreichte sie in der hochscholastischen Begrifflichkeit als Theorie der adequatio von Vorstellung und Ding. Schelling stützt sich auf diesen Begriff der Wahrheit als Ausgangspunkt seiner Untersuchung, wobei er unbemerkt mit dem klassischen Wahrheitsbegriff auch dessen Objekt-Begriff, der dieser Theorie zugrundelag, mit übernimmt und so seinen eigenen Ansatz der Transformation des Substanz- zum Funktionsbegriff unterläuft.[32]
Somit steht das Objekt in Schellings Konzeption im erkenntnistheoretischen Primat. Die Vorstellung muss sich nach ihm richten, um wahr zu sein. Das Objekt ist also hier das Bestimmende, das Unabhängige und das Subjekt das Abhängige und Bestimmte. Somit ist klar, wie die Antinomie entsteht, denn wie kann in ein und derselben Hinsicht das Bestimmende auch als bestimmt gedacht werden?
1.4 Die Auflösung des Problems bei Schelling - der Weg zum Wissen
Das Problem, das die Unvereinbarkeit der praktischen mit der theoretischen Philosophie erweisen soll, ist in seiner Auflösung nicht mehr in eben dieser Differenz von Praxis und Theorie zu denken, sondern aus dem Grund beider heraus. Der Einheitsgrund, aus dem die Differenz beider erst gedacht werden kann, ist laut Schelling die Teleologie.
Das vollständige Subjekt, das als solches seinem Begriff entspricht und das Prinzip der Transzendentalphilosophie darstellt, kann nur als freies Bewusstsein hinreichend begriffen werden. Freiheit ist aber nur in einer gedoppelten Weise zu begreifen. Einerseits als die theoretische Vernunftdimension, die Erkenntnis der Objekte, andererseits als die praktische Vernunftdimension, das Ganze der manipulativen Handlungen, der Realisierung der Vernunftentwürfe. Schelling drückt das dergestalt aus, dass:
„... die Freiheit nur zu begreifen ist, durch eine identische Tätigkeit, welche bloß zum Behuf des Erscheinens sich in bewußte und bewußtlose getrennte hat, ...“[33]
So gesehen muss für Schelling das Subjekt, das einzige Prinzip der Transzendentalphilosophie, die Identität von bewusster und bewusstloser Tätigkeit, von Rezeptivität und Spontaneität sein, da es ansonsten nicht Ursprung oder Grund beider Vernunftdimensionen sein kann. Das Ich kann nur als Selbstbezug gedacht werden, als das, was sich selbst zum Gegenstand machen kann, womit es immer sowohl Erkanntes als auch Erkennendes in einem ist. Als Gegenstand, als Thematisiertes, ist es begrenzt, als thematisierendes Ich ist es unbegrenzt. Der Gedankengang gewinnt aber noch zusätzlich an Komplexität, da eine jede ernsthafte kategoriale Analyse der grundlegenden Struktur aller Kategorialiät eine Explikation der Selbstbezüglichkeit ist, wodurch diese Selbstbezüglichkeit immer mitgedacht werden muss. So entsteht eine zweite Reflexion: Indem sich das Subjekt selbst thematisiert, thematisiert es sich nicht nur als Begrenztes sondern immer auch schon als Unbegrenztes, wobei dieser Ausdruck ungenau ist. Denn das sich selbst thematisierende Subjekt ist nur unbegrenzt insofern und weil es begrenzt ist und vice versa. Wenn es nur begrenzt wäre, also nur Gegenstand bliebe, so könnte es sich nicht selbst thematisieren.[34] Nur weil es sich selbst thematisieren kann, sind ihm Objekte, die Objekte sind das, was als Inhalt in den Vorstellungen des Subjekts ist. Das Subjekt ist somit das immer hinter dem Objekt Stehende und somit nie unmittelbar selbst thematisch Werdende des naiven Bewusstseins. Weil aber das Selbstbewusstsein eine selbstbezügliche Struktur ist, so ist jedoch auch das, als das was es ist, thematisierbar.
Durch diese Reflexion ist das Subjekt sich selbst Objekt geworden, und nur so kann es auch als Prinzip der Transzendentalphilosophie gedacht werden. Das immer unthematisch Mitgedachte zum expliziten Thema zu machen heißt Transzendentalphilosophie betreiben: die Vermittlung des scheinbar Unvermittelten erweisen und diesen Prozess in seiner Notwendigkeit begreifen. Die Vermittlung als zentrales Thema der Philosophie stellt sich vorläufig als Moment der Subjektivität dar. Später wird es gelten, andere Formen und Fassungen desselben Sachverhalts zu untersuchen.
Bis hierher kann man Schellings Überlegungen problemlos folgen. Sowohl die Explikation der Problematik der Disjunktion von praktischer und theoretischer Vernunft als auch die grundlegende Lösungstrategie, die Frage nach der Vereinbarkeit von Erkenntnis und Handeln über die Analyse der Begriffe Wahrheit und Wissen zu beantworten, erfüllen ihren Zweck. Doch mit der Analyse des Subjekts als letztem Grund des Wissens beginnt Schelling in die Irre zu gehen: Seinem Ansatz gemäß versucht er die gesamte Problematik in das Selbstbewusstsein zu verschieben.
Alles Wissen soll auf einem letzten, absoluten Wissen beruhen. Dieses geforderte Wissen ist das Selbstbewusstsein, das unbezweifelbare Wissen vom eigenen Ich. Eine Einschränkung ist aber gemäß der Einstiegsreflexion, der Differenz von Kultur und Natur, die in die von Natur- und Transzendentalphilosophie mündet[35], immer mitzudenken: Nur weil Transzendental-philosophie betrieben wird, ist das Selbstbewusstsein absolut, weil nicht nach dem Sein, sondern nur nach dem Wissen gefragt wird. Nur indem das Ich sich selbst erkennt, kann das Ich auch anderes erkennen. Könnte es sich selbst nicht zu seinem eigenen Objekt machen, so könnte es gar nichts erkennen, denn ihm könnte rein gar nichts Objekt werden.
Bezugnehmend auf die Überlegungen im letzten Kapitel, wo von Gegenständlichkeit und Objektivität als zwei wesentlichen Seiten der Konstanz der Bezugnahme die Rede war, lässt sich hier anknüpfen. Konstanz der Bezugnahme meint, dass sich eine wiederholbare Relation zwischen zwei Polen herstellen lässt, die in ihrer Eindeutigkeit durch die formale Logik bestimmt ist. Eine ausdrückliche Auseinandersetzung mit der Problematik dieser beiden Formen findet sich bei Schelling an genannter Stelle nicht, wodurch der wesentliche Zusammenhang, ob und wie das Subjekt entweder als empirischer Gegenstand oder bloß als geregelter Vorstellungsinhalt zu denken sei, im Dunkeln bleibt. Welchen Kriterien unterliegt nun das sich selbst thematisierende Subjekt, anhand welcher Bestimmungen ist es von empirischen Objekten zu unterscheiden? Schelling sagt nur so viel, dass die Konstanz der Bezugnahme die Bezugnahme auf Objekte überhaupt erst bedingt und ermöglicht. Die wesentliche Differenz beider, und damit die epistemologischen Auswirkungen der Fassung des Objekt- auf den Subjektbegriff, wird aber nicht weiter verfolgt, woraus sich Schwierigkeiten ergeben werden.
Wissen überhaupt bedarf also des von sich selbst Wissens als seines ersten Grundes. Dieses erste Prinzip ist immer nur implizit gegeben. Die Transzendentalphilosophie, und nur sie allein, kann es thematisch werden lassen und explizieren. Da nur nach dem Wissen und seiner letzten Bedingung gefragt wird, ist das Wissen selbst sein Gegenstand. Es ist somit Form und Inhalt zugleich,[36] da das Ganze dieses Gefüges das Selbstbewusstsein ist, ist es also ursprünglich im ersten unteilbaren Akt des Selbstbewusstseins, die Form des Wissens sowohl wie dessen Inhalt, ist es bewusst wie unbewusst und theoretisch wie praktisch.
Schelling macht klar, dass Inhalt und Form sich wechselseitig implizieren, da sie nur im Zusammenhang des Selbstbewusstseins zu denken sind. Subjekt und Objekt sind, und da eines ohne das andere nicht zu denken ist, auch Inhalt und Form gegenüber implizierend. Obwohl, oder besser gesagt: weil sie sich gegenseitig ausschließen. Das Selbstbewusstsein ist Identität von Form und Inhalt, da das Wissen sich selbst (Form) der Gegenstand (Inhalt) ist.
Diese Resultate der Reflexionen über das Gefüge Subjekt-Wissen-Objekt bringt Schelling in der Deduktion des Prinzips des transzendentalen Idealismus in einen argumentativen Zusammenhang. Wir werden diese Deduktion nicht als Ganzes nachvollziehen, sondern nur gewisse Überlegungen herausnehmen, die für unser eigenes Ziel von Bedeutung sind. Im zweiten Punkt der Deduktion schreibt Schelling:
„Unbedingt weiß ich nur dasjenige, dessen Wissen einzig durch das Subjektive, nicht durch das Objektive bedingt ist."[37]
Denn Wissen ist gleich dem Subjektiven, weswegen auch das Subjekt nicht wirklich eine Bedingung, unter welcher das Wissen steht, darstellt, vielmehr kann hier von einer Identität beider, nicht von Unterordnung, sondern von wechselseitiger Implikation gesprochen werden. Somit kann unbedingt in dieser Textstelle als notwendig gelesen werden. Diese Bedeutung ist die gleiche, die Kant an manchen Stellen verwendet, eine Fassung des Modalbegriffs, die das, was als unter einer Bedingung stehend gedacht wird,[38] als zufällig bestimmt. Notwendig ist dann allein dasjenige, welches unter keiner Bedingung steht. Wissen aber ist synthetisch, Subjektives und Objektives vereinigend, sonst kann es nicht auf Gegenstände angewendet werden, und was prinzipiell nicht angewendet werden könnte, verfehlt die Bedingung dafür, Wissen zu sein. Insofern ist diese Fassung eines absoluten, nicht unter einer Bedingung stehenden Wissens defizient. Im vierten Punkt der Deduktion[39] geht Schelling genau auf diese Problematik des Verhältnisses von Subjekt und Objekt im Wissen ein und differenziert deswegen zwischen zwei Arten des Wissens. Wenn das Wissen ein Objekt braucht, so ist es nicht unbedingt, unbedingtes Wissen ist also nur denkbar, indem das Objekt zugleich Subjekt ist. Diese Überlegung könnte als eine Bestimmung analytischen Wissens gelesen werden. Synthetisches Wissen aber, welches in einer Identität der Verschiedenen besteht, steht immer unter einer Bedingung und kann somit nie Erstes und Unbedingtes sein.
Im sechsten Punkt der Erläuterungen zur Deduktion schreibt Schelling:
"Unbedingt heißt, was schlechterdings nicht zum Ding, zur Sache werden kann. Das erste Problem der Philosophie läßt sich also auch so ausdrücken: etwas zu finden, was schlechterdings nicht als Ding gedacht werden kann. Aber ein solches ist nur das Ich, und umgekehrt, das Ich ist, was an sich nicht-objektiv ist."[40]
Denn was auch immer Ding wird, steht unter der Bedingung eines Bewusstseins, dem es Ding ist. Daraus folgt, dass es nur ein Unbedingtes geben kann, das nicht Ding sein kann, da es Selbstbewusstsein ist. Diese Bestimmung ist vor allem im Hinblick auf Kants Differenz von Zufälligkeit und Notwendigkeit interessant. Das hieße nämlich, zufällig ist nur das, was Ding, besser gesagt Objekt, sein kann. Objekt ist nur das, was in einer Relation steht, zum Subjekt sowohl als auch zu anderen Objekten. Es kann sozusagen nie nur ein Objekt und eine Relation geben. Das Ich aber steht insofern nicht in Relation, wird so nicht Objekt, als die Struktur, Funktion-Relation, zum Gegenstand der Erkenntnis wird. Das heißt, die reine Struktur thematisiert sich selbst. Fragwürdig ist nur, ob Schellings Identifizierung von Struktur und Ich dieser Überlegung gerecht werden kann.
Im sechsten Punkt der Deduktion selbst bringt Schelling noch einen sehr interessanten, neuen Gedanken ein.
„Wie Vorstellung und Gegenstand übereinstimmen können, ist schlechthin unerklärlich, wenn nicht selbst im Wissen ein Punkt ist, wo beide ursprünglich Eins sind.“[41]
Diesen Punkt, an dem "Vorstellen" und "Sein" ursprünglich eines sind, gilt es also aufzufinden: Die Einheit von Denken und Sein.
Schelling fasst diesen Punkt, der auch als Einheit von Denken und Sein bezeichnet werden könnte, in Anlehnung an das cogito ergo sum, als Selbstbewusstsein; ist das Selbstbewusstsein doch als der Punkt gedacht, bei dem das „principium cognoscendi und essendi“[42] zusammenfallen sollen. Das heißt, Schelling führt seine Deduktion entlang der Frage der Vereinbarkeit von Vorstellung und Gegenstand, und da der einzige Punkt, der das zu leisten vermag, das Selbstbewußtsein ist, meint Schelling, dass seine Deduktion des Selbstbewusstseins als das Prinzip der Philosophie geglückt sei.
So kommt Schelling im siebten Punkt der Erläuterungen zur Deduktion zu einem Ergebnis. Das Wissen, so Schelling, das hier gefordert wird, muss ein freies, ein von Begriffen freies sein. Er spricht von einem Vermögen zur Anschauung, einer intellektuellen Anschauung, um das Ich als selbstbewusstes begreifen zu können. Diese Lösung ist zutiefst problematisch. So produktiv Schellings Formulierung der Antinomie und sein erster Lösungsansatz auch sind, ist diese Lösung abzulehnen. Die Gründe dafür sind wie folgt:
1. Schelling hat insofern Recht, als alles Wissen, das unter einer Bedingung (diese Bedingung ist hier das Objekt) steht, nicht frei ist. So ist es nur Wissen von dem, unter dessen Bedingung es steht, es ist nur Wissen seines Objekts. Wenn aber die Bedingung, unter der es steht, nicht eine aus der Menge der kontingenten Bedingungen ist, ein einfaches Objekt, das sein kann oder auch nicht, sondern unter der unbedingten, also mithin notwendigen Bedingung des Selbstbewusstseins steht, so gilt dieser Einwand Schellings nicht. Denn dann ist es immer auch zugleich Wissen von sich selbst, also Prinzip aller Einzelfälle des Wissens, alles, das überhaupt gewusst werden kann.
2. Problematisch ist, dass dieses ursprüngliche Wissen laut Schelling ohne Beweise, Schlüsse, und somit überhaupt frei von Vermittlung, sein muss. Es muss als Ganzes in einem unteilbaren Akt erkannt werden. Gerade dann aber kann es kein Wissen sein, da Wissen ja, auch von Schelling, als Vermittlung bestimmt war:
„Alles Wissen beruht auf der Übereinstimmung eines Subjektiven mit einem Objektiven. Denn man weiß nur das Wahre; die Wahrheit wird aber allgemein in die Übereinstimmung der Vorstellungen mit ihren Gegenständen gesetzt.“[43]
Die Übereinstimmung, von der Schelling im Zitat spricht, kann nur als Vermittlung von Subjekt und Objekt begriffen werden, niemals als einfache Identität.
3. Dass dieses Wissen Anschauung sein soll, ist vollständig abzulehnen. Denn: Anschauen bedeutet gerade das, unter einer Bedingung zu stehen, nämlich unter der Bedingung dessen, das angeschaut wird. Die Differenz von Spontaneität und Rezeptivität kann nur insofern sinnvoll sein, als sie parallel zur Disjunktion von Sinnlichkeit und Verstand verläuft. Die Inhalte der Anschauung sind immer Bilder, d.h. kontingent, denn Bilder sind immer Einzelnes, Singuläres. Einzelnes ist immer kontingent. Gerade das, was nicht als einzelnes Ding gedacht werden kann, das Subjekt, wird so vergegenständlicht. Das absolut freie Wissen muss immer eine Relation sein, welche ihre Relate überhaupt erst setzt.
4. Methodisch ist es außerdem für äußerst fragwürdig zu erklären, dass am Punkt des Fundaments des Wissens, und als das war es ja gefordert, eine völlig neue Art der Erkenntnis eingeführt werden soll. Zu Beginn der Untersuchung ging Schelling noch den Weg der Aufklärung, einer Verabschiedung der Vorurteile nach rationalen Kriterien. Ein kritisches Verhältnis zur eigenen sozialen Tradition wurde angedacht, nun aber in der Auflösung der Problematik, an der Wurzel des Wissens selbst, verabschiedet Schelling den eigenen Rationalitätsbegriff zugunsten einer finsteren Konzeption von Ideenschau, die niemals mehr kommunizierbar und argumentierbar werden kann. Ähnlich wie Platon scheitert sein ganzes Projekt an seinem Höhepunkt. Bei Platon ist es die Stelle in der Anmerkung zur zweiten Deduktion[44], wo er die Frage nach der grundlegenden Vermittlung von Idee und Gegenstand in den unerklärlichen Augenblick verschiebt, bei Schelling wird dieselbe grundlegende Vermittlung als unbegreifliches Wunder gefasst. Ob nun die Frage:
„... aus welchem Grunde beruht die Beziehung desjenigen, was man in uns Vorstellung nennt, auf den Gegenstand?“[45]
mit einem Verweis auf die prästabilierte Harmonie, die Güte Gottes oder aber ein bloßes Wunder beantwortet wird, bleibt sich mit diesem Lösungsversuch Schellings gleich. Die ganze kritische Kraft eines Projekts der Transzendentalphilosophie verpufft, das Vorurteil „daß es Dinge außer uns gebe“[46] wird nicht hinterfragt und ans Licht des Bewusstseins gebracht, sondern einfach zum Irrationalen, zum Wunder erhoben. An diesem Ort muss einfach gesagt werden: wenn überhaupt etwas erkannt werden solle, dann muß es doch das Wissen selbst sein das sich zu erkennen vermag.
Schelling nimmt also das höchste Prinzip, wie Descartes auch, als eine intellektuelle Anschauung an. Als Anschauung muss dieses höchste Prinzip, wie schon gesagt, singulär gedacht werden. Schellings Ansatz ist unhaltbar, denn er bricht die Disjunktion Anschauung-Begriff auf und führt ein völlig Neues, Drittes ein.
Diese Position ist darauf zurückführen, dass Schelling entgegen seiner eigenen Bemühungen im substanztheoretischen Denken verhaftet bleibt. Zwar ist die Forderung des deutschen Idealismus, wonach das Objekt Subjekt werden solle, durchaus auch als Versuch einer Überwindung des dinglich verfassten Objektbegriffs zu verstehen, ganz gelingen kann dieser Versuch bei Schelling allerdings nicht. Später werden wir noch einmal auf dieses Problem zurückkommen, im Zuge des neuzeitlichen Paradigmenwechsels von Aristoteles „Fantasma“-Begriff zu Descartes Funktionsbegriff.
Das positive Resultat der Bemühungen Schellings, das wir in der Folge weiter untersuchen wollen, stellt sich so dar: Weil alles Handeln nur aufgrund einer ursprünglichen Einheit von Freiheit und Notwendigkeit möglich ist, welche es uns gestattet, die uns als Grenze und Beschränkung auftretenden Gegenstände doch willentlich zu manipulieren, so muss diese Einheit gemäß unserem Willen, das heißt zweckmäßig sein. Denn ein Wille ist nichts anderes als eine Kausalität nach Zwecken. Das ist die praktische Dimension, die Schelling herausarbeitet. Die theoretische Hinsicht der Forderung besteht nun darin, dass die Entstehung, bzw. die Produktion der Gegenstände als rein mechanisch, also ohne eine Zweckannahme, zu erklären sein muss.[47] Es zeigt sich somit, wie Schelling die Problemlage einkreist und gekonnt expliziert, aber nicht im Stande ist, in der Auflösung seinem eigenen Rationaliätsbegriff gerecht zu werden.
2. Kant
2.1 Rekapitulation
Werden die Ergebnisse der Antinomie Schellings nochmals betrachtet, so fällt auf, dass der Antinomie zwei Merkmale zukommen. Einerseits ist sie der Fokus eines Problems der Vereinbarkeit unseres theoretischen Erkenntnisanspruches mit unserem praktischen Selbstverständnis. Dieses Missverhältnis ist für einen Großteil des Denkens im 20. Jahrhundert geradezu paradigmatisch[48] und leitet sich in erster Linie aus der Konzentration der neuzeitlichen Philosophie auf eine gegenstandsorientierte Erkenntnistheorie her, die eine nominalistische Verkürzung der Sachlage wenn schon nicht impliziert, so doch wesentlich begünstigt.
Andererseits stellt sich die Frage, inwiefern die Antinomie überhaupt umgangen werden kann. Welche Elemente ins Schellings Ausgangsposition werfen die spezifische Fragestellung auf, sind für das Zustandekommen der Antinomie zuständig, welche Momente generieren sie?
Die Antinomie ensteht im Spannungsfeld der Triade Subjekt, Objekt, Wissen. In der einseitigen Fragerichtung des Programms des „System des transzendentalen Idealismus“ zieht es Schelling in die Ecke des Subjekts, um seine Frage zu beantworten. Aus dieser Einseitigkeit entsteht dann auch die Konstellation in der die Argumentation, welche eigentlich das Wissen sicherstellen sollte, kollabiert. Schelling beginnt seine Schrift gleich mit der formalen Wahrheitsdefinition, wenn man aber mit Kant geht und die formale Wahrheitsdefinition als geschenkt ansieht[49], dann stellt sich die Frage von einer anderen Seite betrachtet her dar.
Kant schreibt:
„Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntniß mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt und vorausgesetzt; ...“[50]
Meist wird dies so verstanden, als ob Kant mit diesen Worten die „adequatio“-Theorie der Wahrheit in ihrem Recht beließe. Paradigmatisch hierzu Heidegger, dessen Projekt gerade auch in einer einer Neufassung des Wahrheitsbegriffes besteht und sich hier in einem Überbietungsgestus vom kantischen Denken abheben will:
„Man übersieht dabei, worauf Brentano schon aufmerksam gemacht hat, daß auch Kant an diesem Wahrheitsbegriff festhält, so sehr, daß er ihn gar nicht erst zur Erörterung stellt ...“[51]
Wie Kant den Wahrheitsbegriff neu fasst, wie das mit der zitierten Stelle im Zusammenhang stehen kann und welche Folgerungen sich daraus ergeben, sehen wir im nächsten Kapitel.
2.2 Kants Überlegungen zur Wahrheitsdefinition
Wir beginnen mit einem kursorischen Überblick zu einer der bestimmenden Argumentfolgen in Kants Denken, von einer erkenntnistheoretischen Überlegung zu einer logischen, und von dieser dann zur Frage nach dem Wahrheitsbegriff. Zunächst orientieren wir uns am Leitfadenkapitel der Kritik der reinen Vernunft.
„Derselbe Verstand also und zwar durch eben dieselben Handlungen, wodurch er in Begriffen vermittelst der analytischen Einheit die logische Form eines Urtheils zu Stande brachte, bringt auch vermittelst der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen in der Anschauung überhaupt in seine Vorstellungen einen transscendentalen Inhalt, weswegen sie reine Verstandesbegriffe heißen, die a priori auf Objecte gehen, welches die allgemeine Logik nicht leisten kann.“[52]
Dieses Zitat spricht von zweierlei:
1. Die logische Form des Urteils wird vom Verstande in Begriffen analytisch zustandegebracht.
2. Der transzendentale Inhalt der Vorstellungen wird vom Verstande synthetisch zustandegebracht.
Dies liest sich fast so, als hätte Kant eine analytische Identitätslogik[53] vertreten. Dem ist aber nicht so, denn aufgrund der Tatsache, dass Kant die Vorrangstellung der Erkenntnis ins Subjekt verlegt, ergab sich auch zwangsläufig die Notwendigkeit, eine synthetische Logik zu vertreten, die allein (Erfahrungs-)Erkenntnis thematisieren kann.
Wie kam es dazu? Wenn man vom Subjekt, hypokeimenon oder Subtstrat ausgeht, wie etwa bei Aristoteles, dann liegt der erkenntnistheoretische Primat beim Objekt, dem Substrat. Wahre Urteile kommen dann allein durch den Satz vom Widerspruch, somit analytisch, zustande. Die Frage, ob das Prädikat im Subjekt enthalten ist oder nicht, wird zum wesentlichen Kriterium der Wahrheit einer beliebigen Aussage. Diesen grundlegenden Standpunkt kann man als Identitäts - bzw. Substanzlogik bezeichnen. Bei hinreichend genauer Untersuchung und Analyse können die Bestimmungen und Merkmale gewissermaßen aus dem grammatikalischen Subjekt herausgezogen werden. Die vollständige Identität von grammatikalischem Subjekt und Prädikat ist in jeder Theorie der Erfahrung ein wesentliches Manko, da Neues so nie begreifbar wird. Wahrheit ist in diesem logisch-erkenntnistheoretischen Zugang auf die Explikation beschränkt, Wissenserweiterung kann aus diesem analytischen Zugang heraus niemals adäquat erfasst werden. Solange die Wissenschaft hauptsächlich am Ideal des Beweises orientiert war, stachen diese Probleme nicht so ins Auge. Als Folge der neuzeitlichen Neuausrichtung der Aufmerksamkeit hin zu Kreativität und zu Forschung, als den primär interessanten Aspekten der Wissenschaftlichkeit, trat der Widerspruch von Logik und Wirklichkeit immer stärker zu Tage. Diese identitätslogische Position führt zu den Standpunkten, die Kant „Intellektualphilosophie“ nannte: wenn die Welt in der Studierstube erkannt werden kann.
Im Zuge seiner Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Problemen wird Kant auch mit der Unzulänglichkeit der Logikkonzeption seiner Zeit konfrontiert. Die Entwicklung seines Denkens, von den „Gedanken zur wahren Schätzung der Kräfte“ bis zur Vernunftkritik, trägt immer auch der logischen Dimension[54] Rechnung. Da er aufgrund der Unableitbarkeit der Realrepugnanz vom logischen Widerspruch[55], die Notwendigkeit der Anschauung, somit die notwendigen Rolle der Erfahrung in der Erkenntnis annehmen musste, mithin sich Erfahrung als Zusammenspiel von Anschauung und Begriff bestimmte, womit die Dichotomie von Verstand und Sinnlichkeit als den beiden, neutral genannt, Vermögen der Vorstellung gegeben ist[56], konnte er keine reine Intellektualphilosophie mehr betreiben.
Da der Begriff bei Kant die Einheit der Ordnung verschiedener Vorstellungen, von denen sich nicht alle unmittelbar, als Anschauungen, aufs Objekt beziehen müssen, auch Begriffe oder Urteile können hier vorkommen, unter einer höheren ist[57], ist die Entscheidung, ob sie subsumiert werden können oder nicht, eine Entweder-oder Entscheidung, somit eine nach dem Prinzip des Widerspruchs, dem obersten Prinzip der analytischen Urteile:
„Soll eine Eintheilung a priori geschehen, so wird sie entweder analytisch sein nach dem Satze des Widerspruchs; und da ist sie jederzeit zweitheilig (quodlibet ens est aut A aut non A) ...“[58]
Zugleich aber, da das Urteil zwei Verschiedenartige vereint, Begriff und, letztendlich immer auch, eine Anschauung, eine Vorstellung, die nur auf Einzelnes geht, ist es notwendigerweise eine Synthese; eine Synthese die zur Erkenntnis führt, die unbedingt etwas von ihren beiden Elementen grundsätzlich verschiedenes sein soll:
„...oder sie ist synthetisch; [...], so muß nach demjenigen, was zu der synthetischen Einheit überhaupt erforderlich ist, nämlich 1) Bedingung, 2) ein Bedingtes, 3) der Begriff, der aus der Vereinigung des Bedingten mit seiner Bedingung entspringt, die Eintheilung nothwendig Trichotomie sein.“[59]
Aus diesem Grund spricht Kant auch vom unbestimmten „X“[60] als demjenigen welches durch die Synthese von grammatischem Subjekt und Prädikat bestimmt wird. Außerhalb dieser Bestimmungsrelation bleibt es restlos unbestimmt, es ist nur absolute Position[61]. Die Bestimmung, die im Urteil erfolgt, ist also eine synthetische Einheit, nicht einfach strikte numerische Identität von grammatischem Subjekt und Prädikat. Zur Erkenntnis sind also immer zwei heterogene Stücke erfordert, die zu einer Einheit gebracht werden. Diesen Vorgang kann man Vermittlung nennen. Die Erkenntnis besteht somit in der Aufklärung des bestimmten Zusammenhangs der beiden Glieder. Eine Erkenntniskritik wäre die Explikation des Vorgangs der Vermittlung.
Mit dieser logisch-erkenntnistheoretischen Wende legt Kant den Grundstein für die Wende in der Frage nach dem Wahrheitsanspruch. Denn eine Substanzlogik, bei der alle Bestimmtheit im Substrat, der ousia, liegt, ist nun nicht mehr vertretbar. Es gibt kein alle Bestimmtheit in sich bergendes Objekt mehr, das an sich erkannt werden könnte, sondern nur mehr den Akt der Bestimmmung selbst, der erst das Objekt konstituiert. Im Kapitel "Momente der Antinomie" hatten wir kurz auf den wichtigen Zusammenhang zwischen Wahrheitsanspruch und Objekt-Begriff hingewiesen. Nun zeigt sich, dass die Genese des Objekts nicht unabhängig von einem Wahrheitsanspruch, der normalerweise in einem Urteil erhoben wird, begriffen werden kann. Die wahrheitsrelevante Entscheidung anhand von Kriterien ist nicht unabhängig vom Objekt zu verstehen, sie kann nicht als aus zwei, voneinander unabhängigen Ordnungen bestehend gedacht werden. Ein Wahrheitsanspruch entsteht erst in einem und durch einen Objekt-Begriff, genau so wie der Objekt-Begriff erst in und durch einen Wahrheitsanspruch zum Tragen kommt.
Mit dieser Überlegung ist auch der Grundstein dafür gelegt, dass nicht mehr der sinnlich wahrnehmbare Gegenstand, das Ding, sondern die Relationen, in denen das Objekt steht, an Interesse gewinnen. Als Folge davon muss das Substrat durch das Prädikat, dem alle Bestimmtheit zukommt, bestimmt werden. Das Prädikat ist bei Kant der Begriff und hat die logische Priorität. Hier geht Kant mit der modernen Logik, vor allem mit Gottlieb Frege, konform.
Der Akt der Bestimmung ist bei Kant das Urteil, in dessen Synthese dasjenige entsteht, was er Erfahrung nennt, als Ergebnis des Zusammenspiels von Anschauung und Begriff. Die Begriffe, die oben im Zitat angesprochen wurden, sind aber nun nicht empirisch, sondern transzendental, apriori. Die transzendentale Einheit in der Anschauung, die durch den Verstand überhaupt erst zustandegebracht wird, ist die genauer ausgedrückte Fassung dessen, was wir als Erfahrung benannt haben: Die Vorstellungsvermögen als in ihrem Zusammenspiel begriffen. Diese Einheit ist Grundlage aller Bestimmung überhaupt, was auch als Konstanz der Bezugnahme benannt werden könnte.
So viel vorerst zum Objektbegriff, nehmen wir nun die Frage nach dem Zusammenhang von Wahrheitskonzeption und Objektbegriff auf:
„Es sind nur zwei Fälle möglich, unter denen synthetische Vorstellung und ihre Gegenstände zusammentreffen, sich auf einander nothwendiger Weise beziehen und gleichsam einander begegnen können: entweder wenn der Gegenstand die Vorstellung, oder diese den Gegenstand allein möglich macht“[62],
so schreibt Kant im "Übergang zur transzendentalen Deduktion". Es scheint hier so, als ob Kant tatsächlich zwei Möglichkeiten des Bezugs von Vorstellungen auf Gegenstände zuließe. Insofern sich die Vorstellungen nach den Gegenständen richten, wie er hier schreibt, so scheint das die herkömmliche Kantinterpretation zu stützen, die Wahrheit auch bei Kant als eine Übereinstimmung von Vorstellung und Gegenstand unter dem Primat des Gegenstandes fasst.
[...]
[1] Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie. MEW, Band 13, p. 11. Marx selbst zitiert Dante, göttliche Komödie: „Hier mußt du allen Zweifelmut ertöten, hier ziemt sich keine Zagheit fürderhin.“
[2] E. Tugendhat, Die Geisteswissenschaften als Aufklärungswissenschaften. In: Philosophische Aufsätze, p. 453-463
[3] F.W.J.Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 17
[4] F.W.J.Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 17
[5] Urs Richli, Form und Inhalt in GWF Hegels Wissenschaft der Logik, cf p. 24; aber auch Hans Wagner, Philosophie und Reflexion, §1, p. 15, § 29
[6] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, §1, p. 9
[7] Etwa im Theaitetos, wo Platon im zweiten Teil (St. 187B-200C), in mehreren Anläufen diese Frage bespricht.
[8] Schelling spricht hier im Text von einer gegebenen Identität, die es aufzuklären gilt, die durch den Prozess dieses Aufklärens aufgehoben wird. Auf den vollen Sinn des Aufhebens kommen wir erst im Verlauf dieser Untersuchung, daher behelfe ich mir vorläufig mit dem Begriffspaar explizit/implizit.
[9] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, §2, p. 13
[10] Kant, Was ist Aufklärung VIII 35-42
[11] Kant, KdU B 158; vgl. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, VII 228
[12] Kant, KrV B 833
[13] U. Claesges, Geschichte des Selbstbewusstseins p.5
[14] GWF Hegel: " Dieser [der gesunde Menschenverstand Anm.d.Verf.] ist die Denkweise einer Zeit, in der alle Vorurteile dieser Zeit enthalten sind."
[15] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p 13.
[16] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 13
[17] cf. Urs Richli, Form und Inhalt in G.W. F. Wissenschaft der Logik
[18] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p . 15
[19] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 9 §1: „Alles Wissen beruht auf einer
Übereinstimmung eines Objektiven mit einem Subjektiven. Denn man weiß nur das Wahre; die Wahrheit aber wird allgemein in die Übereinstimmung der Vorstellungen mit ihren Gegenständen gesetzt.“
[20] Kant, Welches sind die wirklichen Fortschritte ...(1804) XX p. 274
[21] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 15
[22] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 15
[23] Vgl. Hierzu Kant, KrV, Vorrede zur zweiten Auflage, B XXVI „Einen Gegenstand erkennen, dazu wird erfordert, dass ich seine Möglichkeit (es sei nach dem Zeugniß der Erfahrung aus seiner Wirklichkeit, oder a priori durch Vernunft) beweisen könne. Aber denken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur nicht selbst widerspreche, d.i. wenn mein Begriff nur ein möglicher Gedanke ist, ob ich zwar dafür nicht stehen kann, ob im Inbegriffe aller Möglichkeiten diesem auch ein Object correspondire oder nicht. Um einem solchen Begriffe aber objective Gültigkeit (reale Möglichkeit, denn die erstere war bloß die logische) beizulegen, dazu wird etwas mehr erfordert. Dieses Mehrere aber braucht eben nicht in theoretischen Erkenntnißquellen gesucht werden, es kann auch in praktischen liegen.“ Heraushebungen vom Verf.
[24] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 17
[25] In der KrV B472: „Die Causalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen der Welt insgesammt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Causalität durch Freiheit zu Erklärung derselben anzunehmen nothwendig.“ und KrV B473: „Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.“
[26] KdU B314 f
[27] Michael Benedikt, Ist die „absolute Position“ als Erfahrung konkretisierbar? Vgl. aber auch: Michael Benedikt, Bestimmende und reflektierende Urteilskraft.
[28] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 9 §1: „Alles Wissen beruht auf einer Übereinstimmung eines Objektiven mit einem Subjektiven. Denn man weiß nur das Wahre; die Wahrheit aber wird allgemein in die Übereinstimmung der Vorstellungen mit ihren Gegenständen gesetzt.“
[29] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 17
[30] Cassirer, Substanz und Funktionsbegriff, p. 2
[31] Sowohl bei Kant als auch bei Hegel spielt die althergebrachte Wahrheitsdefinition eine wichtige Rolle.
Vgl dazu bei Kant in der KrVA 58 ff und bei Hegel in der Einleitung zur PhdG, p. 76f
[32] Der Zusammenhang zwischen Objektbegriff und Wahrheitskonzeption wird uns noch in späteren Kapiteln beschäftigen, vgl p. 46 im Kapitel "Kants Überlegungen zur Wahrheitsdefinition".
[33] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 278
[34] In diesem Zusammenhang muss immer auch an Hegels Fassung dieser prinzipiellen Reflexion eines jeden idealistischen Ansatzes einer Prinzipientheorie gedacht werden. Eine wichtige Stelle dazu ist die vorläufige Darstellung der Methode in der Einleitung zur Phänomenologie des Geistes, p. 75-79: Das Subjekt bezieht sich auf einen Gegenstand, indem es sich von diesem unterscheidet, indem es sich aber selbst thematisiert, auf sich selbst Bezug nimmt, ist es sowohl unterschiedenes als auch gleiches. Das Thematisierte wie das Thematisierende, das Aktive wie das Passive. Der Gegenstand und das Subjekt.
[35] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 9 §1
[36] Vgl Fußnote 32
[37] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 31
[38] Vgl Ingrid Bauer-Drevermann: Der Begriff der Zufälligkeit in der Kritik der Urteilskraft.
[39] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 32
[40] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 38
[41] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 34. Die Frage nach dem letzten Punkt der Einheit von Denken und Sein durchzieht die neuzeitliche Philosophie wie ein roter Faden. Vgl. hierzu E. Cassirers Descartes Buch, und die geforderte Einheit Gottes in der Differenz der Schöpfung von res extensa und res cogitans, als unaufgebaren Grundes der Ermöglichung von Erkenntnis und Freiheit: "Der Wille Gottes schwankt nicht zwischen verschiedenen Entscheidungen hin und her, sondern er schafft, in einem einzigen, unteilbaren und unveränderbaren Akt, die Welt der Wahrheit und die Welt der Wirklichkeit." E. Cassirer, Descartes, p. 64
[42] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 37
[43] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, §1, p. 9
[44] Platon, Parmenides, St. 156 d-e: „Wann also geht es über? Denn weder während der Ruhe noch während der Bewegung kann es übergehen noch in der Zeit seiend. — Freilich nicht. — Ist also etwa jenes Wunderbare das, worin es ist, wenn es übergeht? — Welches denn? — Der Augenblick. Denn das Augenblickliche scheint dergleichen etwas anzudeuten, daß von ihm aus etwas übergeht in eins von beiden. Denn aus der Ruhe geht nichts noch während des Ruhens über noch aus der Bewegung während des Bewegtseins; sondern dieses wunderbare Wesen, der Augenblick, liegt zwischen der Bewegung und der Ruhe als außer aller Zeit seiend, und in ihm und aus ihm geht das Bewegte über zur Ruhe und das Ruhende zur Bewegung.“
[45] Kant, Brief an Marcus Herz 1772
[46] Schelling, System des transzendentalen Idealismus, p. 13.
[47] Vgl. Kant, KdU § 76/77
[48] Stellvertretend für viele andere sei hier H. Putnam zitiert, der in seinem Buch "Für eine Erneuerung der Philosophie" p. 11 schreibt: "Wer meine Schriften aus dieser Periode kennt, fragt sich womöglich, wie es mir gelang, meinen Hang zur Religion mit meiner durchweg naturwissenschaftlichen und materialistischen Weltanschauung in Einklang zu bringen. Die Antwort lautet, daß ich sie überhaupt nicht miteinander in Einklang brachte. [...] Diese beiden Seiten meiner selbst hielt ich einfach getrennt."
[49] Kant, KrV, B83 „Die alte und berühmte Frage, womit man die Logiker in die Enge zu treiben vermeinte und sie dahin zu bringen suchte, daß sie sich entweder auf einer elenden Diallele mußten betreffen lassen, oder ihre Unwissenheit, mithin die Eitelkeit ihrer ganzen Kunst bekennen sollten, ist diese: Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie nämlich die Übereinstimmung der Erkenntniß mit ihrem Gegenstande sei, wird hier geschenkt und vorausgesetzt; man verlangt aber zu wissen, welches das allgemeine und sichere Kriterium der Wahrheit einer jeden Erkenntniß sei.“
[50] Kant, KrV, B83, Heraushebung vom Verfasser
[51] Martin Heidegger, Sein und Zeit, p. 215
[52] Kant, KrV B 105
[53] Für diesen verfehlten Ansatz: Michael Wolff, Kants Urteilstafel
[54] cf P. Schulthess, Funktion und Relation
[55] Kant, vgl. Negative Größen, aber ähnlich auch im Kapitel von der Amphibolie der Reflexionsbegriffe KrVB321:
„ Wenn Realität nur durch den reinen Verstand vorgestellt wird (realitas noumenon), so läßt sich zwischen den Realitäten kein Widerstreit denken, d.i. ein solches Verhältniß, da sie, in einem Subject verbunden, einander ihre Folgen aufheben, und 3-3=0 sei. Dagegen kann das Reale in der Erscheinung (realitas phaenomenon) unter einander allerdings im Widerstreit sein und, vereint in demselben Subject, eines die Folge des andern ganz oder zum Theil vernichten, wie zwei bewegende Kräfte in derselben geraden Linie, sofern sie einen Punkt in entgegengesetzter Richtung entweder ziehen oder drücken, oder auch ein Vergnügen, was dem Schmerze die Wage hält."
Ähnlich auch in der Anmerkung zur Amphibolie Reflexionsbegriffe KrV B329:
„Zweitens, der Grundsatz: daß Realitäten (als bloße Bejahungen) einander niemals logisch widerstreiten, ist ein ganz wahrer Satz von dem Verhältnisse der Begriffe, bedeutet aber weder in Ansehung der Natur, noch überall in Ansehung irgend eines Dinges an sich selbst (von diesem haben wir keinen Begriff) das mindeste. Denn der reale Widerstreit findet allerwärts statt, wo A-B =0 ist, d.i. wo eine Realität, mit der andern in einem Subject verbunden, eine die Wirkung der andern aufhebt, welches alle Hindernisse und Gegenwirkungen in der Natur unaufhörlich vor Augen legen, die gleichwohl, da sie auf Kräften beruhen, realitates phaenomena genannt werden müssen.“
[56] cf transzendentale Deduktion KrV A 92, wo diese Dichotomie als die Voraussetzung für Erkenntnis überhaupt bezeichnet wird.
[57] Kant, KrV B 93
[58] Kant, KdU, A LV
[59] Kant, KdU, A LV
[60] cf Kant, KrV, transzendentale Deduktion A, 3. „Von der Synthesis der Rekognition im Begriff“.
[61] Kant, einzig möglicher Beweisgrund zum Dasein Gottes, II 73
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Texts?
Der Text ist eine umfassende sprachliche Vorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Hauptthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit Kants und Schellings Philosophie, insbesondere die Antinomie zwischen Theorie und Praxis.
Was ist der Begriff der Transzendentalphilosophie nach Schelling?
Nach Schelling nähert sich die Philosophie der ursprünglichen Einheit von Subjekt und Objekt von der Seite des Subjekts als Transzendentalphilosophie. Sie thematisiert ausgehend vom Subjekt das Objektive (die Natur).
Welche Antinomie stellt Schelling in den Mittelpunkt?
Schelling formuliert die Frage: "Wie können die Vorstellungen zugleich als sich richtend nach den Gegenständen, und die Gegenstände zugleich als sich richtend nach den Vorstellungen gedacht werden?". Er sieht darin einen grundlegenden Widerspruch, der gelöst werden muss, wenn Philosophie möglich sein soll.
Wie versucht Schelling, die Antinomie aufzulösen?
Schelling versucht, die Antinomie im Begriff der Teleologie aufzulösen, indem er die Vereinbarkeit von Erkenntnis und Handeln über die Analyse der Begriffe Wahrheit und Wissen beantwortet. Er verschiebt die gesamte Problematik in das Selbstbewusstsein.
Warum wird Schellings Lösungsansatz kritisiert?
Schellings Lösungsansatz wird kritisiert, weil er seiner eigenen Analyse widerspricht, indem er ein absolutes Wissen fordert, das frei von Vermittlung sein soll. Zudem wird die Einführung einer intellektuellen Anschauung als problematisch angesehen, da sie den Rationalitätsbegriff verabschiedet.
Wie positioniert sich Kant zum Wahrheitsbegriff?
Kant setzt die formale Wahrheitsdefinition ("Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstande") voraus, hinterfragt aber die Bedingungen, unter denen synthetische Vorstellungen und ihre Gegenstände zusammentreffen können. Er betont die Rolle des Verstandes bei der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen in der Anschauung.
Welche Rolle spielt das Urteil bei Kant?
Das Urteil spielt bei Kant eine große Rolle in der Frage nach der Objektkonstitution. Es ist der Akt der Bestimmung, in dessen Synthese Erfahrung entsteht. Das Urteil vereint Begriff und Anschauung zu einer neuen Einheit.
Was ist der Unterschied zwischen Substanzmetaphysik und Funktionsmetaphysik?
Die Substanzmetaphysik setzt das Objekt außerhalb des Bewusstseins als vollständig Bestimmtes voraus, während die Funktionsmetaphysik Gegenstände selbst als unerkennbar betrachtet und nur ihre Wirkungen bestimmt. Die Funktionsmetaphysik betont die Relationen und Funktionen, die einen Gegenstand ausmachen.
Wie wird das Verhältnis von Theorie und Praxis im Text diskutiert?
Das Verhältnis von Theorie und Praxis wird als eine grundlegende Antinomie dargestellt, die sich aus dem Spannungsfeld zwischen dem Erkenntnisanspruch der Theorie und dem Handlungsanspruch der Praxis ergibt. Die Frage ist, wie das Bestimmende (Objekt) zugleich als zu Bestimmendes (durch Handeln veränderbar) gedacht werden kann.
Was bedeutet die These, dass aus Substanz Subjekt werden solle?
Mit der These, dass aus Substanz Subjekt werden solle, war unter anderem auch dieser Übergang von der Ding- zur Funktionsmetaphysik gemeint. Also ein Übergang weg von der Annahme, dass das Objekt unabhängig vom Subjekt existiert und hin zur Annahme, dass das Subjekt eine aktive Rolle bei der Konstitution des Objekts spielt.
- Quote paper
- Dr. Martin Mucha (Author), 2007, Sein. Wissen. Wahrheit., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122728