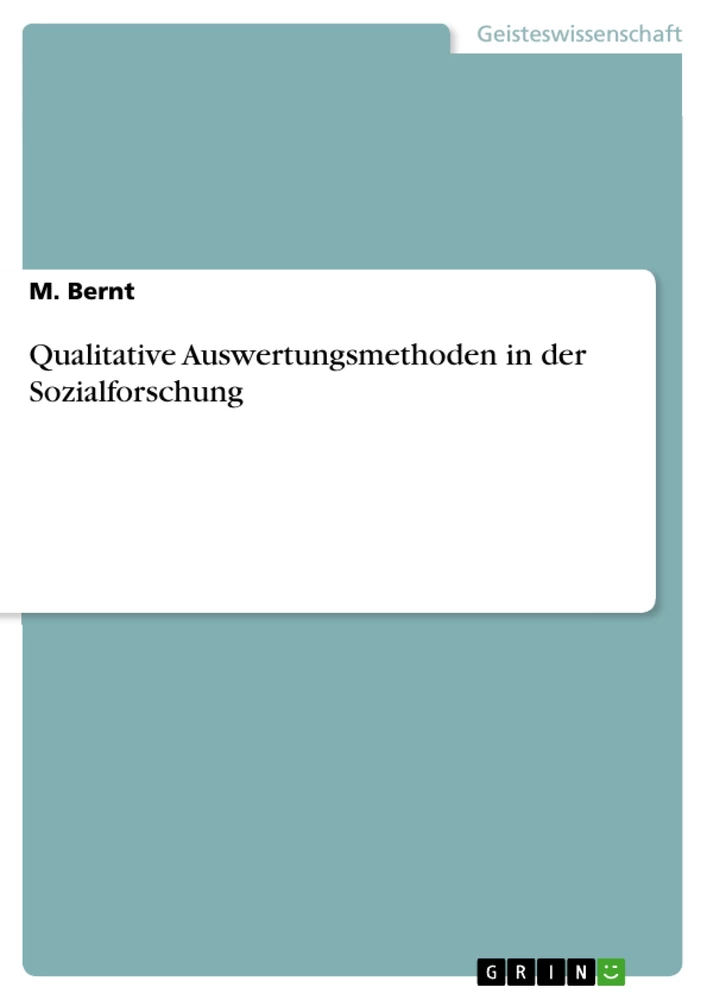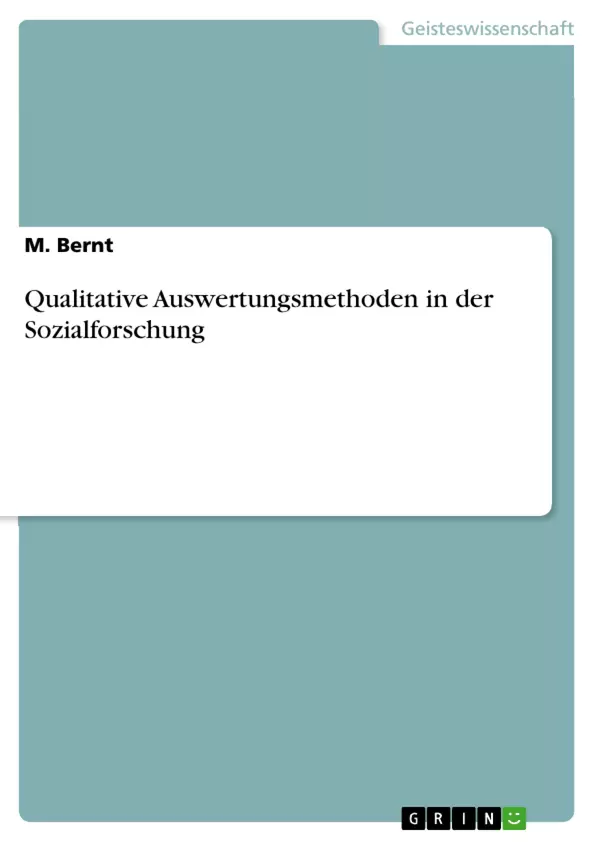Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit zwei qualitativen Auswertungsmethoden der Sozialforschung.
Die Narrationsanalyse nach Schütze und die Dokumentarische Methode nach Bohnsack werden in Form von Zusammenfassungen dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassende Methodendarstellung: Narrationsanalyse nach Schütze
- Zusammenfassende Methodendarstellung: Dokumentarische Methode nach Bohnsack
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Darstellung und Analyse von zwei qualitativen Auswertungsmethoden: der Narrationsanalyse nach Schütze und der Dokumentarischen Methode nach Bohnsack. Ziel ist es, die beiden Methoden in ihrer Anwendung und ihren spezifischen Eigenschaften zu erläutern und ihre Eignung für die soziologische Forschung zu beleuchten.
- Die spezifischen Charakteristika und Einsatzmöglichkeiten der Narrationsanalyse nach Schütze
- Die Grundprinzipien und Anwendung der Dokumentarischen Methode nach Bohnsack
- Die Relevanz beider Methoden für die qualitative Sozialforschung
- Die Stärken und Schwächen der beiden Ansätze im Vergleich
- Die Bedeutung der Methodenwahl für die Erforschung sozialer Phänomene
Zusammenfassung der Kapitel
- Zusammenfassende Methodendarstellung: Narrationsanalyse nach Schütze: Dieses Kapitel behandelt die Narrationsanalyse nach Schütze als Analyseverfahren, das spontane Erzählungen von Personen als Datengrundlage nutzt. Es werden die zentralen Elemente der Methode, wie das Narrative Interview und die theoretischen Grundlagen, umfassend beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse qualitativer Forschungsmethoden, insbesondere der Narrationsanalyse nach Schütze und der Dokumentarischen Methode nach Bohnsack. Zentrale Begriffe sind: qualitative Sozialforschung, Narrationsanalyse, Dokumentarische Methode, Interviewforschung, Lebensgeschichte, biographische Forschung, soziologische Interpretation, Erzähltheorie, Datenerhebung, Datenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Narrationsanalyse nach Schütze?
Die Narrationsanalyse ist ein qualitatives Verfahren, das spontane Erzählungen (z. B. in biographischen Interviews) nutzt, um soziale Phänomene und individuelle Lebensgeschichten soziologisch zu interpretieren.
Was charakterisiert die Dokumentarische Methode nach Bohnsack?
Die Dokumentarische Methode zielt darauf ab, das implizite Wissen und die Orientierungsrahmen von sozialen Gruppen zu rekonstruieren. Sie wird häufig zur Analyse von Gruppendiskussionen oder Bildern verwendet.
Warum sind diese Methoden für die Sozialforschung wichtig?
Qualitative Methoden erlauben ein tieferes Verständnis von Sinnzusammenhängen und sozialen Wirklichkeiten, die durch rein statistische (quantitative) Daten nicht erfasst werden können.
Was ist ein narratives Interview?
Es handelt sich um eine Erhebungsmethode, bei der der Befragte durch eine Erzählaufforderung dazu angeregt wird, seine Erlebnisse als zusammenhängende Geschichte darzustellen, ohne durch starre Fragen unterbrochen zu werden.
Was sind die Stärken der Narrationsanalyse?
Die Methode ist besonders stark in der biographischen Forschung, da sie aufzeigt, wie Individuen ihre Identität konstruieren und wie gesellschaftliche Ereignisse ihre Lebensverläufe prägen.
- Arbeit zitieren
- M. Bernt (Autor:in), 2021, Qualitative Auswertungsmethoden in der Sozialforschung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1227400