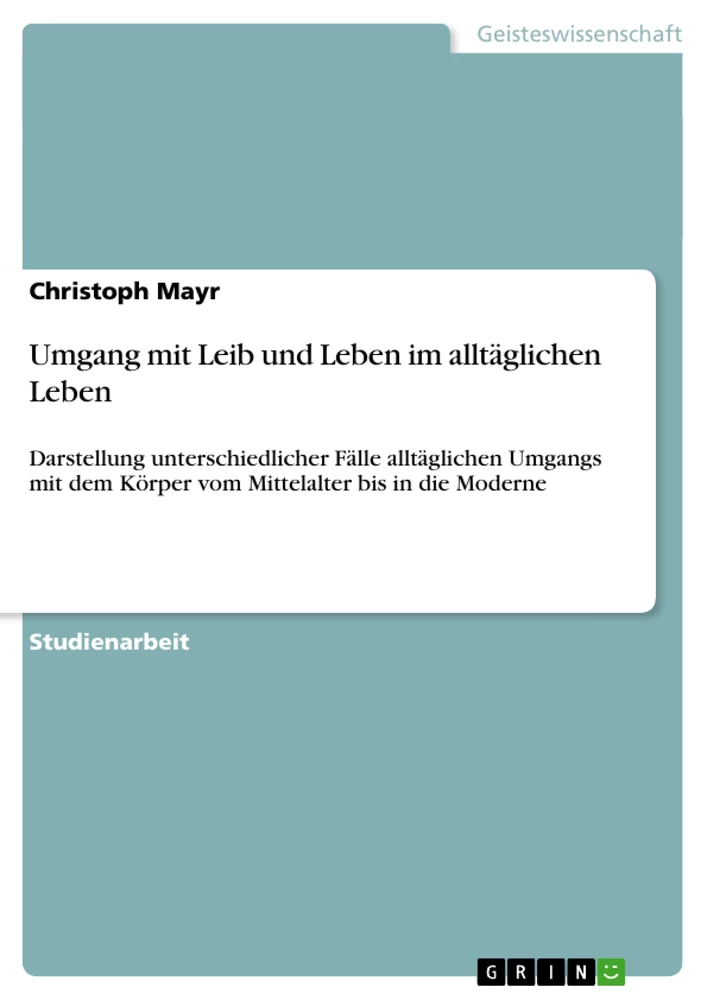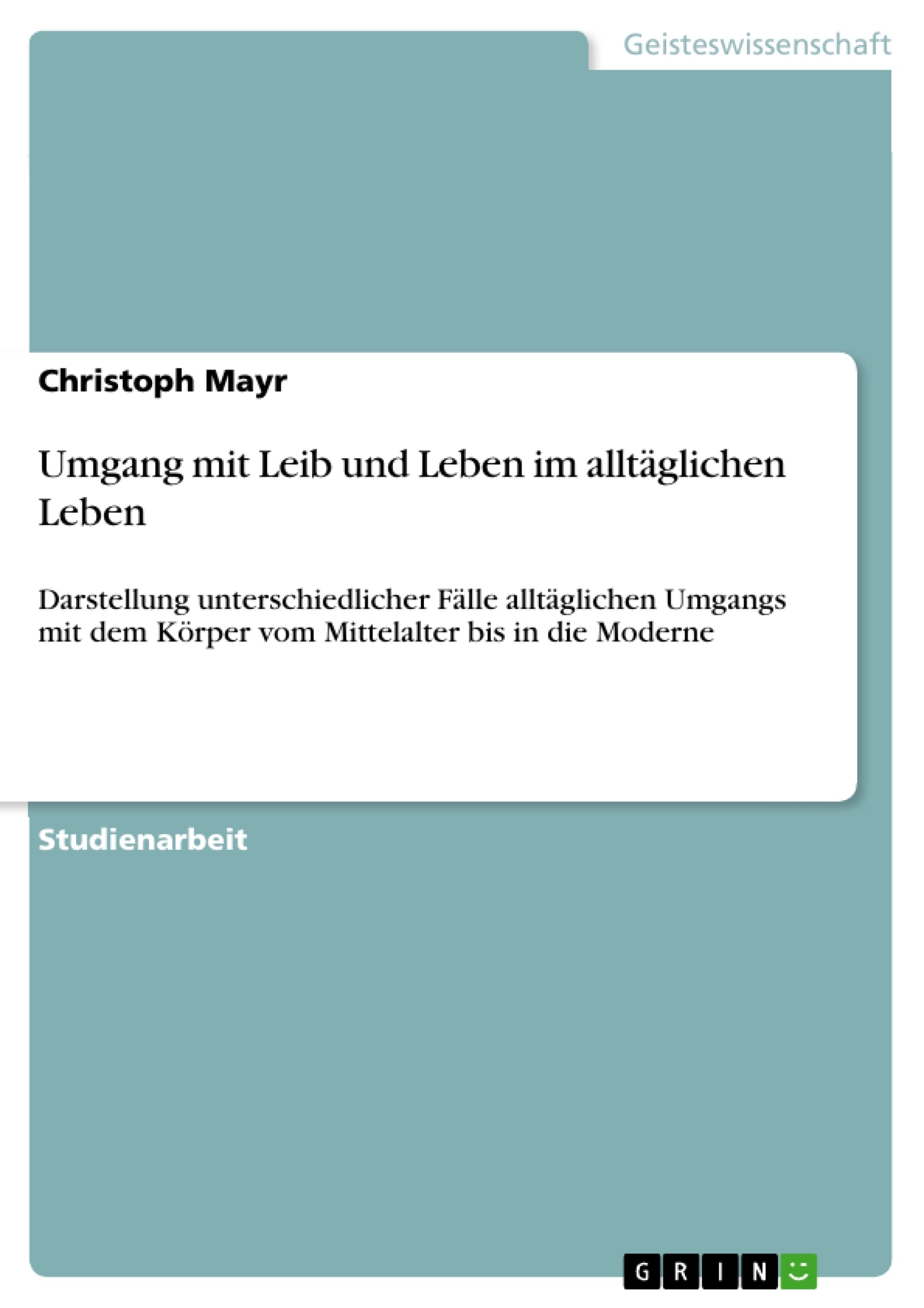Die Gebrüder Grimm schreiben dem Begriff Körper in ihrem Deutschen Wörterbuch in erster Linie die Bedeutung „Leichnam“ zu. Diese altertümliche Verwendung des Begriffs ist mittlerweile nicht mehr aktuell, trifft aber einen interessanten Punkt. Der Körper wird erst durch den Menschen, der in ihm steckt lebendig. In der nachfolgenden Arbeit soll erörtert werden, wie sich der – nicht immer frei gewählte – Umgang mit Körper und Leben in verschiedenen Epochen darstellt und was für Anforderungen bestehende Verhältnisse den Menschen aufzwingen. Oftmals scheint es in dieser, nur auf den Körper und nicht auf den ganzen Menschen bezogenen Darstellung, als wären die Betroffenen nur ein Spielball der Umstände; als wären sie eben nur leblose Körper, denen Zumutungen aufgezwungen werden, die ein moderner Geist nicht verkraften würde. Oft stecken jedoch mehr in Informationen zwischen den Zeilen, als die vorliegende Arbeit tatsächlich abhandeln kann. Diese sind für eine ganzheitliche Betrachtung durchaus förderlich; es lohnt sich, ab und zu die Frage nach der Befindlichkeit der Personen in den folgenden Episoden zu stellen, um eine Vorstellung der Tatsächlichen Um-stände zu bekommen.
Nähert sich man einer Darstellung, die über mehrere Jahrhunderte die Wahrnehmung des und den Umgang mit dem Körper abbilden soll, so stößt man schnell an Grenzen. Allgemeingülti-ge Aussagen über die Einstellung „der Gesellschaft“ zu „ihrem Körper“ gibt es nicht. Ebenso wenig kann von einem theoretischen Konzept ausgegangen werden, das gleichsam als Über-bau einen pauschalen Umgang oder eine universelle Wahrnehmung widerspiegelt. Nur wenn man die Makroebene verlässt, und sich Einzelheiten vornimmt bekommt man Einblick in ein-zelne Schicksale, in tatsächlich stattgefundene Begebenheiten, die es erlauben, sich dem Thema zu nähern. Aus diesem Grund sollen in dieser Arbeit einige Überlieferungen darge-stellt werden, um sich in dem überaus komplexen Themenkomplex zu orientieren. Durch eine knappe Analyse soll eine Darstellung erreicht werden, die es ermöglicht, Geschichten exem-plarisch zu betrachten um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Menschen in der jüngeren Geschichte – meist unfreiwillig – mit ihrem Körper (und dem von anderen) umge-hen. Über diesen Umgang lassen sich Rückschlüsse auf die Bedeutung und die Wahrnehmung des Körpers ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Überlegungen
- Phänomene aus dem Lebensalltag verschiedener Epochen
- Mittelalterliche Rechtsauffassung und -sprechung
- Der Dreißigjährige Krieg
- Säuglingssterblichkeit und Umgang mit Kindersterblichkeit im 19. Jahrhundert
- Das „Himmeln“
- Entwicklung ab dem 20. Jahrhundert
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang mit Körper und Leben in verschiedenen Epochen, ausgehend von der Feststellung, dass der Begriff „Körper“ historisch unterschiedlich interpretiert wurde. Sie analysiert, wie gesellschaftliche Verhältnisse den Umgang mit dem Körper beeinflusst haben und welche Anforderungen den Menschen auferlegt wurden.
- Der Wandel des Körperverständnisses über die Jahrhunderte
- Der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Ordnungen auf den Umgang mit dem Körper
- Die Rolle von Arbeit und körperlicher Belastung in verschiedenen Epochen
- Exemplarische Darstellung historischer Fälle des Umgangs mit Körper und Leben
- Die Abhängigkeit des Umgangs mit dem Körper von den jeweiligen Lebensumständen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Körperverständnisses und die Schwierigkeiten, allgemeingültige Aussagen über den Umgang mit dem Körper zu treffen. Kapitel 2 widmet sich theoretischen Überlegungen zum Verhältnis von „Haben“ und „Sein“ eines Körpers und dessen Rolle als Instrument der Wahrnehmung und Handlung. Die Kapitel 3.1 bis 3.5 präsentieren verschiedene historische Fälle, die den Umgang mit Körper und Leben in unterschiedlichen Epochen exemplarisch verdeutlichen, beginnend mit dem Mittelalter und reichend bis ins 20. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der gesellschaftlichen Einflüsse und der eingeschränkten Handlungsfreiheit der Individuen in Bezug auf ihren Körper.
Schlüsselwörter
Körper, Körperverständnis, Lebensalltag, Geschichte, Mittelalter, Dreißigjähriger Krieg, Säuglingssterblichkeit, Gesellschaftliche Normen, Körperliche Arbeit, Historische Fälle, Subjektive Wahrnehmung.
- Arbeit zitieren
- Christoph Mayr (Autor:in), 2008, Umgang mit Leib und Leben im alltäglichen Leben, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122757