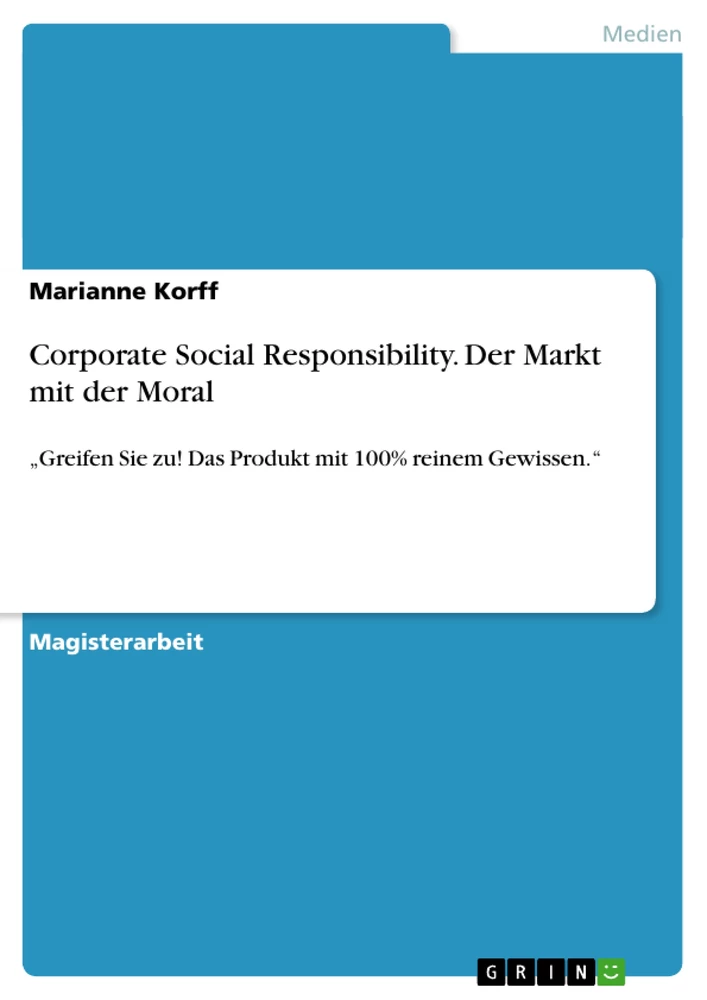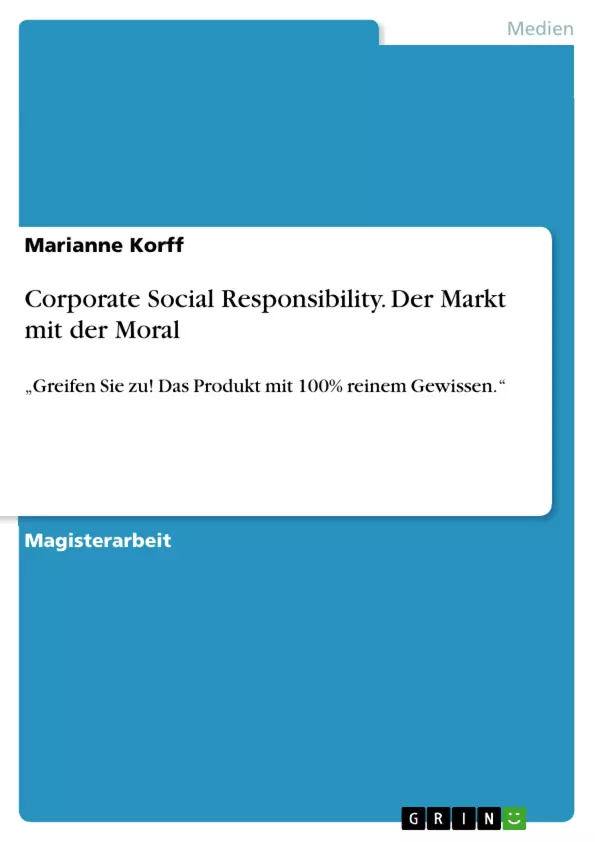Blickt man heute in Magazine, Zeitschriften, Fernsehbeiträge und Verkaufsregale entsteht der Eindruck, dass Moral und soziale Verantwortung eine immer wichtigere Rolle in der Konsumwelt – und damit auch im Alltag der Menschen – spielen. Produkt- und Imagewerbung von Unternehmen appellieren an unser gutes Gewissen. Gleichzeitig werden in den Medien die Verhaltensweisen der Unternehmen auf Moral, soziales Engagement (Corporate Social Responsibility) sowie nachhaltiges Management diskutiert und kritisch unter die Lupe genommen.
Ein Blick in die Regale der Kaufhäuser unterstreicht den Stellenwert von sozialem Engagement (CSR): Immer mehr Produkte werden zum Beispiel zusätzlich in der biologischen, aber auch teureren Variante angeboten, die in der Regel automatisch positive Assoziationen wie unter anderem ökologisch wertvoll, moralisch wertvoll‚ nachhaltig und natürlich hervorrufen . Auch ohne den Zusatz ‚Bio’ können Produkte mit einem moralischem Mehrwert versehen werden: Ein Bier trinken und zeitgleich den Regenwald retten, (teureres) Mineralwasser kaufen und dadurch eine Brunnen in Afrika bauen – soziale Verantwortung findet heute schon beim Einkaufen statt und schmeichelt dem Gewissen.
Scheinbar sollen die Kaufentscheidungen der Konsumenten durch Berufung auf das moralische Gewissen beeinflusst und im besten Fall entschieden werden. Zugleich kommunizieren Unternehmen verstärkt ihr soziales und moralisches Engagement mithilfe von jährlichen CSR-Berichten oder durch die Mittel der Öffentlichkeitsarbeit (vgl. Hansen/Schrader: 2005: 374). Mit CSR tritt die unternehmerische soziale Verantwortung auf dem Markt in Erscheinung.
Vor diesem Hintergrund wird das oberste Ziel der vorliegenden Arbeit formuliert. Dieses besteht in der Klärung folgender Frage: Inwieweit sind die CSR Maßnahmen der Unternehmen ein Indiz für eine Moralisierung der Märkte?
Durch die Zusammenführung der Komponenten Markt, CSR, Konsument, Produkt und moralische Unternehmen sollen Erkenntnisse gewonnen werden, inwiefern CSR ein Indiz für die Existenz von Moral in den Märkten ist. Abschließend wird diskutiert, warum CSR in den heutigen Märkten existiert. Es wird angenommen, dass dies im Zusammenhang mit der Moralisierung der Märkte steht. Steuert die Moral das Verhalten der Marktteilnehmer? Die Ausführungen Stehrs zur Moralisierung der Märkte bieten einen aktuellen Blickwinkel zu dieser Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Inhaltliche Vorgehensweise
- 2. Konsumentwicklung und die soziale Verantwortung der Unternehmen
- 2.1 Die 1950er Jahre
- 2.2 Die 1960er Jahre
- 2.3 Die 1970er Jahre
- 2.4 Die 1980er Jahre
- 2.5 Die 1990er Jahre
- 2.6 Das 21. Jahrhundert
- 3. Der Markt
- 3.1 Das primäre Ziel der Märkte
- 3.2 Vom Marktplatz bis zum Internet
- 3.3 Veränderung in den Marktgegebenheiten
- 4. Corporate Social Responsibility
- 4.1 CSR in der Praxis
- 4.2 Die Kommunikation von CSR
- 5. Der Konsument
- 5.1 Der Konsument und die Gesellschaft
- 5.2 Einflussfaktoren auf die Kaufentscheidungen
- 5.2.1 Motive und Bedürfnisse der Konsumenten
- 5.2.2 Einstellung der Konsumenten
- 5.2.3 Kaufrisiken
- 5.2.4 Moral als „Entscheidungshilfe“
- 5.3 Moralischer Konsum
- 6. Beweggründe für soziales Engagement
- 6.1 Mögliche „weiche“ Motive
- 6.1.1 Begriffsbestimmung Moral und Ethik
- 6.1.1.1 Der Zusammenhang von Ethik und Moral
- 6.1.1.2 Moralische Kommunikation
- 6.1.1.3 Moralisches Handeln
- 6.1.1.4 Moral im Zeitalter der Massenmedien
- 6.1.2 Verantwortung
- 6.1.2.1 Das klassische Modell der Verantwortung
- 6.1.2.2 Das moderne Modell der Verantwortung
- 6.1.2.3 Gesinnungs- und Verantwortungsethik
- 6.1.2.4 Ethische Verantwortlichkeit bei Kant – der gute Wille zählt
- 6.2 Mögliche „harte“ Motive
- 7. Das Unternehmen als moralische Person
- 7.1 Nokia - ein (un-)moralisches Unternehmen?
- 7.1.1 CSR Inhalte Nokia
- 7.1.2 Die Schließung des Werkes in Bochum
- 7.1.3 Die Reaktionen
- 7.1.4 Und die Moral von der Geschicht'
- 8. Die Theorie zur Moralisierung der Märkte von Nico Stehr
- 8.1 Der Begriff der Moralisierung der Märkte
- 8.2 Der Kunde als Motor des Moralisierungsprozesses
- 9. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Einfluss von Corporate Social Responsibility (CSR) auf Konsumentenverhalten und Marktmechanismen. Sie analysiert die Entwicklung des Konsumentenbewusstseins im Hinblick auf soziale und ethische Aspekte im wirtschaftlichen Kontext.
- Entwicklung des Konsumentenbewusstseins im 20. und 21. Jahrhundert
- Der Einfluss moralischer Überlegungen auf Kaufentscheidungen
- Der Zusammenhang zwischen CSR und Unternehmensstrategie
- Die Rolle der Kommunikation bei der Vermittlung von CSR-Aktivitäten
- Theoretische Modelle der Moralisierung von Märkten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und definiert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 beschreibt die Entwicklung des Konsumentenverhaltens über die Jahrzehnte hinweg und die wachsende Bedeutung der sozialen Verantwortung von Unternehmen. Kapitel 3 beleuchtet den Markt und seine Veränderungen. Kapitel 4 definiert Corporate Social Responsibility und seine praktische Umsetzung. Kapitel 5 fokussiert den Konsumenten und seine Entscheidungsfindungsprozesse. Kapitel 6 analysiert die Beweggründe für soziales Engagement, sowohl „weiche“ als auch „harte“ Motive. Kapitel 7 beleuchtet am Beispiel Nokia die Herausforderungen der ethischen Unternehmensführung.
Schlüsselwörter
Corporate Social Responsibility (CSR), Konsumentenverhalten, Moral, Ethik, Markt, Unternehmensethik, Kaufentscheidung, soziale Verantwortung, Moralisierung der Märkte, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Corporate Social Responsibility (CSR)?
CSR ist die unternehmerische soziale Verantwortung, die heute oft als „Markt mit der Moral“ in Erscheinung tritt.
Sind CSR-Maßnahmen ein Indiz für die Moralisierung der Märkte?
Die Arbeit geht der Frage nach, inwieweit moralische Aspekte tatsächlich das Verhalten von Marktteilnehmern steuern oder nur Marketingzwecken dienen.
Wie hat sich das Konsumentenbewusstsein seit den 1950ern entwickelt?
Die Arbeit zeichnet die Entwicklung von der reinen Bedarfsdeckung hin zu einem moralisch motivierten Konsum im 21. Jahrhundert nach.
Was sind „harte“ und „weiche“ Motive für soziales Engagement?
„Harte“ Motive sind ökonomische Vorteile, während „weiche“ Motive ethische Überzeugungen und moralische Verantwortung umfassen.
Welches Unternehmen dient als Beispiel für ethische Herausforderungen?
Nokia wird als Fallbeispiel (Werksschließung Bochum) für die Diskussion um die Moralität von Unternehmen herangezogen.
- Quote paper
- Magistra Artium Marianne Korff (Author), 2008, Corporate Social Responsibility. Der Markt mit der Moral, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122793