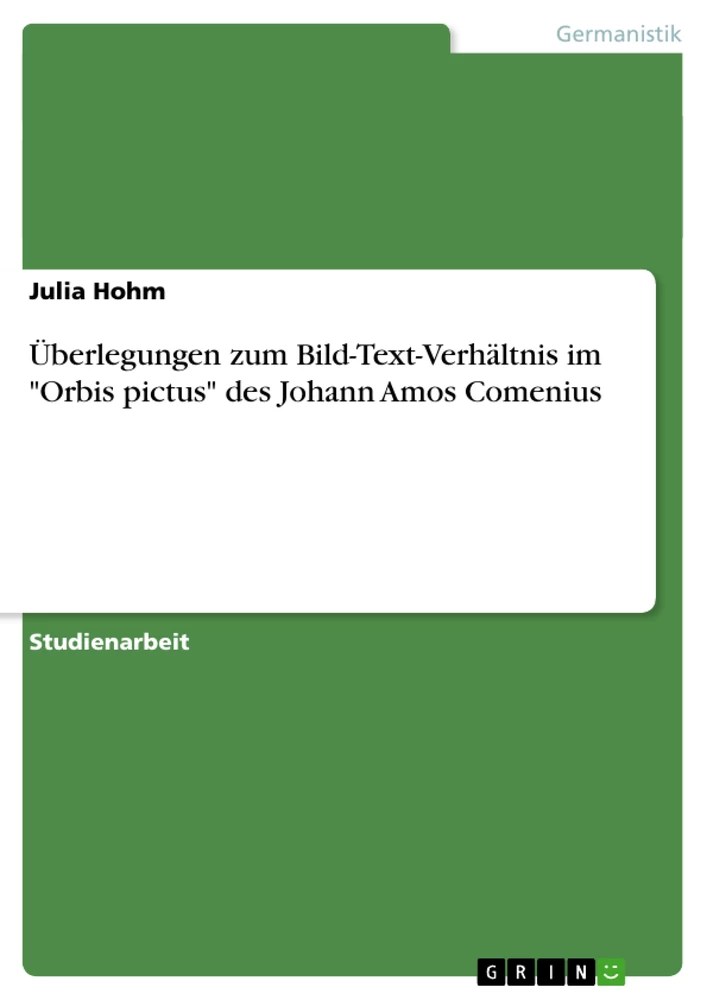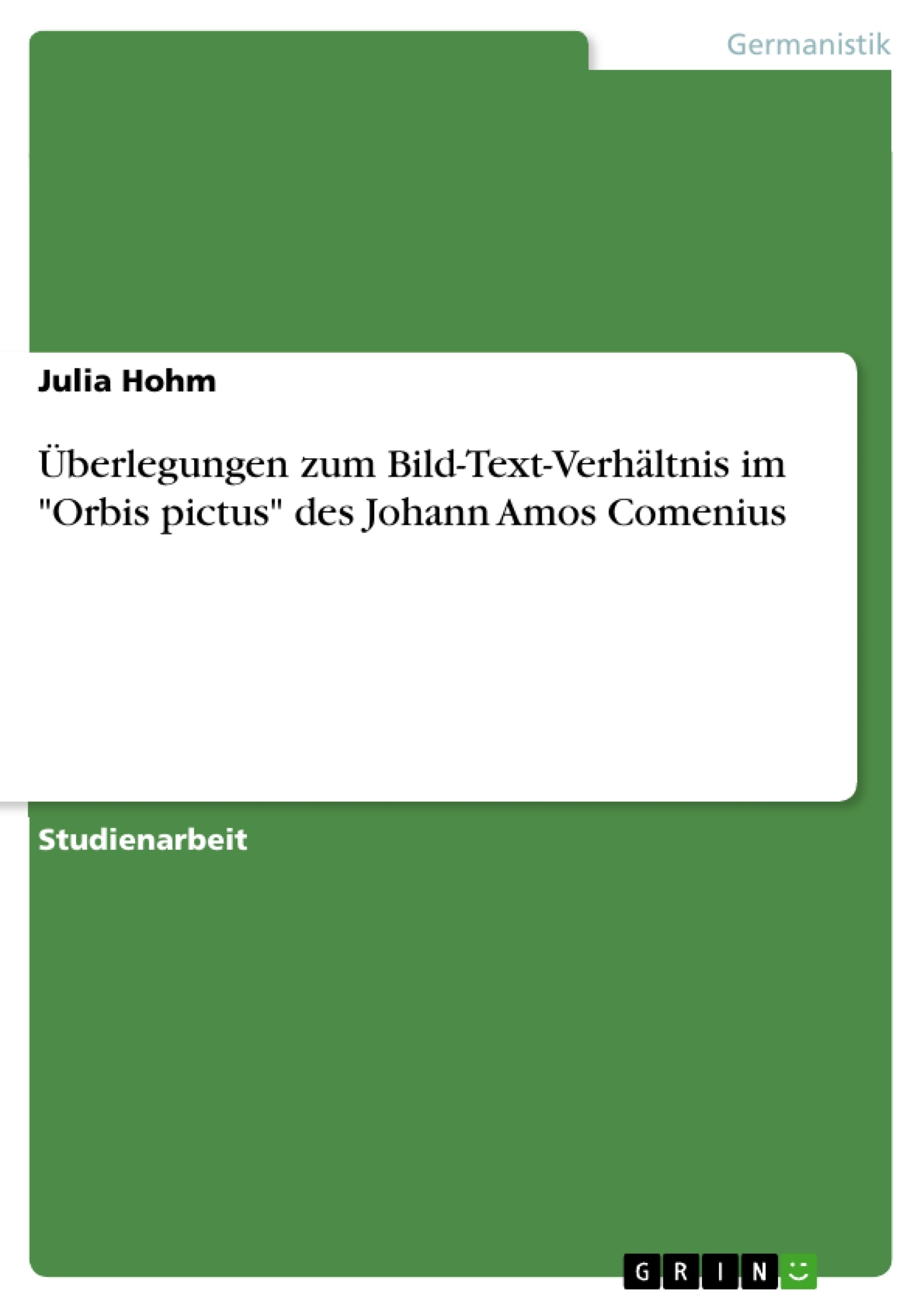In dieser Arbeit soll zum besseren Verständnis zunächst einmal kurz auf das Bild des Kindes bei Comenius eingegangen werden, worauf ein wiederum knapper Überblick über den Gesamtaufbau sowie die Gestaltung der Einzelkapitel im „Orbis pictus“ folgt. Anschließend soll dann der Frage nachgegangen werden, wie Comenius durch seine Bilder, die im Wechselspiel mit den zugehörigen Texten wirken, bei den Kindern einen Begriff von der ganzen göttlichen Weltordnung zu erzeugen vermag. Dazu ist zunächst zu klären, welcher Bildtradition er dabei folgt bzw. von welcher er sich abzusetzen versucht. Die Illustrationen, mit denen Comenius den Kindern die Gegenstände des naturwissenschaftlich-technischen Bereiches vor Augen führt, stehen zunächst im Zentrum der Untersuchung, woraufhin auch näher beleuchtet werden soll, auf welche Weise er sogar Abstrakta im Bild sichtbar und so den Kindern zugänglich macht. In einer kurzen Schlussbetrachtung wird zuletzt noch der Anschauungsbegriff des Comenius mit dem aus unserer Zeit verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführende Worte
- 2. Comenius' Bild vom Kind
- 3. Der Aufbau des „Orbis pictus“
- 4. Die Bilder im „Orbis pictus“
- 4.1. Abkehr von der Mnemonik
- 4.2. Die Bilder zum naturkundlich-technischen Bereich
- 4.3. Die Darstellung des Unsichtbaren im Bild
- 5. Schlussbemerkung: Das Anschauungsbild gestern und heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Bild-Text-Verhältnis in Johann Amos Comenius' „Orbis pictus“ (1658). Die Zielsetzung besteht darin, die didaktischen und weltanschaulichen Konzepte des Werkes zu analysieren und deren Bedeutung im Kontext der damaligen Zeit zu beleuchten. Dabei wird der Fokus auf die Interaktion zwischen Bildern und Texten gelegt und die Frage untersucht, wie Comenius mittels dieser Kombination einen umfassenden Weltbegriff bei Kindern vermitteln wollte.
- Comenius' pädagogisches Konzept und sein Bild vom Kind
- Der Aufbau und die Struktur des „Orbis pictus“
- Die Rolle der Bilder in der Wissensvermittlung
- Die Darstellung von Naturwissenschaften und Technik
- Der Vergleich des Anschauungsbegriffs bei Comenius mit dem der Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführende Worte: Die Einleitung stellt Comenius' „Orbis pictus“ vor, ein Lehrwerk, das sowohl das Lesenlernen als auch den Erwerb der lateinischen Sprache fördern sollte. Sie hebt die Bedeutung des Werkes im Kontext der aufkommenden empirischen Forschung und der Verschiebung von Latein hin zur Muttersprache hervor. Die Arbeit kündigt die Analyse von Comenius' Bild vom Kind, den Aufbau des „Orbis pictus“, die Rolle der Bilder in der Wissensvermittlung und den Vergleich des Anschauungsbegriffs mit dem der Moderne an.
2. Comenius' Bild vom Kind: Dieses Kapitel beleuchtet Comenius' pädagogisches Verständnis vom Kind als Gotteskind mit einer direkten Beziehung zu Gott. Die Kindheit wird als eine ernstzunehmende Lebensphase dargestellt, in der bereits mit der Bildung begonnen werden sollte. Comenius' positive Sicht auf die kindliche Naivität und die Annahme, dass früh Gelerntes besser im Gedächtnis bleibt, rechtfertigen die Entwicklung kindgerechter Lehrbücher, wie den „Orbis pictus“, der auch für Vorschulkinder geeignet ist. Die Bildung sollte nach Comenius nicht mit Zwang erfolgen, sondern leicht und angenehm sein.
3. Der Aufbau des „Orbis pictus“: Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau des „Orbis pictus“ als ein aus 150 Kapiteln bestehendes, bebildertes Kompendium der Welt, beginnend mit Gott und endend mit dem jüngsten Gericht. Die einzelnen Kapitel, mit Ausnahme des Kapitels über das Christentum, nehmen jeweils eine Doppelseite ein. Auf der linken Seite findet sich eine Überschrift (lateinisch und deutsch) und ein Holzschnitt mit nummerierten Einzelheiten. Der Aufbau spiegelt Comenius' pansophisches Weltbild wider.
Schlüsselwörter
Johann Amos Comenius, Orbis pictus, Bild-Text-Verhältnis, Pädagogik, Didaktik, Anschauung, Empirismus, Kinderliteratur, Weltanschauung, Muttersprache, Latein.
Häufig gestellte Fragen zum "Orbis Pictus" von Comenius
Was ist der "Orbis Pictus" und was ist das Thema dieser Arbeit?
Der "Orbis Pictus" (1658) von Johann Amos Comenius ist ein bebildertes Lehrbuch, das sowohl das Lesenlernen als auch den Erwerb der lateinischen Sprache fördern sollte. Diese Arbeit analysiert das Bild-Text-Verhältnis in diesem Werk, untersucht die didaktischen und weltanschaulichen Konzepte und beleuchtet deren Bedeutung im historischen Kontext. Der Fokus liegt auf der Interaktion zwischen Bildern und Texten und wie Comenius damit einen umfassenden Weltbegriff bei Kindern vermitteln wollte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 bietet eine Einführung in den "Orbis Pictus" und die Forschungsfrage. Kapitel 2 beleuchtet Comenius' pädagogisches Konzept und sein Bild vom Kind. Kapitel 3 beschreibt den Aufbau und die Struktur des Buches. Kapitel 4 analysiert die Bilder im Detail, insbesondere die Abkehr von der Mnemonik, die naturkundlich-technischen Abbildungen und die Darstellung des Unsichtbaren. Kapitel 5 bietet eine Schlussbemerkung zum Vergleich des Anschauungsbegriffs bei Comenius mit dem der Moderne.
Wie beschreibt die Arbeit Comenius' pädagogisches Konzept und sein Bild vom Kind?
Comenius sieht das Kind als Gotteskind mit direkter Beziehung zu Gott. Die Kindheit ist eine ernstzunehmende Lebensphase, in der früh mit der Bildung begonnen werden sollte. Seine positive Sicht auf kindliche Naivität und die Annahme, dass früh Gelerntes besser behalten wird, rechtfertigt kindgerechte Lehrbücher wie den "Orbis Pictus". Bildung soll nicht mit Zwang, sondern leicht und angenehm erfolgen.
Wie ist der "Orbis Pictus" aufgebaut und was ist seine Struktur?
Der "Orbis Pictus" besteht aus 150 bebilderten Kapiteln, beginnend mit Gott und endend mit dem Jüngsten Gericht. Jedes Kapitel (außer dem über das Christentum) nimmt eine Doppelseite ein, mit Überschrift (lateinisch und deutsch) und einem Holzschnitt mit nummerierten Einzelheiten auf der linken Seite. Der Aufbau spiegelt Comenius' pansophisches Weltbild wider.
Welche Rolle spielen die Bilder im "Orbis Pictus" und was wird in Kapitel 4 genauer untersucht?
Die Bilder spielen eine zentrale Rolle in der Wissensvermittlung. Kapitel 4 untersucht die Abkehr von der Mnemonik, die Darstellung von Naturwissenschaften und Technik in den Bildern und wie das Unsichtbare (z.B. Gott) bildlich dargestellt wird.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Johann Amos Comenius, Orbis pictus, Bild-Text-Verhältnis, Pädagogik, Didaktik, Anschauung, Empirismus, Kinderliteratur, Weltanschauung, Muttersprache, Latein.
Welchen Vergleich zieht die Arbeit im letzten Kapitel?
Das letzte Kapitel vergleicht den Anschauungsbegriff bei Comenius mit dem der Moderne, um die historische Bedeutung und Relevanz seines pädagogischen Ansatzes zu beleuchten.
- Quote paper
- Julia Hohm (Author), 2008, Überlegungen zum Bild-Text-Verhältnis im "Orbis pictus" des Johann Amos Comenius, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122803