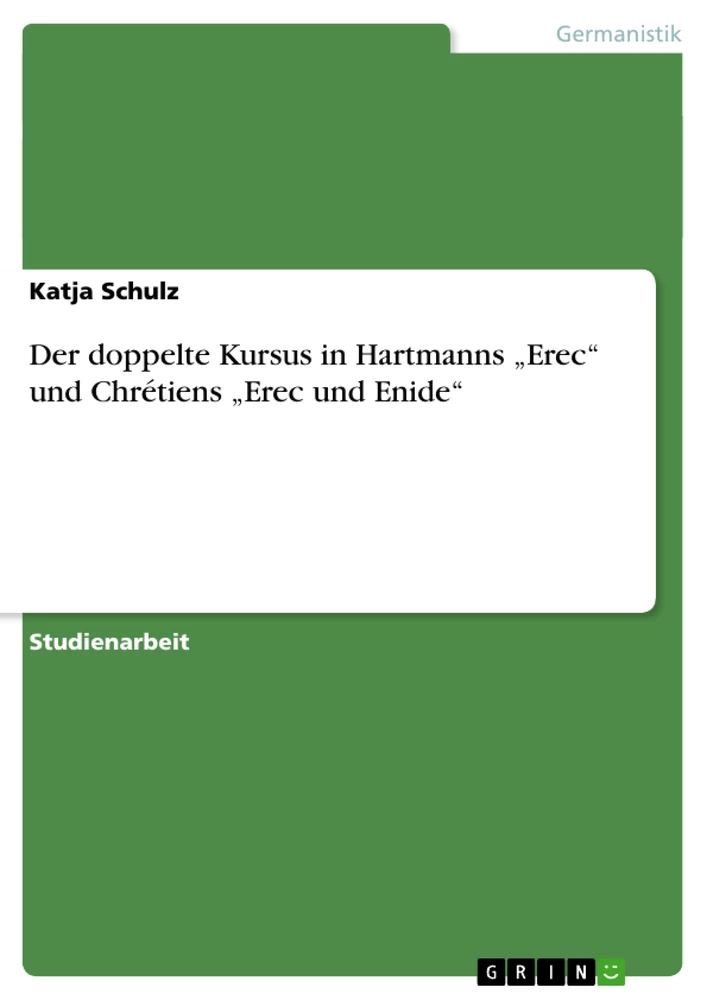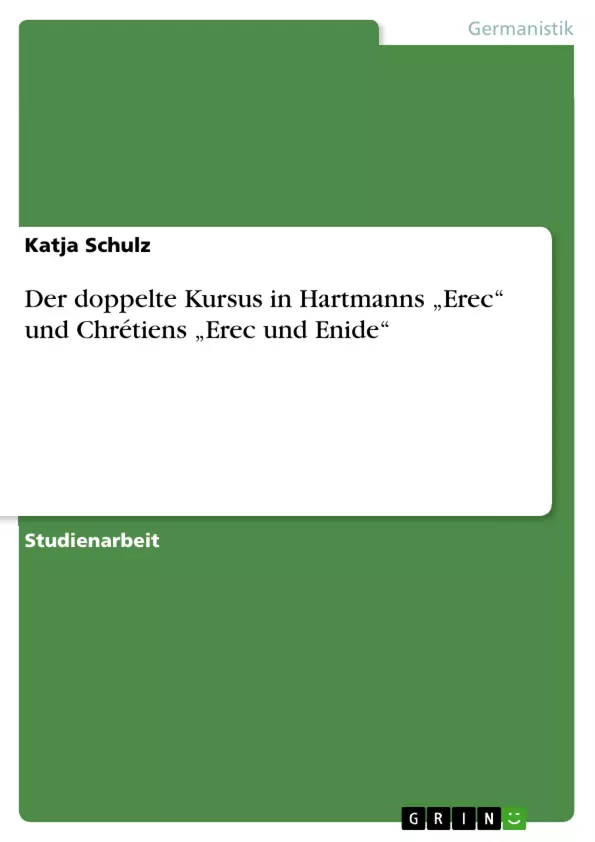Hartmann von Aue begründete mit seiner Übertragung von Chrétiens de Troyes „Erec et Enide“ den höfischen und Artusroman in deutscher Sprache. Das Werk steht allerdings nicht wirklich überzeugend vor uns und der Leser gewinnt das Gefühl, das das Ganze nur höchst subtil zusammengesetzt ist. In diesem Sinne hat schon im Jahre 1887 Roetteken die Geschichte des Erec als einen „bunten Haufen von Abenteuern“ bezeichnet. Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass der Text keine eindeutigen Signale liefert, die eine Großgliederung erlauben würden. Im Ambreser Heldenbuch sind auch keine Großinitialen vorhanden, von denen auf eine Abgrenzung der verschiedenen Handlungsblöcke geschlossen werden könnte. Daher waren die Bauprinzipien des Artusromans in den letzten Jahrzehnten Gegenstand lebhafter Forschung. In der folgenden Arbeit wird der doppelte Kursus genauer erläutert. Im Anschluss werden die Probleme erörtert, die sich unmittelbar aus einer genaueren Betrachtung der Theorie ergeben. Danach wird Chrétiens „Erec et Enide“ im Hinblick auf Gliederungsmöglichkeiten untersucht und das Ergebnis mit dem doppelten Kursus von Hartmanns Erec verglichen. Die Fragestellung wird also sein: Falls Hartmann den doppelten Kursus von Chrétien übernommen hat, hat er ihn genauso übernommen oder hat er den Aufbau geändert und wenn ja, warum? Welche Aspekte erschienen ihm wichtiger und welche wollte er in seiner Bedeutung reduzieren? Diese Fragen werden im letzten Abschnitt bearbeitet.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Bauform des „Erec“
- 2.1. Allgemeiner Aufbau des Erec
- 2.2. Der doppelte Kursus
- 2.2.1. Überblick
- 2.2.2. Zusammenhang des Ganzen
- 2.2.3. Deutung der Form
- 3. Probleme des „doppelten Kursus“
- 4. Chrétiens „Erec et Enide“
- 4.1. Der Aufbau
- 4.1.2. Gliederung nach den Hinweisen Chrétiens
- 4.1.3. Der doppelte Kursus bei Chrétien
- 4.2. Vergleich des doppelten Kursus bei Chrétien und Hartmann
- 4.3. Versuch einer Erklärung des Unterschiedes
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Struktur von Hartmanns „Erec“ im Vergleich zu Chrétiens „Erec et Enide“, insbesondere im Hinblick auf das Konzept des „doppelten Kursus“. Die Zielsetzung besteht darin, die Anwendung und mögliche Modifikationen dieser Struktur bei Hartmann zu analysieren und die Gründe für eventuelle Abweichungen zu ergründen.
- Der doppelte Kursus als strukturelles Prinzip in Hartmanns „Erec“
- Vergleich des doppelten Kursus in Hartmanns und Chrétiens Versionen
- Analyse der epischen Ordnung und Motivdoppelung in Teil II von Hartmanns „Erec“
- Untersuchung der Unterschiede in der Gewichtung von Handlungselementen bei Hartmann und Chrétien
- Erklärung möglicher Veränderungen des Aufbaus durch Hartmann
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Hartmanns „Erec“ als höfischen Artusroman vor und thematisiert die Herausforderungen bei der Strukturierung des Werkes aufgrund des Fehlens eindeutiger Gliederungssignale. Kapitel 2 erläutert den „doppelten Kursus“ als grundlegendes Bauprinzip, bestehend aus zwei Abenteuerreihen, die durch Szenen am Artushof getrennt sind. Kapitel 2.1 beschreibt den allgemeinen Aufbau von Hartmanns Erec, während Kapitel 2.2 den doppelten Kursus im Detail analysiert und in Teil I (Erecs und Enites Geschichte bis zur Hochzeit) und Teil II (die spätere Abenteuerfahrt) gliedert. Kapitel 3 befasst sich mit den Problemen, die sich aus einer detaillierten Betrachtung des doppelten Kursus ergeben. Kapitel 4 untersucht die Struktur von Chrétiens „Erec et Enide“ im Hinblick auf mögliche Parallelen und Unterschiede zum doppelten Kursus bei Hartmann.
Schlüsselwörter
Hartmann von Aue, Chrétien de Troyes, Erec, Erec et Enide, Artusroman, doppelter Kursus, höfischer Roman, epische Struktur, Motivdoppelung, Inhaltsanalyse, ritterliche Tugenden, Abenteuerliteratur.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Kauffrau Katja Schulz (Autor:in), 2007, Der doppelte Kursus in Hartmanns „Erec“ und Chrétiens „Erec und Enide“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122891