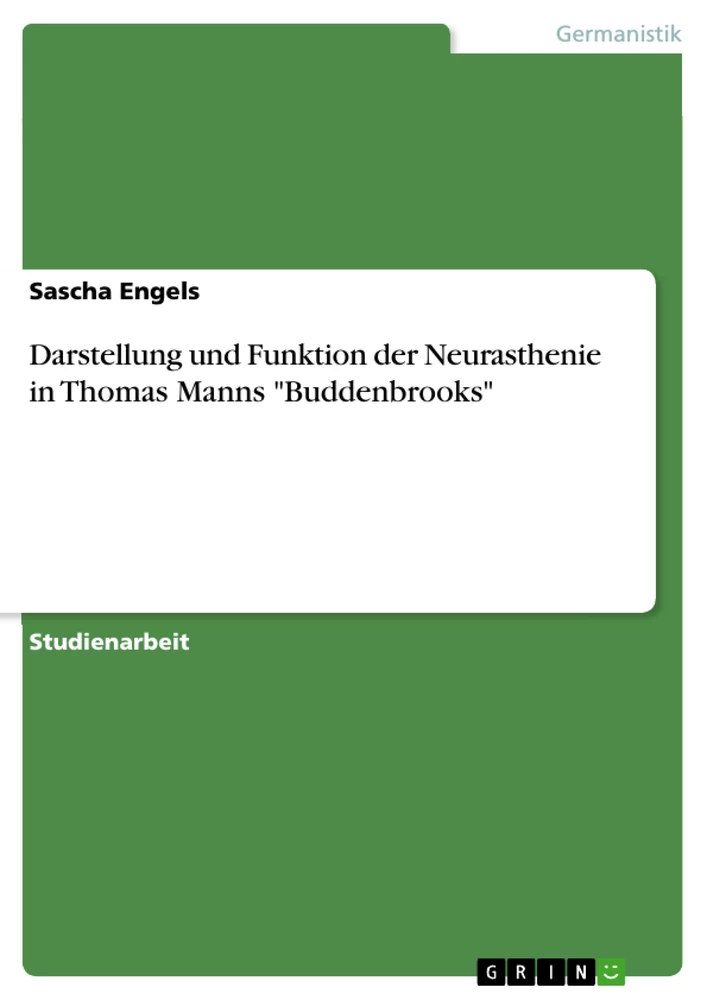Thomas Manns Roman „Die Buddenbrooks. Der Verfall einer Familie.“ zählt zu den größten
Werken der deutschen Literaturgeschichte. Kaum ein anderes schriftstellerisches Werk
bestimmt den Kanon der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts so nachdrücklich wie das
epochale Werk Thomas Manns, das in einzigartiger Weise die Geschichte des vorletzten
Jahrhunderts reflektiert und prägte.
Im Folgenden soll gezeigt werden, dass es sich bei diesem Roman nicht nur um eine
Familiengeschichte handelt, die die Topographie Lübecks und die Sozialhistorie der
Jahrhundertwende(19. Jh. zum 20. Jh.) aufgreift, sondern unter Einbeziehung einer so
genannten Zivilisationskrankheit den Zeitgeist und die Empfindungen der Menschen des Fin-de-Siécle widerspiegelt. Diese Krankheit, die sich als Phänomen von der letzten Hälfte des
19. Jahrhunderts bis zum Beginn des I. Weltkrieges deuten lässt, wird als Neurasthenie
bezeichnet.
Im heutigen Konversationslexikon steht der Begriff Neurasthenie für Nervenschwäche. Er ist
ein Sammelbegriff für mehrere organisch nicht fassbare Symptome, wie Kopfschmerzen,
Ermüdung, Reizbarkeit. Diese Symptome sind sowohl Folge körperlicher als auch geistiger
Überforderung. In der heutigen Zeit bezeichnet man diese Krankheit als vegetative Dystonie.
Doch in welchem Zusammenhang steht die Neurasthenie mit Thomas Manns Buddenbrooks?
In der Literaturwissenschaft ist es eindeutig bewiesen, dass die beschriebenen
Krankheitsgeschichten der Figuren aus dem Roman sich wie ein Leitfaden der
Neurasthenieentwicklung lesen lassen. Im Einzelnen möchte ich hierbei auf Thomas und
Christian Buddenbrook eingehen, da die beiden Brüder sehr exemplarisch zeigen, inwiefern
die Nervenschwäche den Alltag beeinflusst sowie ihre Auswirkungen im Zusammenhang mit
dem Verfall der Familie Buddenbrook. Doch im Vorfeld wird erst einmal die Bedeutung und
Betrachtung der Neurasthenie im 19. Jahrhundert geklärt. Darüber hinaus ist die Entwicklung
im Zusammenhang mit der Degeneration der Nerven und der Dekadenz-Lehre mit
einzubeziehen. Anhand der beiden oben genannten Buddenbrooks soll dies im Einzelnen
unter Berücksichtigung der Symptomatik der Neurasthenie dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neurasthenie im Blick des 19. Jahrhunderts
- Definition des Begriffs der Neurasthenie
- Entwicklung
- Dekadenz und Neurasthenie
- Textanalyse
- Zusammenhang zu den Buddenbrooks
- Thomas Buddenbrook
- Christian Buddenbrook
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung und Funktion der Neurasthenie in Thomas Manns „Buddenbrooks“. Ziel ist es aufzuzeigen, wie diese „Zivilisationskrankheit“ des Fin de Siècle den Roman prägt und den Zeitgeist sowie die Empfindungen der Menschen dieser Epoche widerspiegelt. Die Arbeit geht über eine reine Familien- und Sozialgeschichte hinaus und beleuchtet die Krankheit als Spiegel der gesellschaftlichen und individuellen Veränderungen.
- Darstellung der Neurasthenie im 19. Jahrhundert
- Die Neurasthenie als „Zivilisationskrankheit“
- Die Auswirkungen der Neurasthenie auf die Figuren Thomas und Christian Buddenbrook
- Der Zusammenhang zwischen Neurasthenie und dem Verfall der Familie Buddenbrook
- Die Neurasthenie als Spiegel des Zeitgeists
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale These auf, dass Thomas Manns „Buddenbrooks“ nicht nur eine Familiengeschichte ist, sondern auch die Neurasthenie als Spiegel des Zeitgeists und der Empfindungen der Menschen des Fin de Siècle darstellt. Der Roman wird als Reflexion der Geschichte des 19. Jahrhunderts positioniert, wobei die Neurasthenie als ein zentrales Element dieser Reflexion betrachtet wird. Die Arbeit kündigt die detaillierte Untersuchung der Rolle der Neurasthenie im Roman an, insbesondere im Hinblick auf die Figuren Thomas und Christian Buddenbrook.
Neurasthenie im Blick des 19. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beleuchtet die Neurasthenie als Krankheit des 19. Jahrhunderts. Es beginnt mit der Definition des Begriffs, basierend auf dem Meyers Konversations-Lexikon, welches die Neurasthenie als ein Sammelsurium unspezifischer Symptome beschreibt, die sowohl geistige als auch körperliche Überforderung widerspiegeln. Der Text differenziert zwischen einer hauptsächlich geistigen und einer körperlichen Form der Neurasthenie, beide mit einer Vielzahl an Symptomen wie Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Schmerzen und Angstzuständen. Es wird zudem die Entwicklung des Verständnisses von Neurasthenie im Kontext der Aufklärung, Industrialisierung und Urbanisierung erörtert, wobei die Rolle des Nervensystems und die zunehmende Hektik der modernen Welt hervorgehoben werden.
Textanalyse: Dieses Kapitel analysiert den Zusammenhang zwischen der Neurasthenie und den „Buddenbrooks“. Es zeigt auf, wie die beschriebenen Krankheitsgeschichten der Romanfiguren, insbesondere Thomas und Christian Buddenbrook, als exemplarische Fälle einer Neurasthenie-Entwicklung gelesen werden können. Die Analyse wird sich auf die Darstellung der Symptome und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben und den Verfall der Familie Buddenbrook konzentrieren. Durch die detaillierte Betrachtung der beiden Brüder wird deutlich, wie die Neurasthenie nicht nur individuelle Schicksale prägt, sondern auch einen gesellschaftlichen Kontext aufzeigt.
Schlüsselwörter
Neurasthenie, Thomas Mann, Buddenbrooks, Fin de Siècle, Zivilisationskrankheit, Nervenschwäche, Dekadenz, Jahrhundertwende, Gesellschaftskritik, Familienverfall, Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu: Neurasthenie in Thomas Manns "Buddenbrooks"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Darstellung und Funktion der Neurasthenie in Thomas Manns Roman "Buddenbrooks". Sie analysiert die "Zivilisationskrankheit" des Fin de Siècle als prägendes Element des Romans und als Spiegel des Zeitgeistes und der Empfindungen der Menschen dieser Epoche. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf der Familien- und Sozialgeschichte, sondern auf der Krankheit als Reflektion gesellschaftlicher und individueller Veränderungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Darstellung der Neurasthenie im 19. Jahrhundert, die Neurasthenie als "Zivilisationskrankheit", die Auswirkungen der Neurasthenie auf die Figuren Thomas und Christian Buddenbrook, den Zusammenhang zwischen Neurasthenie und dem Verfall der Familie Buddenbrook, und die Neurasthenie als Spiegel des Zeitgeists.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Neurasthenie im 19. Jahrhundert, eine Textanalyse und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung stellt die zentrale These vor und positioniert den Roman als Reflexion der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Das Kapitel zur Neurasthenie definiert den Begriff, beleuchtet seine Entwicklung und die damit verbundenen Symptome. Die Textanalyse untersucht den Zusammenhang zwischen der Neurasthenie und den "Buddenbrooks", insbesondere anhand der Figuren Thomas und Christian Buddenbrook. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird die Neurasthenie im 19. Jahrhundert dargestellt?
Das Kapitel zur Neurasthenie im 19. Jahrhundert definiert den Begriff anhand des Meyers Konversations-Lexikons, beschreibt die verschiedenen Symptome (geistig und körperlich), und erörtert die Entwicklung des Verständnisses von Neurasthenie im Kontext der Aufklärung, Industrialisierung und Urbanisierung. Es betont die Rolle des Nervensystems und die zunehmende Hektik der modernen Welt.
Wie wird die Neurasthenie in der Textanalyse behandelt?
Die Textanalyse untersucht, wie die Krankheitsgeschichten von Thomas und Christian Buddenbrook als exemplarische Fälle einer Neurasthenie-Entwicklung gelesen werden können. Sie konzentriert sich auf die Darstellung der Symptome und deren Auswirkungen auf das tägliche Leben und den Verfall der Familie Buddenbrook. Die Analyse zeigt, wie die Neurasthenie sowohl individuelle Schicksale prägt als auch einen gesellschaftlichen Kontext aufzeigt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Neurasthenie, Thomas Mann, Buddenbrooks, Fin de Siècle, Zivilisationskrankheit, Nervenschwäche, Dekadenz, Jahrhundertwende, Gesellschaftskritik, Familienverfall, Literaturanalyse.
Welche zentrale These vertritt die Arbeit?
Die zentrale These ist, dass Thomas Manns "Buddenbrooks" nicht nur eine Familiengeschichte ist, sondern auch die Neurasthenie als Spiegel des Zeitgeists und der Empfindungen der Menschen des Fin de Siècle darstellt. Der Roman wird als Reflexion der Geschichte des 19. Jahrhunderts verstanden, wobei die Neurasthenie ein zentrales Element dieser Reflexion bildet.
- Arbeit zitieren
- Sascha Engels (Autor:in), 2004, Darstellung und Funktion der Neurasthenie in Thomas Manns "Buddenbrooks", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122902