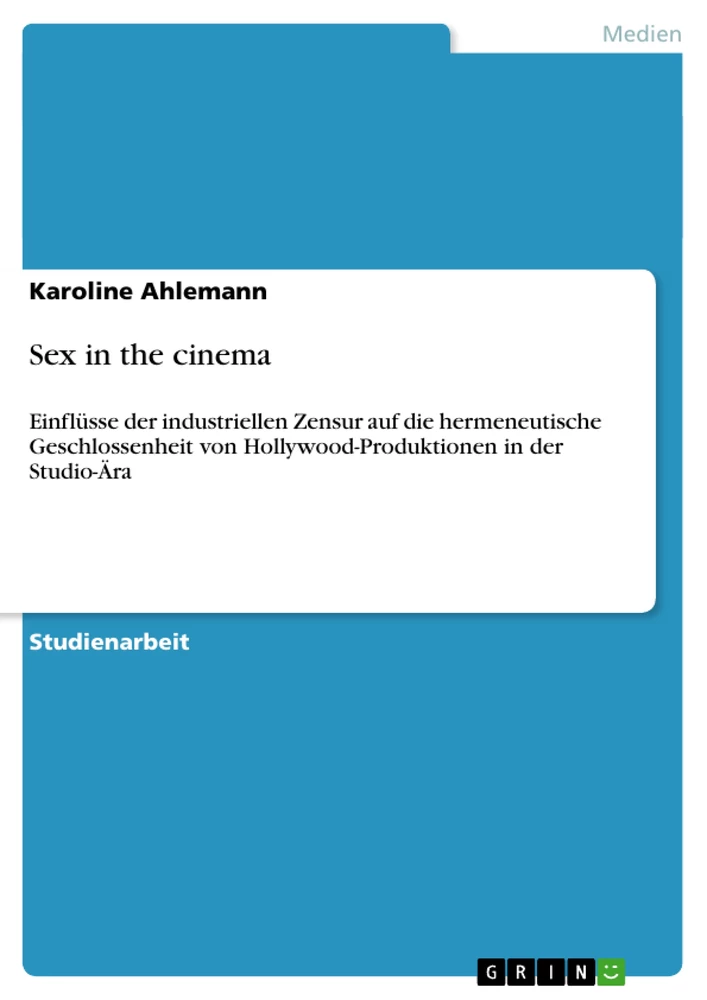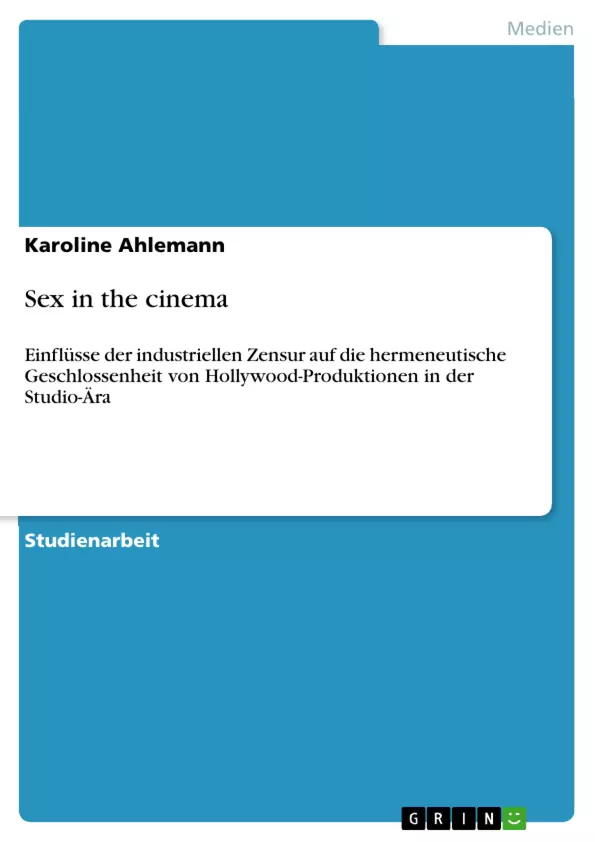Wenn man sich heutzutage einen Hollywood-Film anschaut, denkt man für gewöhnlich nicht darüber nach, ob es Probleme gab ihn in die Kinos zu bringen. Natürlich gibt es Ausnahmen, bei denen der Filmstart aus wirtschaftlichen oder aktuellen, gesellschaftlichen bzw. politischen Gründen aufgeschoben wird. Auch dass einzelne, kritische oder überflüssige Szenen herausgeschnitten werden, ist den meisten Kinobesuchern bekannt. Doch im Allgemeinen wird es für selbstverständlich gehalten, dass fertig produzierte Filme auch gezeigt werden. Gewaltdarstellungen, Sex, Kriminalität, Ehebruch oder Alkoholkonsum sind nahezu unzensiert auf der Leinwand zu sehen. Was nicht für Kinderaugen bestimmt ist, wird mit entsprechenden Altersfreigaben belegt. Doch das war nicht immer so.
Die Geschichte des amerikanischen Films ist gekennzeichnet von Kämpfen um den Einfluss auf das, was produziert und was gezeigt werden kann. Während es anfangs darum ging das Kino als ein profitorientiertes Geschäft sowie seine triviale Form der Unterhaltung im Blick zu behalten, entwickelte sich im Laufe der Zeit eine Zensur, die darauf zielte, das enorm einflussreiche und in den ersten 50 Jahren berühmtestes Massenmedium - den Film - zu kontrollieren (vgl. Bernstein 2000, 1).
Gegenstand dieser Referatsverschriftlichung auf Grundlage eines Textes von Richard Maltby soll es sein, die Entwicklung von Zensur und Selbstkontrolle in Zeiten der Studio-Ära zu erläutern und gleichzeitig deutlich zu machen, wie sich beide Formen bedingen und beeinflussen. Dazu ist es nötig, die verschiedenen politischen, gesellschaftlichen, kulturellen sowie religiösen Einflüsse zu untersuchen, die spezielle Maßnahmen wie die Bildung von Behörden sowie den Entwurf spezieller Kodizes erforderlich machten. Diese Richtlinien waren zwar nicht gesetzlich verankert, wurden aber ab 1934 Pflicht und erst 1967 wieder abgeschafft. Was den Konflikt ebenso kennzeichnet ist die Tatsache, dass das Medium Film erst 1948 vom Obersten Gerichtshof der USA als Bestandteil der Presse betrachtet wurde, deren Freiheit durch das First Amendment garantiert wird. Bis dato wurde der Film lediglich als eine Form der Massenunterhaltung angesehen (Maltby 1998, 255). Aber auch nach diesem Urteil hatte der Film noch lange Schwierigkeiten sich als staatlich geschütztes Medium durchzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Selbstkontrolle - der Weg des geringsten Widerstands
- Zensur im Wandel der Zeit
- Das frühe Hollywood-Kino auf dem Prüfstand
- Monopolbestrebungen und „Image-Kampagnen“
- Die Standards der Behörden
- Moralische Verpflichtungen
- Entwicklung von Erzählkonventionen
- Ambiguität als Mittel zum Zweck
- Allegorien und andere Anspielungen
- Einzigartiger Eigennutz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung von Zensur und Selbstkontrolle im Hollywood-Kino der Studio-Ära. Sie analysiert die Wechselwirkungen zwischen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Einflüssen und den daraus resultierenden Maßnahmen zur Kontrolle der Filmproduktion. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie Selbstzensur und staatliche Regulierung die filmische Erzählstruktur beeinflusst haben.
- Entwicklung der Filmzensur in Hollywood
- Einfluss der Selbstkontrolle der Studios
- Auswirkungen der Zensur auf die filmische Erzählweise
- Die Rolle der MPPDA und PCA
- Der Konflikt zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlichen Normen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Selbstkontrolle als dominierende Form der Zensur im frühen Hollywood. Es beschreibt die anfängliche Fokussierung auf profitorientierte Aspekte und die allmähliche Entwicklung einer umfassenderen Kontrolle von Inhalten. Das zweite Kapitel beschreibt den Wandel der Zensur im Laufe der Zeit, mit einem Vergleich zwischen Selbstkontrolle und staatlicher Zensur. Kapitel 2.1 analysiert die Herausforderungen des frühen Hollywood-Kinos durch lokale Zensurbehörden und die Entstehung der American National Board of Censorship. Kapitel 2.2 behandelt die Monopolbestrebungen der großen Studios und deren Imagekampagnen als Reaktion auf soziale und politische Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Filmzensur, Selbstkontrolle, Hollywood, Studio-Ära, MPPDA, PCA, Erzählkonventionen, Moral, Monopol, Imagekampagnen, Pressefreiheit.
- Quote paper
- Karoline Ahlemann (Author), 2008, Sex in the cinema, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/122913