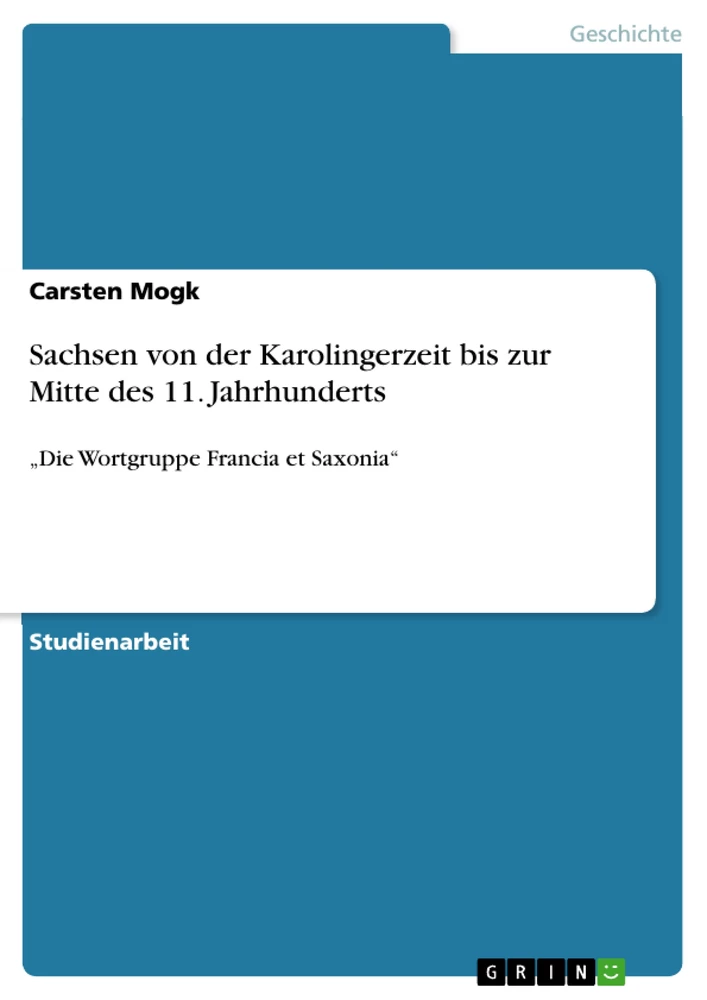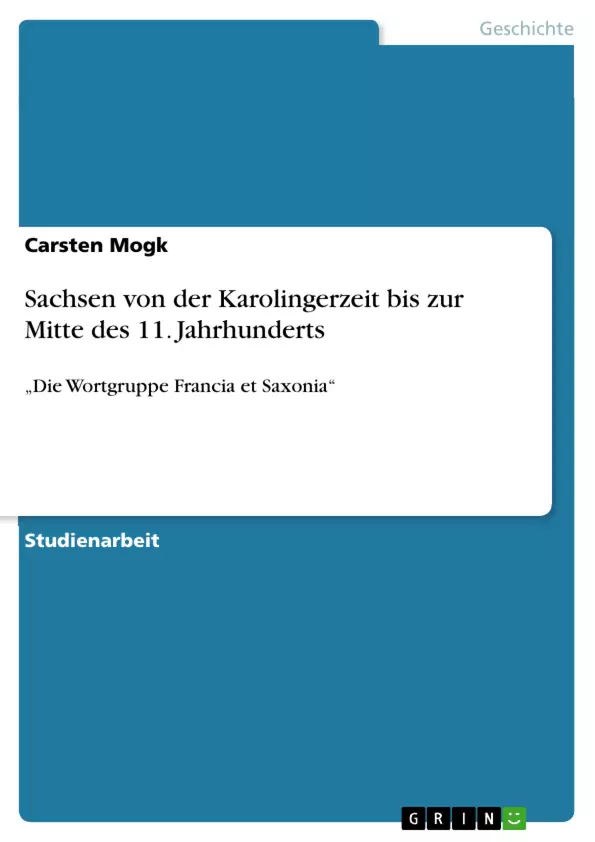Die Wortgruppe „Francia et Saxonia“, was in unserem Sprachgebrauch soviel wie Franken und Sachsen bedeutet, verdient als feststehende Wortverbindung besondere Aufmerksamkeit. In ihr spiegelt sich sprachlich nicht zuletzt das wider, was seit den Sachsenkriegen Karls des Großen als Einheit des Glaubens angedacht war. Gut einhundert Jahre nach Karl dem Großen sollte diese Wortverbindung erneut von zentraler Bedeutung sein. Unter der Herrschaft der Ottonen, ist zu beobachten, wie sie uns auch in offiziellen Diplomen dieser Zeit begegnet. Die Formulierung schien im Sprachgebrauch, besonders der Kanzlei Ottos I. nicht ungewöhnlich zu sein. Doch erst Widukind von Corvey, der mit etwas zeitlichem Abstand diesen Doppelterminus an drei, höchst bedeutsamen Stellen seiner Sachsengeschichte prägt, in der von Beginn an das Verhältnis der Franken und Sachsen im Mittelpunkt seiner Ausführungen steht, gibt Anlass die Frage nach einer tiefer greifenden Bedeutung der Wortgruppe „Francia et Saxonia“ zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Forschungsüberblick
- Zu älteren Belegen der Wortgruppe „Francia et Saxonia“ als mögliche Vorlagen Widukinds
- Die Wortgruppe „Francia et Saxonia“ als ottonische Kanzleiformel
- Die Wortgruppe „Francia et Saxonia“ als spätkarolingische Kanzleiformel
- Zum Geltungsbereich von „omnis francia saxoniaque“ bei Widukind von Corvey
- „omnis francia saxoniaque“ im Sinne des werdenden deutschen Reiches
- „omnis francia saxoniaque“ als ottonisches Reich und Lothringen
- „omnis francia saxoniaque“ als fränkisches und sächsisches Stammesland
- Die Deutung der Wortgruppe „Francia et Saxonia“ bei Widukind zwischen Kontinuität fränkischer Reichstradition und neuer Reichskonzeption
- „Francia et Saxonia“ als Ausdruck eines neuen ottonischen Reichsbewusstseins
- „Francia et Saxonia“ als Vorstufe einer sächsischen Reichskonzeption
- „Francia et Saxonia“ als bewusstes Anknüpfen an fränkische Tradition
- „Francia et Saxonia“ als Fortleben des einstigen ostfränkischen Teilreiches Ludwigs des Jüngeren
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wortgruppe „Francia et Saxonia“ in Widukinds Sachsengeschichte. Ziel ist es, die Ursprünge und Vorlagen der Wortgruppe zu erforschen, ihren Geltungsbereich zu definieren und mögliche Interpretationen hinsichtlich einer Veränderung des politischen Bewusstseins der damaligen Zeit zu analysieren. Dabei werden verschiedene Interpretationen der Wortgruppe berücksichtigt, da sie in Widukinds Werk nicht in der exakten Form „Francia et Saxonia“, sondern in Variationen wie „francorum atque saxonum“ und „francia saxoniaque“ auftritt.
- Die Entwicklung und Verwendung der Wortgruppe „Francia et Saxonia“ in der ottonischen Kanzlei.
- Der Geltungsbereich der Wortgruppe: Bezieht sie sich auf das entstehende deutsche Reich, das ottonische Reich inklusive Lothringen, oder auf die Stammesgebiete von Franken und Sachsen?
- Die Interpretation der Wortgruppe bei Widukind: Spiegelt sie ein neues ottonisches Reichsbewusstsein wider, eine sächsische Reichskonzeption, ein Anknüpfen an fränkische Traditionen oder das Fortleben eines ostfränkischen Teilreiches?
- Die Rezeption der Wortgruppe in der Geschichtswissenschaft.
- Die verschiedenen Deutungsansätze in der Forschung zur Bedeutung der Wortgruppe.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Vorbemerkungen führen in das Thema ein und erläutern die Bedeutung der Wortgruppe „Francia et Saxonia“. Der Forschungsüberblick präsentiert verschiedene Interpretationen der Wortgruppe aus der historischen Forschung, von frühen Ansätzen bis zu neueren Diskussionsbeiträgen. Die folgenden Kapitel analysieren ältere Belege der Wortgruppe, ihren Geltungsbereich und schließlich die Deutung durch Widukind im Kontext der Kontinuität fränkischer und der Entstehung einer neuen ottonischen Reichskonzeption.
Schlüsselwörter
Francia et Saxonia, Widukind von Corvey, Sachsengeschichte, Ottonen, Franken, Sachsen, deutsches Reich, Reichsbezeichnung, politische Ideologie, Reichskonzeption, Historiographie, Kanzleiformel, fränkische Tradition.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Formel „Francia et Saxonia“?
Es ist ein lateinischer Doppelterminus für „Franken und Sachsen“, der die Einheit dieser beiden Gebiete unter karolingischer und später ottonischer Herrschaft beschreibt.
Wer war Widukind von Corvey?
Widukind von Corvey war ein sächsischer Geschichtsschreiber des 10. Jahrhunderts, bekannt für seine „Sachsengeschichte“ (Res gestae Saxonicae).
Wie wurde der Begriff in der ottonischen Kanzlei verwendet?
Besonders unter Otto I. begegnet uns die Formulierung in offiziellen Diplomen als Ausdruck eines neuen Reichsbewusstseins und der Integration der Sachsen.
Bezieht sich „Francia et Saxonia“ auf das gesamte deutsche Reich?
In der Forschung wird diskutiert, ob damit das werdende deutsche Reich, das ottonische Kernreich inklusive Lothringen oder nur die Stammeslande gemeint waren.
Welche Rolle spielen die Sachsenkriege Karls des Großen für diesen Begriff?
Die Kriege schufen die Grundlage für die „Einheit des Glaubens“, die ein Jahrhundert später unter den Ottonen politisch neu interpretiert wurde.
Was ist das Besondere an Widukinds Verwendung dieses Terminus?
Widukind nutzt den Begriff an drei strategisch wichtigen Stellen, um das Verhältnis zwischen Franken und Sachsen als konstitutiv für das Reich darzustellen.
- Arbeit zitieren
- Carsten Mogk (Autor:in), 2006, Sachsen von der Karolingerzeit bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123101