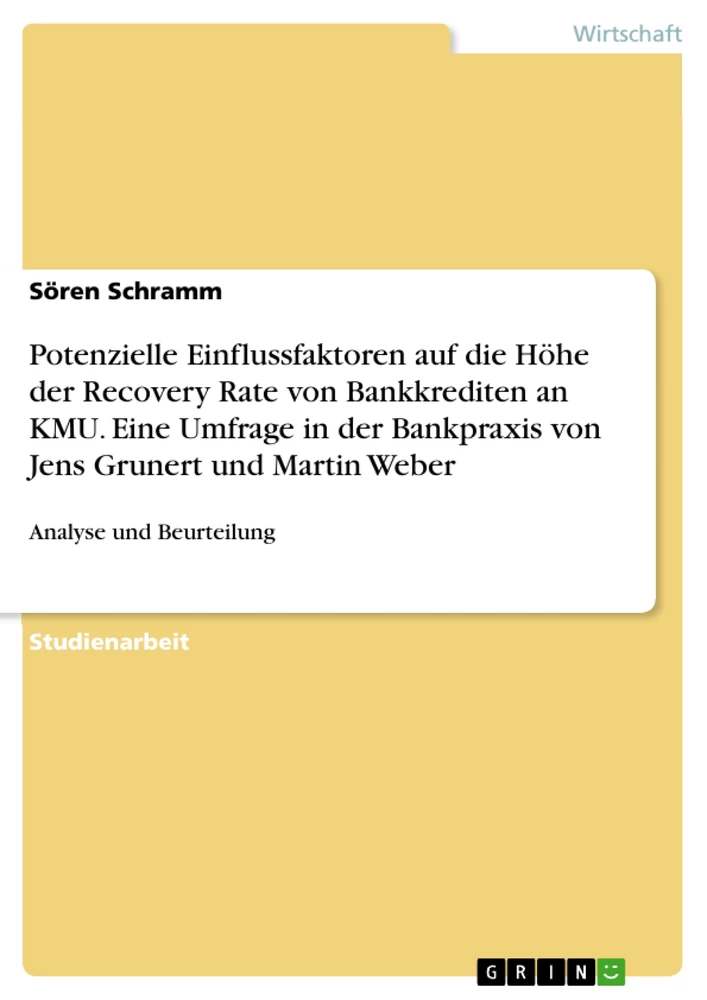Für das Kreditrisiko gibt es in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur mehr als eine Definition. Nachfolgend sollen drei Definitionsbeispiele genannt werden, die das Kreditrisiko in seiner Bedeutung bestimmen. Das Gabler Bank Lexikon in seiner aktuellen 13. Auflage spricht vom Kreditrisiko als dem „Risiko, das in der Gefahr des teilweisen oder vollständigen Ausfalls vertraglich vereinbarter Zins- und Tilgungsleistungen besteht, die ein Kreditnehmer zu erbringen hat.“
Schiller und Tytko unterteilen Kreditrisiken in originäre und derivative Risiken. Originäre Kreditrisiken setzen sich aus dem Bonitäts-, dem Liquiditäts-, dem Sicherungs- und dem Länderrisiko zusammen. Diese Art der Definition beschreibt die Tatsache, dass „bei einem Kreditgeschäft der Schuldner den vereinbarten Kreditvertrag nicht vertragsgerecht erfüllt.“ Die Inhalte des zu betrachtenden Artikels von Grunert und Weber sind dem originären Kreditrisiko zuzuordnen. Ergänzend sei noch das derivative oder auch passiv bezeichnete Kreditrisiko näher dargestellt, welches nach Schiller und Tytko aus dem Zinsänderungs-, dem Inflations-, dem Währungs- und dem Konsortialrisiko besteht.
Schierenbeck et. al. geben geben ihrer Definition vom Kreditrisiko noch eine quantitative Note, indem das „Kreditrisiko, das eine mögliche Verlustüberraschung umschreibt,“ nur den unerwarteten Verlust bezeichnet, „der über den bereits in der Standard-Risikokosten-Rechnung antizipierten Verlust hinausgeht.“ Dieser Definition folgend weist das Kreditrisiko drei Besonderheiten auf, die nachfolgend kurz genannt werden sollen.
1. In der Regel sind die Wahrscheinlichkeiten für Kreditverluste
deutlich rechtsschief verteilt.
2. Aufgrund von vielfältigen Interdependenzen zwischen dem
erwarteten und unerwarteten Verlust sind beide immer bei der Messung des Kreditrisikos zu berücksichtigen, obwohl der
erwartete Verlust durch die Berechnung der Standard-
Risikokosten bereits abgedeckt wurde.
3. Das Kreditrisiko eines Kreditportfolios lässt sich
analog der Kapitalmarkttheorie in eine systematische und
unsystematische Komponente zerlegen. Das systematische Risiko, welches nicht diversifiziert werden kann, wird z.B. durch makroökonomische Einflüsse geprägt. ...
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Überblick über das Kredit-/Risikomanagement in Banken
- 2.1 Der Risikomanagementprozess - kurz dargestellt
- 2.2 Kreditrisikomanagement in Banken
- 2.2.1 Bankaufsichtsrechtliche Vorschriften
- 2.2.2 Das Kreditrisiko - Definition und Ermittlung
- 2.2.3 Die Recovery Rate - Definition und Berechnung
- 3 Ziel und Aufbau der empirischen Untersuchung
- 3.1 Ziel der Untersuchung
- 3.2 Datenbasis
- 3.3 Befragungstechnik
- 4 Darstellung der Umfrageergebnisse
- 4.1 Ergebnisse der direkten Abfrage
- 4.2 Ergebnisse der Conjoint-Analyse
- 4.3 Vergleich der Ergebnisse der verschiedenen Abfragemethoden
- 5 Zusammenfassung, kritische Würdigung und Ausblick
- 5.1 Aufbau und Methodik der Umfrage
- 5.1.1 Methodik der Datenerhebung
- 5.1.2 Aufbau des Umfragedesigns
- 5.1.3 Stichprobenauswahl
- 5.2 Relevanz der Ergebnisse für die Praxis
- 5.3 Weiterführende Forschungsarbeiten
- 5.1 Aufbau und Methodik der Umfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert eine Studie von Grunert und Weber über potenzielle Einflussfaktoren auf die Recovery Rate von Bankkrediten an kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Das Hauptziel ist es, die Studie im Kontext des bankbetrieblichen Kredit- und Risikomanagements einzuordnen und die Ergebnisse kritisch zu würdigen.
- Einflussfaktoren auf die Recovery Rate von Bankkrediten an KMU
- Kreditrisikomanagement in Banken und die Rolle der Recovery Rate
- Methodische Ansätze zur Untersuchung der Recovery Rate
- Relevanz der Ergebnisse für die Bankpraxis
- Ausblick auf weiterführende Forschungsarbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Stellt den Kontext der Studie im Hinblick auf die gestiegene Bedeutung des Kreditrisikomanagements in Banken dar und hebt die Forschungslücke bezüglich Recovery Rates von Bankkrediten hervor.
Kapitel 2 (Überblick über das Kredit-/Risikomanagement in Banken): Gibt einen Überblick über den bankbetrieblichen Risikomanagementprozess und konzentriert sich auf das Kreditrisikomanagement, einschliesslich bankaufsichtsrechtlicher Vorschriften und der Definition der Recovery Rate.
Kapitel 3 (Ziel und Aufbau der empirischen Untersuchung): Beschreibt das Ziel der Studie von Grunert und Weber sowie die verwendete Datenbasis und Befragungstechnik.
Kapitel 4 (Darstellung der Umfrageergebnisse): Präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Umfrage, unterteilt in die Ergebnisse der direkten Abfrage und der Conjoint-Analyse, sowie einen Vergleich beider Methoden.
Kapitel 5 (Zusammenfassung, kritische Würdigung und Ausblick): Dieser Abschnitt ist aufgrund der Anforderung, Spoiler zu vermeiden, in dieser Vorschau nicht enthalten.
Schlüsselwörter
Recovery Rate, Kreditrisikomanagement, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Bankkredit, Ausfallwahrscheinlichkeit, IRB-Ansatz, Risikomessung, empirische Untersuchung, Conjoint-Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Recovery Rate bei Bankkrediten?
Die Recovery Rate (Erlösquote) gibt an, welcher Prozentsatz eines Kredits nach einem Zahlungsausfall des Kreditnehmers durch Verwertung von Sicherheiten oder sonstige Maßnahmen zurückgewonnen werden kann.
Welche Faktoren beeinflussen die Recovery Rate bei KMU?
Wichtige Faktoren sind die Art und Werthaltigkeit der Sicherheiten, die wirtschaftliche Lage der Branche, die Dauer des Insolvenzverfahrens und die Qualität des bankinternen Sanierungsmanagements.
Was ist der Unterschied zwischen erwartetem und unerwartetem Verlust?
Der erwartete Verlust wird über Risikoprämien kalkuliert. Der unerwartete Verlust ist die "Verlustüberraschung", die über die statistische Erwartung hinausgeht und durch Eigenkapital unterlegt werden muss.
Warum ist die Recovery Rate für den IRB-Ansatz wichtig?
Im Internal Ratings-Based (IRB) Ansatz nach Basel II/III müssen Banken eigene Schätzungen für Ausfallparameter (wie LGD - Loss Given Default) abgeben, wobei die Recovery Rate die zentrale Komponente ist.
Wie wurde die Recovery Rate in der Studie von Grunert und Weber untersucht?
Die Autoren nutzten eine Umfrage in der Bankpraxis und wendeten dabei Methoden wie die direkte Abfrage und die Conjoint-Analyse an, um die Einschätzungen von Experten zu gewichten.
- Arbeit zitieren
- Sören Schramm (Autor:in), 2008, Potenzielle Einflussfaktoren auf die Höhe der Recovery Rate von Bankkrediten an KMU. Eine Umfrage in der Bankpraxis von Jens Grunert und Martin Weber, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123124