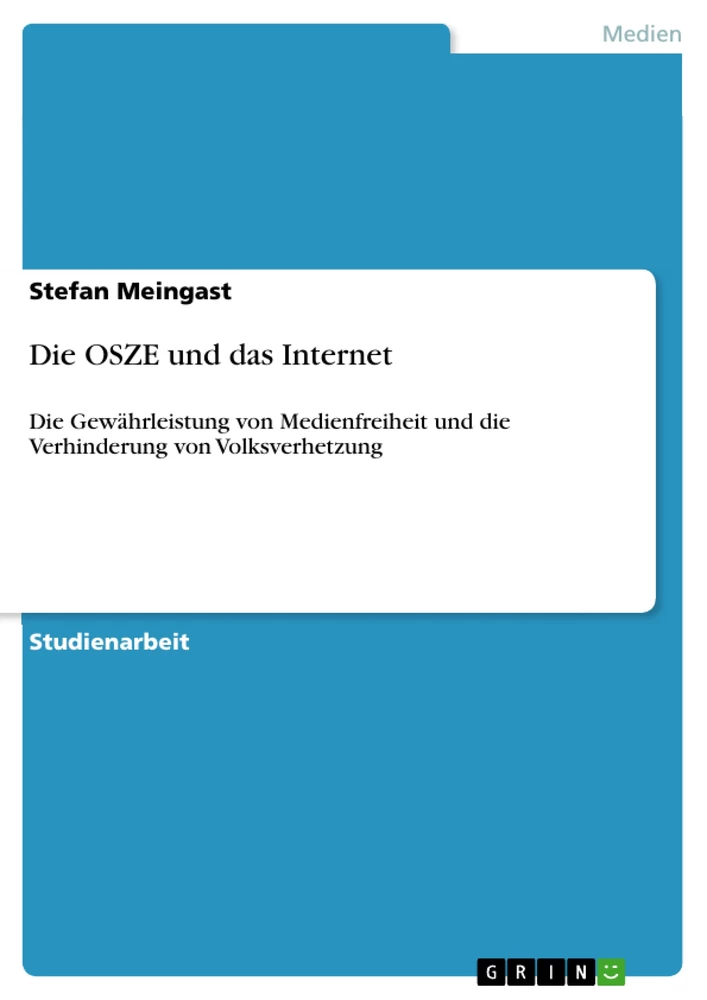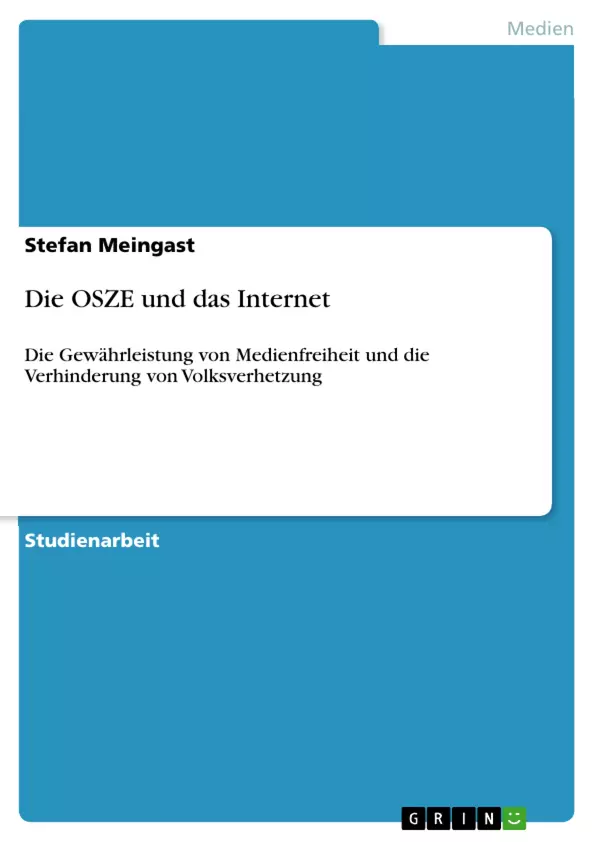In Artikel 19, Paragraf 3 der UN-Konvention „Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ (IPBPR) wird festgehalten, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung kein absolutes ist, sondern durchaus Einschränkungen unterliegt. Des Weiteren empfiehlt die Konvention in Artikel 20, dass jede Verbreitung von nationalistischem, rassistischem oder religiösem Hass, welche zu Feindseligkeiten oder Gewalt führen kann, per Gesetz verboten werden soll. Demnach stellt eine uneingeschränkte Meinungsfreiheit nicht ausschließlich ein zu förderndes Recht dar, sondern dessen Ausübung kann durchaus auch mit Problemen behaftet sein. Diese Tatsache trifft nicht allein auf den Einzelnen, sondern im Speziellen auf Medienbetriebe zu, welche ganz besonders für die Informationsversorgung der Öffentlichkeit zuständig sind – in den letzten Jahren verstärkt auch im Internet – und dabei eine besondere Verantwortung tragen. Wie im Fall der klassischen Verbreitungswege von Informationen, wie Zeitungen oder Fernsehen, stößt auch die Bereitstellung von Neuigkeiten im „World Wide Web“ auf Grenzen, wie sie die UN-Konvention beschreibt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), im Besonderen das Büro des OSZE-Beauftragten für Medienfreiheit, Freimut Duve, vertritt dabei die Ansicht, dass eine staatlich restriktive Gesetzgebung hinsichtlich der Medienfreiheit im Internet nicht notwendig sei.
In der vorliegenden Arbeit soll diesem Standpunkt widersprochen und gezeigt werden, dass es Möglichkeiten einer Regulierung gibt, die man als kooperativen Ansatz bezeichnen kann, weil sie sowohl Staat als auch private Medienbetriebe mit einbezieht und nicht allein auf legislative Maßnahmen baut. Am Beginn der Arbeit soll aber zunächst auf die begrenzten Möglichkeiten der OSZE im Bezug auf die Durchsetzung von Richtlinien durch die besondere Struktur der Sicherheitsorganisation eingegangen werden. Dann wird an die OSZE-Politik im Bemühen um freie Meinungsäußerung herangeführt, wie sie sich aus verschiedenen Dokumenten seit Beginn des so genannten „KSZE- oder Helsinki-Prozesses“ im Jahr 1975 ableiten lässt, und welchen Ansatz die OSZE heute in diesem Zusammenhang bei Medienbetrieben im Internet verfolgt. Am Schluss der Arbeit wird das Konzept der „Ko-Regulierung“ vorgestellt, das dazu dienen kann, den Ansprüchen von Artikel 19 und 20 IPBPR gerecht zu werden und einem Missbrauch der Medienfreiheit vorzubeugen.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. DIE OSZE UND DAS POSTULAT DER FREIEN MEINUNGSÄUBERUNG
- 1. Das Konzept der kooperativen Sicherheit
- 2. Die Förderung der freien Meinungsäußerung und Medienfreiheit
- a) Erste Dokumente
- b) Die Amsterdamer Empfehlungen
- III. DIE OSZE-POLITIK IM INTERNET
- 1. Die Bedeutung des neuen Mediums
- 2. Eine „liberale“ Herangehensweise
- IV. EINE MÖGLICHE REGULIERUNG
- 1. Grundprinzipien
- 2. Das Modell der Ko-Regulierung
- V. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen der OSZE im Bereich der Medienfreiheit im Internet. Der Fokus liegt dabei auf der Regulierung von Online-Medien und der Umsetzung des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung im digitalen Raum. Dabei werden insbesondere die Spannungsfelder zwischen dem Schutz von Menschenrechten und der Verhinderung von Volksverhetzung untersucht.
- Die Bedeutung der OSZE für die Sicherung der Medienfreiheit in Europa
- Die Herausforderungen der digitalen Welt für das traditionelle OSZE-Konzept der kooperativen Sicherheit
- Die Notwendigkeit und Möglichkeit einer Regulierung von Online-Medien
- Das Konzept der „Ko-Regulierung“ als Lösungsansatz
- Die Rolle der OSZE im Kampf gegen Volksverhetzung im Internet
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz von Medienfreiheit im Internet im Kontext der UN-Konvention „Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ dar. Kapitel II beleuchtet das Konzept der kooperativen Sicherheit der OSZE und analysiert die Organisation's Bemühungen zur Förderung der freien Meinungsäußerung. Es werden zentrale Dokumente der OSZE-Politik im Bereich der Medienfreiheit vorgestellt, die das Fundament für die heutige Arbeit der Organisation legen. Kapitel III befasst sich mit der Bedeutung des Internets als neues Medium und untersucht die „liberale“ Herangehensweise der OSZE in Bezug auf die Regulierung von Online-Medien. Kapitel IV präsentiert eine mögliche Regulierung von Online-Medien, die sich auf das Modell der „Ko-Regulierung“ stützt und sowohl staatliche als auch private Akteure einbezieht.
Schlüsselwörter
OSZE, Medienfreiheit, Internet, freie Meinungsäußerung, Volksverhetzung, kooperative Sicherheit, Ko-Regulierung, UN-Konvention, IPBPR, Amsterdamer Empfehlungen
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe der OSZE im Bereich Medienfreiheit?
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fördert die freie Meinungsäußerung und schützt Journalisten vor staatlicher Repression in ihren Teilnehmerstaaten.
Was versteht man unter „Ko-Regulierung“ im Internet?
Ko-Regulierung ist ein kooperativer Ansatz, bei dem staatliche Stellen und private Medienbetriebe gemeinsam Regeln (z.B. gegen Hassrede) festlegen und deren Einhaltung überwachen, statt nur auf Gesetze zu setzen.
Darf Meinungsfreiheit im Internet eingeschränkt werden?
Gemäß IPBPR (UN-Pakt) ist Meinungsfreiheit kein absolutes Recht. Einschränkungen sind möglich, um z.B. die Verbreitung von rassistischem oder religiösem Hass zu verhindern.
Was sind die „Amsterdamer Empfehlungen“?
Dies sind zentrale Dokumente der OSZE, die Richtlinien für die Freiheit der Medien und den Umgang mit neuen digitalen Kommunikationswegen formulieren.
Wie steht die OSZE zu staatlicher Internet-Zensur?
Die OSZE, insbesondere das Büro des Beauftragten für Medienfreiheit, vertritt traditionell eine liberale Ansicht und lehnt rein restriktive staatliche Gesetzgebung ab, da diese oft zur Unterdrückung von Opposition genutzt wird.
- Arbeit zitieren
- Stefan Meingast (Autor:in), 2004, Die OSZE und das Internet, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123153