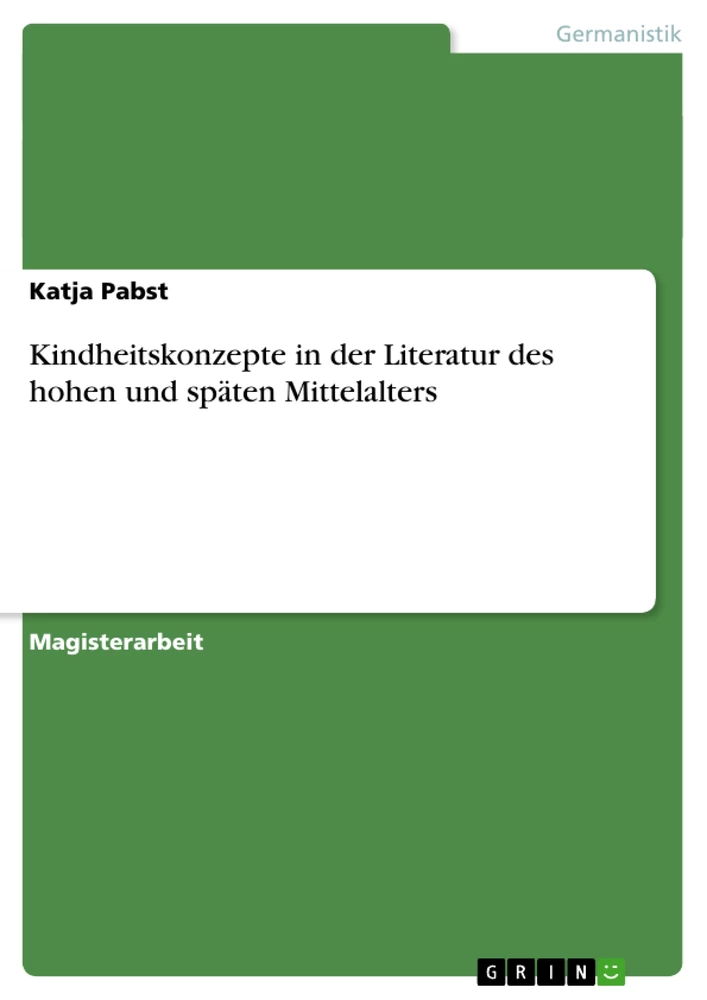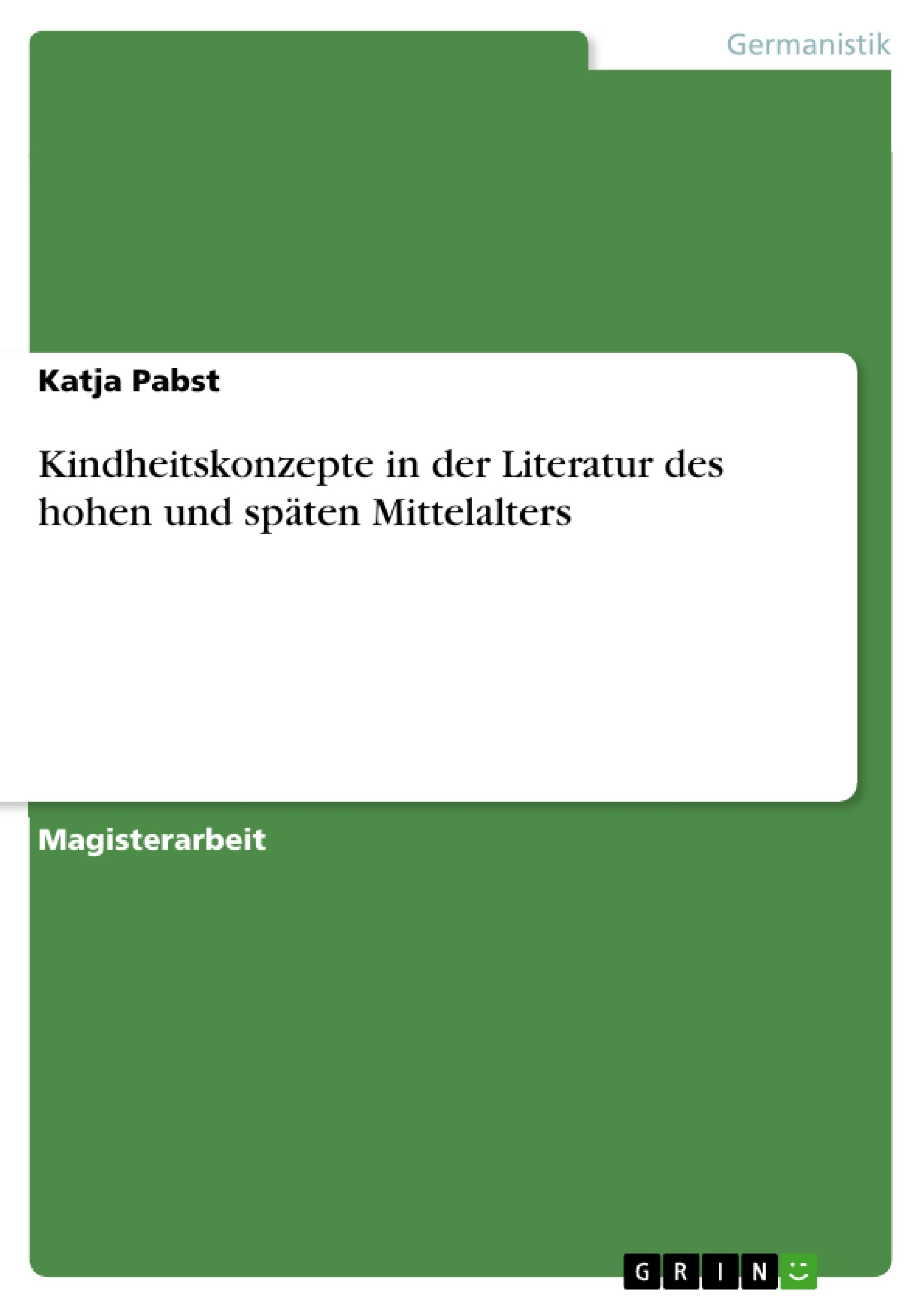Folgende Magisterarbeit ist ein Versuch, herauszuarbeiten, ob die von Ariès vertretenen
Thesen auch unter Berücksichtigung von volkssprachlicher Literatur des hohen und späten Mittelalters haltbar sind oder ob sich anhand der vorliegenden Texte vielleicht
ein anderes Bild für das Kindheitsverständnis dieser Epoche zeigt. Interessant
ist zu betrachten, welche Schlussfolgerungen - im Sinne einer historischen Anthropologie
- man aus den Texten für das Kindheitsverständnis dieser Zeit ziehen kann.
Um die Thesen von Ariès zu überprüfen, sollen in der vorliegenden Magisterarbeit
Kindheitsgeschichten in der deutschen Literatur des hohen und späten Mittelalters
untersucht werden. Als Untersuchungsgegenstände dienen drei fiktive Texte und
eine pädagogische Schrift des Mittelalters. Im Einzelnen sind dies: ‚Das Alexanderlied
des Pfaffen Lamprecht’3 in der Straßburger Fassung, das Heldenepos ‚Kudrun’4,
das höfische Versepos ‚Parzival’5 von Wolfram von Eschenbach und eine Übersetzung
des zweiten Buches des Fürstenspiegels ‚De regimine principum’ des Priesters
und Philosophen Aegidius Romanus mit dem Titel ‚Von der Sorge der Eltern für die
Erziehung ihrer Kinder’6. Dabei können die Texte nur exemplarisch verstanden werden.
Im Rahmen eines epischen und eines pädiatrischen Kindheitsdiskurses soll betrachtet
werden, ob und wie Kindheit und Kindlichkeit in Texten des hohen und späten
Mittelalters von den einzelnen Autoren thematisiert werden. Die Arbeit ist wie folgt
aufgebaut: Um eine theoretische Grundlage zu geben, wird zunächst kurz der Begriff
Kindheit erläutert und näher definiert. Danach werden die Thesen von Ariès im Einzelnen
genauer vorgestellt, und anschließend wird das so genannte hero pattern
dargelegt, das laut Uwe und Gunhild Pörksen als literarisches Muster charakteristisch
für epische Kindheitsgeschichten ist.7
Daraufhin folgt eine detaillierte Vorstellung der epischen Kindheitsgeschichten – vorangestellt
werden jeweils Informationen zu Autor und Werk. Unter Berücksichtigung
des hero pattern wird für jeden Text herausgearbeitet, inwiefern er Aussagen enthält, die für die Beurteilung des damaligen Kindheitsbildes in Bezug auf Ariès’ Thesen
relevant sind. Nach Einführung in die Texte zeigt eine Analyse, ob die Thesen von
Ariès haltbar sind oder ob die vorgestellten Kindheitsgeschichten diesen widersprechen.
Im Anschluss wird die pädagogische Schrift von Aegidius Romanus vorgestellt und
im Hinblick auf die Thesen von Ariès untersucht. In einem Schlusswort zeigt sich,
welche Erkenntnis man abschließend für das Kindheitsverständnis des Mittelalters
aus den Texten ableiten kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kindheit
- Ariès' Thesen
- Der epische Kindheitsdiskurs
- Häufige Funktionen von epischen Kindheitsgeschichten und das literarische Muster des hero pattern
- Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht
- Autor und Werk
- Die Kindheitsdarstellung von Alexander
- Züge des hero pattern im Alexanderlied
- Alexanders Kindheitsdarstellung und die Thesen von Ariès
- Kudrun
- Autor und Werk
- Die Kindheitsgeschichte von Hagen
- Züge des hero pattern in der Kindheitsgeschichte von Hagen
- Kindheitsdarstellung in der Kudrun und die Thesen von Ariès
- Parzival von Wolfram von Eschenbach
- Autor und Werk
- Die Kindheitsgeschichte von Parzival
- Züge des hero pattern in der Kindheitsgeschichte von Parzival
- Kindheitsdarstellung im Parzival und die Thesen von Ariès
- Pädiatrischer Kindheitsdiskurs
- Der Fürstenspiegel des Aegidius Romanus
- Zum Autor und Werk
- Kindheit in De regimine principum
- Diskussion
- Der Fürstenspiegel des Aegidius Romanus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Darstellung von Kindheit in der deutschsprachigen Literatur des hohen und späten Mittelalters, um die Thesen von Philippe Ariès zur Abwesenheit eines Kindheitsbewusstseins im Mittelalter zu überprüfen. Die Arbeit analysiert, inwiefern die ausgewählten Texte ein anderes Bild des Kindheitsverständnisses dieser Epoche zeichnen und welche Schlussfolgerungen sich daraus für eine historische Anthropologie ziehen lassen.
- Analyse der Kindheitsdarstellungen in ausgewählten literarischen Werken des Mittelalters.
- Bewertung der Thesen von Philippe Ariès anhand der untersuchten Texte.
- Untersuchung des "hero pattern" als literarisches Muster epischer Kindheitsgeschichten.
- Vergleich der epischen mit einer pädagogischen Kindheitsdarstellung.
- Beitrag zur historischen Anthropologie des Kindheitsverständnisses im Mittelalter.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Kindheitsverständnis im Mittelalter dar, basierend auf der Kritik an Ariès' Thesen. Die Kapitel zum epischen Diskurs analysieren die Kindheitsdarstellungen in „Das Alexanderlied“, „Kudrun“ und „Parzival“, jeweils unter Berücksichtigung des „hero pattern“ und im Bezug auf Ariès' Thesen. Das Kapitel zum pädiatrischen Diskurs untersucht den Fürstenspiegel des Aegidius Romanus und dessen Sicht auf Kindheit und Erziehung. Die Arbeit endet vor dem Fazit.
Schlüsselwörter
Kindheit, Mittelalter, Literatur, Ariès, Kindheitsdiskurs, epische Literatur, „hero pattern“, Pädagogik, „Alexanderlied“, „Kudrun“, „Parzival“, Fürstenspiegel, historische Anthropologie.
- Arbeit zitieren
- Katja Pabst (Autor:in), 2004, Kindheitskonzepte in der Literatur des hohen und späten Mittelalters, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123249