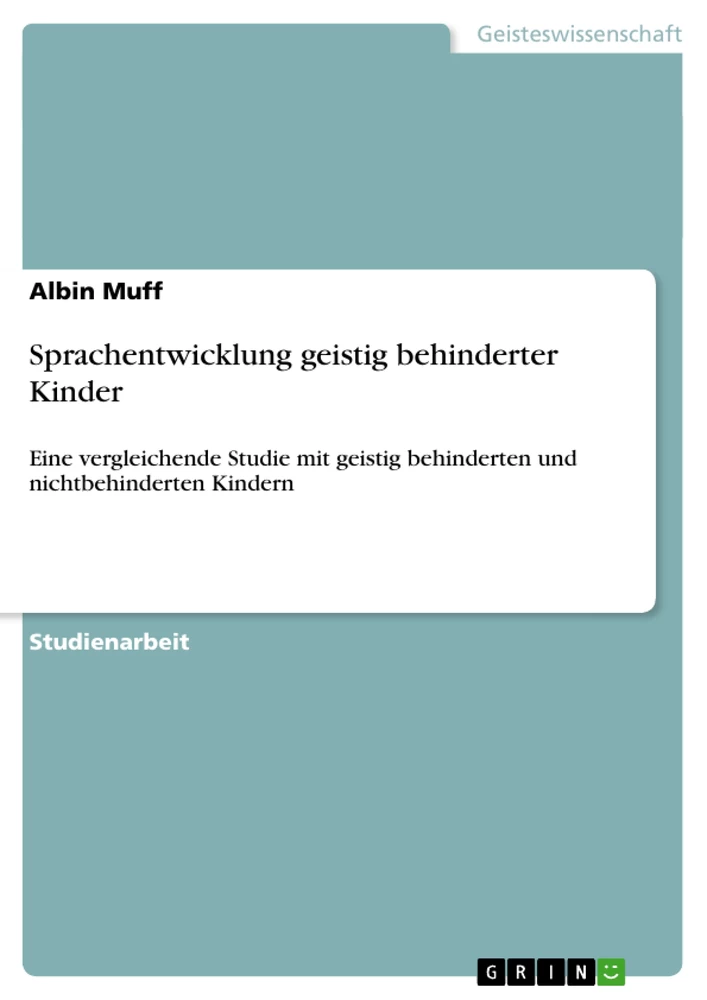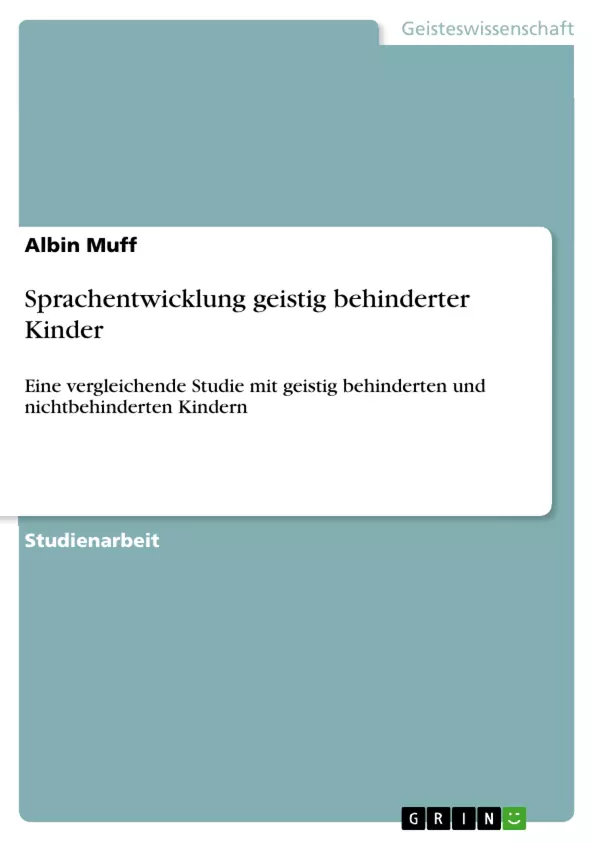Kommunikation ist die Grundlage jeder menschlichen Beziehung. Menschen mit Sprachschwierigkeiten müssen dies immer wieder schmerzlich erfahren. Dies betrifft häufig auch geistig behinderte Menschen. Sie sind durch ihr "kognitives Anderssein" von grundlegenden Entwicklungsprozessen geistiger, seelischer und körperlicher Art betroffen, die sehr eng mit Sprache und
Sprechfähigkeit verknüpft sind. Nicht selten ist bei ihnen eine Verzögerung, Beeinträchtigung oder Störung der Sprache bzw. Sprachentwicklung festzustellen.
In der vorliegenden Studie wird die sprachliche Entwicklung von geistig behinderten und nichtbehinderten Kindern verglichen. Als Vergleichskriterium wird dabei das Entwicklungsalter gewählt, da der Begriff der Intelligenz bzw. des Intelligenzalters wenig geeignet erscheint.
Ziel dieses Vergleichs ist neben dem fachlichen Erkenntnisgewinn auch die Chance, nichtbehinderten Menschen ein besseres Verständnis für die Lebenswelt geistig behinderter Menschen zu eröffnen. Wenn man den Blick auf die Sprache richtet, werden weniger die Stärken und besonderen Fähigkeiten von geistig behinderten Menschen bei Kommunikation – wie Emotionalität oder non-verbale Signale - beleuchtet. Jedoch hängt der Erfolg aller Bemühungen um gesellschaftliche Integration von gelungener Kommunikation ab. Und dabei ist sprachliches Verständnis ein Schlüsselfaktor.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Theoretische Grundlegung
- Behinderung
- Geistige Behinderung
- Ansätze zu einer Definition
- Erzieherisch bedeutsame Besonderheiten
- Ausgewählte epidemiologische Daten
- Ursachen von geistiger Behinderung
- Chromosomal verursachte geistige Behinderung
- Metabolisch verursachte geistige Behinderung
- Andere und ätiologisch unklare Ursachen von geistiger Behinderung
- Exogene Formen der geistigen Behinderung
- Biosoziale Kumulation
- Entwicklungsspezifika
- Sprache
- Physiologische Grundlagen
- Linguistische Grundlagen
- Soziologische Anmerkungen zur Sprache
- Entwicklungspsychologische Daten
- Psycholinguistische Theorien zur Sprachentwicklung
- Formal-syntaktische Ansätze
- Semantisch-relationale Ansätze
- Kommunikativ-pragmatische Ansätze
- Neuere Forschungsergebnisse zu Sprache und Sprachentwicklung
- Neurobiologische Lernmechanismen
- Konnektionistische Theorien zum Spracherwerb
- Sprachstörungen
- Stammeln bzw. Dyslalie
- Näseln
- Dysgrammatismus
- Stottern
- Poltern
- Sonstige Sprachstörungen
- Sprache und Sprechen bei geistiger Behinderung
- Deskriptive Betrachtung
- Verzögerte Sprachentwicklung
- Sprachaufbaubegrenzung
- Sprachstörungen
- Sprachsituation von schwerhörigen und zerebral geschädigten geistig behinderten Menschen
- Sprachsituation von schwerst geistig Behinderten
- Vergleich mit der Sprache nichtbehinderter Kinder gleichen Intelligenzniveaus
- Sprachförderung bei geistig behinderten Kindern
- Neuere Förderansätze und Forschungsergebnisse
- Augmentative und Alternative Kommunikation
- Facilitated Communication
- Deskriptive Betrachtung
- Fragestellungen und Aufbau der Untersuchung
- Hypothesen zum Entwicklungsstand
- Hypothesen zur Sprachentwicklung
- Begründung des methodischen Vorgehens
- Beschreibung der Testgruppen
- Vorstellung des Heidelberger Sprachentwicklungstests
- Vergleich mit konkurrierenden Testverfahren
- Theoretische Grundlagen
- Kurzbeschreibung der Untertests
- Testgütekriterien
- Modifikationen
- Vorstellung des Sensomotorischen Entwicklungsgitters
- Vergleich mit konkurrierenden Testverfahren
- Theoretische Grundlagen
- Testgütekriterien
- Modifikationen
- Aufbau der Untersuchung
- Ergebnisse der Untersuchung
- Ergebnisse zum Entwicklungsstand
- Ergebnisse zur Sprachentwicklung
- Sprachliche Retardierung
- Sprachliche Komplexität
- Sprachliche Auffälligkeiten und Störungen
- Spezifisches Reifeplateau der Sprache
- Kommunikativer Aspekt der Sprache
- Interpretation der Ergebnisse
- Beziehungen zwischen dem Heidelberger Sprachentwicklungstest und dem Bereich Sprache des Sensomotorischen Entwicklungsgitters
- Fehlerquellen
- Interpretation der Ergebnisse im Lichte der Humanwissenschaften
- Defektorientierte medizinische Sichtweise
- Entwicklungspsychologische Sichtweise
- Aspekte der Allgemeinen Psychologie
- Psycholinguistische Interpretation
- Kommunikationstheoretische Aspekte
- Aspekte der Allgemeinen Pädagogik
- Sonderpädagogische Konsequenzen für die Sprachförderung geistig behinderter Kinder
- Sprachliche Aspekte einer integrativen Jugendarbeit mit geistig behinderten Jugendlichen
- Problemstellung und Ansatz
- Begriffsklärungen
- Chancen und Bedingungen integrativer Jugendarbeit
- Grenzen und Probleme der Integration
- Grundsätzliche Überlegungen
- Exkurs: Einstellungen gegenüber geistig behinderten Menschen
- Anmerkungen zu den Ergebnissen der vorliegenden Studie
- Beispiele für die Integration geistig behinderter Menschen in einem Jugendverband
- Das Erfahrungsfeld: der Jugendverband DPSG
- Fallbeispiel 1: Liechtensteinrat
- Fallbeispiel 2: Segeltörn
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachentwicklung geistig behinderter Kinder im Vergleich zu nichtbehinderten Kindern. Ziel ist es, den Entwicklungsstand und die sprachlichen Fähigkeiten beider Gruppen zu vergleichen und daraus Schlussfolgerungen für die Sprachförderung geistig behinderter Kinder abzuleiten.
- Vergleich der Sprachentwicklung geistig behinderter und nichtbehinderter Kinder
- Identifizierung sprachlicher Besonderheiten bei geistiger Behinderung
- Analyse der Ursachen für sprachliche Defizite bei geistig behinderten Kindern
- Entwicklung geeigneter Förderansätze für die Sprachentwicklung
- Integration geistig behinderter Jugendlicher in inklusive soziale Settings
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein. Kapitel 1 legt die theoretischen Grundlagen dar, einschließlich Definitionen von Behinderung und geistiger Behinderung, sowie Aspekte der Sprachentwicklung und -störungen. Kapitel 2 beschreibt die Methodik der Studie, die Fragestellungen und die verwendeten Testverfahren. Die Ergebnisse werden in Kapitel 3 präsentiert, wobei der Fokus auf den Vergleich der Sprachentwicklung beider Gruppen liegt. Kapitel 4 interpretiert die Ergebnisse und diskutiert ihre Implikationen für die Praxis der Sprachförderung und die inklusive Jugendarbeit.
Schlüsselwörter
Geistige Behinderung, Sprachentwicklung, Sprachstörungen, Sprachförderung, inklusive Pädagogik, Vergleichsstudie, Heidelberger Sprachentwicklungstest, Sensomotorisches Entwicklungsgitter, Integrative Jugendarbeit.
- Quote paper
- Dr. Albin Muff (Author), 2009, Sprachentwicklung geistig behinderter Kinder, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/123309